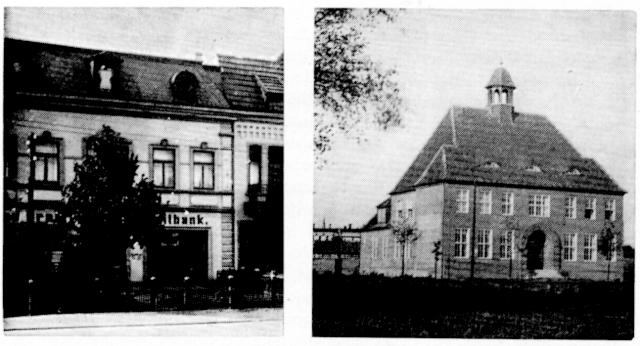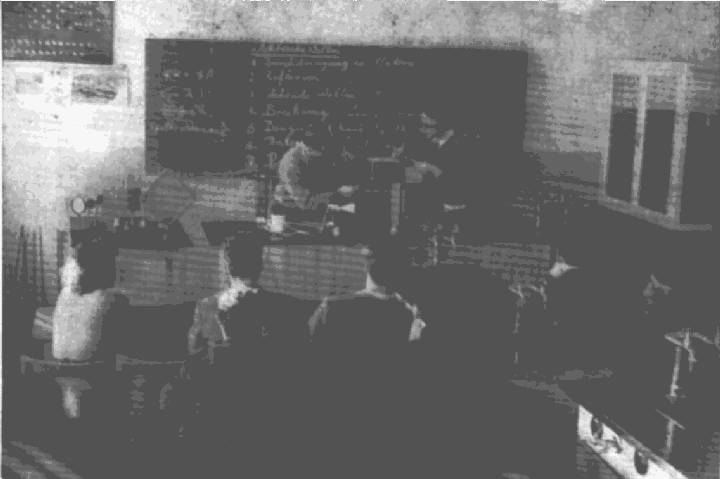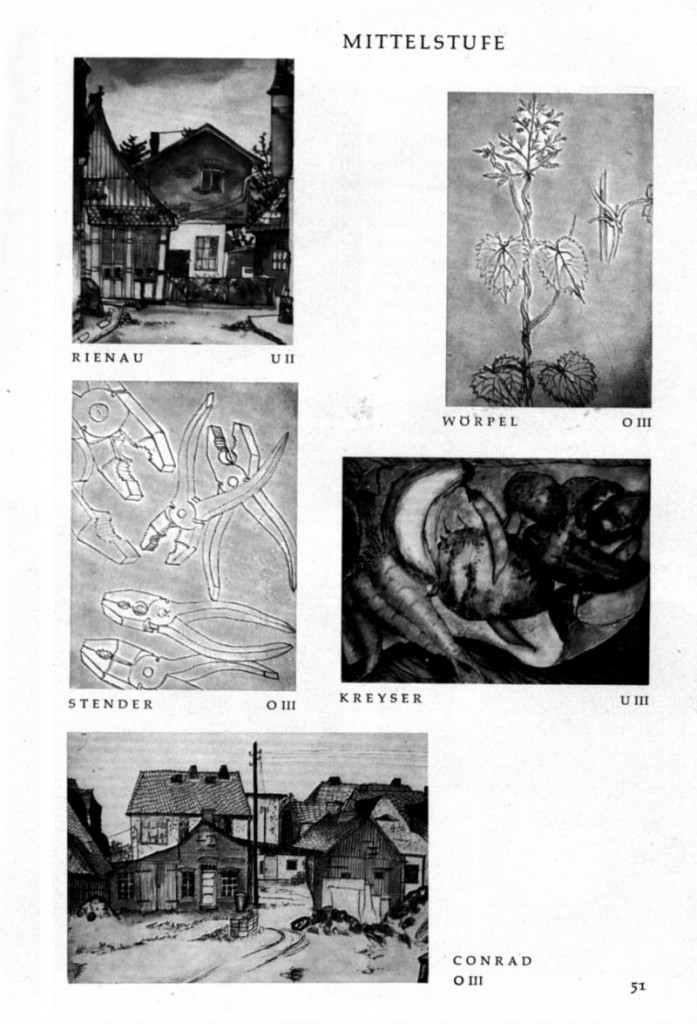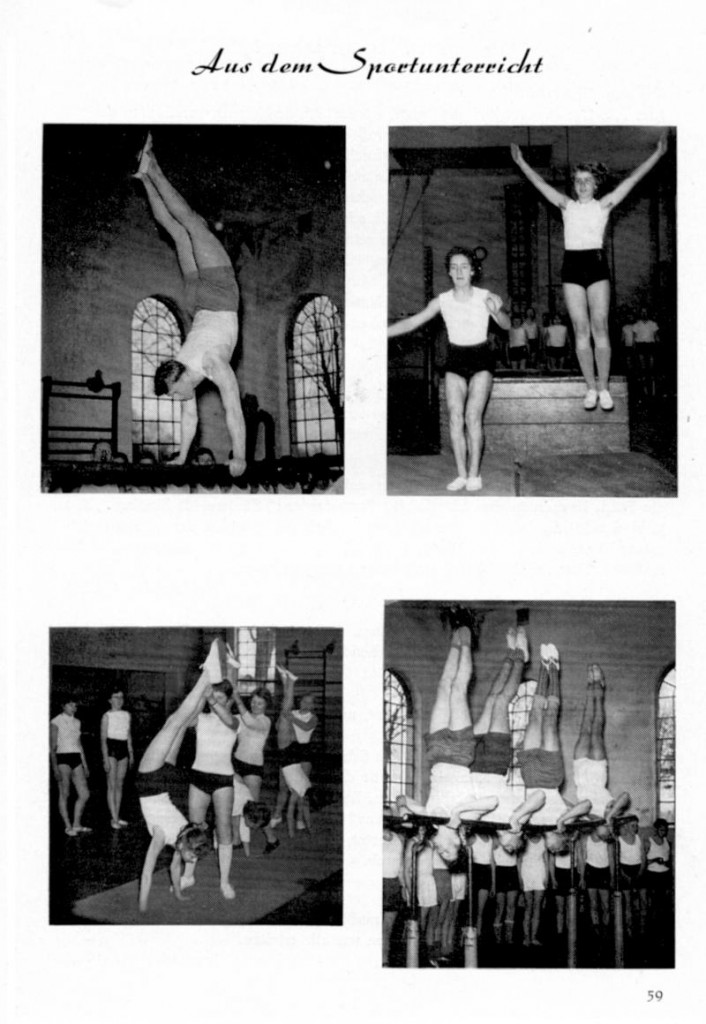Die Bramstedter Heilquellen
Über die Art der Entdeckung und die ersten Heilwirkungen der Quelle gibt Ferd. O. V. Lawätz, ein geistig reger Mann und seit 1774 Besitzer des Gutes Bramstedt, folgende, nicht bestrittene Nachrichten.
„Anno 1681 im Monat Juni ist der hiesige köstliche Gesundbrunnen entsprungen, wodurch viele herrliche Curen durch göttliche Hülfe und Segen verrichtet, und ist folgender Gestalt entdecket. Ein Knabe mit Namen Gerd Giesler hütet seines Vaters Schweine und hatte schon das Fieber bei 1 1/2 Jahren gehabt. Wie ihm nun einstens das Fieber ankommt, bittet er die anderen Knaben, sie möchten doch nach seinen Schweinen sehen, und setzet sich indessen im Grunde unter einer Eiche nieder. Und weilen mit dem Fieber ein starker Durst ihn plaget, rufet er zu Gott in seiner Einfalt, daß Er ihn doch einmal von dem Fieber aus Gnaden befreien wolle. – Er wird hierauf sogleich gewahr, daß da Wasser bei der Wurzel des Eichbaumes hervorkommt, hält seinen Hut dahin, lasset einen guten Trunk darauslaufen und trinkt davon, um seinen Durst zu löschen. Zu seiner großen Freude und Verwunderung hört der Durst wie auch das Schaudern den Augenblick auf, und er fängt an zu singen; da denn die Knaben zu ihm sagen, wenn er singen könnte, so könnte er auch seine Schweine selber in Acht nehmen, welches er mit Ja beantwortet. Gehet darauf hervor und saget niemand, was ihm widerfahren, bis nach etlichen Tagen, da er höret, daß eine Frau, deren Mann Johann Hambeck geheißen, auch das Fieber hatte. Da er dann sagte: Sie dürften nur von dem Wasser holen, welches neulich bei dem Eichbaum hinter den Mohrstätten entsprungen, alsdann würde ihr wohl geholfen, eben wie ihm. Welches sie auch getan, und es hat gleiche Cur an ihr verrichtet. Wie nun dieses bald darauf weit und breit kund geworden, sind viele Kranken und Preßhafte von andern Orten, auch aus Hamburg, häufig herzugekommen, da denn in allem über 800 Personen bei diesem Brunnen gesund geworden. Die als Krüppel und Lahme dahin gekommen, haben nachher ihre Krücken und Stäbe an den Eichenbaum gehangen und sind mit Freuden und Lob Gottes nach ihrer Heimat gegangen. Ermeldeter Eichbaum hat noch gestanden bis 1704.“
Aus Anlaß des 300jährigen Jubiläums der Heilquelle und des 50jährigen Jubiläums des 1931 erbauten “Neuen” Kurhauses erschien eine Festschrift, der Inhalt im Folgenden abgedruckt ist.

(1)
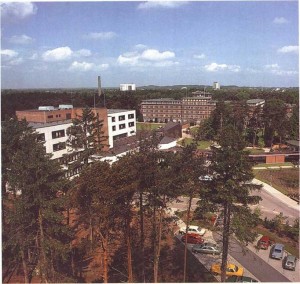
Die Rheumaklinik Bad Bramstedt 1981 mit ihren Schwerpunkten Zentralbau (links) und das ehemalige Haupthaus (rechts)
(2)
300 Jahre
Bad Bramstedter Heilquellen
1681 — 1981
50 Jahre
Rheumaklinik Bad Bramstedt
1931 — 1981
(3)
Impressum
Herausgegeben von der Stadt Bad Bramstedt und der Rheumaklinik Bad Bramstedt
Redaktion: Horst ZIMMERMANN
Graphische Gestaltung: Bernd STRIEPKE
Bildgestaltung: Jan-Uwe SCHADENDORF
© Verlag: C. H. WÄSER, Bad Segeberg
(4)
Inhalt
(5)
Vorwort
Vor 300 Jahren wurde 1681 die erste Bramstedter Heilquelle entdeckt. Seit 50 Jahren besteht die Rheumaheilstätte/Rheumaklinik. Aus diesem Anlaß geben die Stadt Bad Bramstedt und die Rheumaklinik eine Festschrift ,,300 Jahre Bad Bramstedter Heilquellen 1681/1981 und 50 Jahre Rheumaklinik Bad Bramstedt“ heraus.
Diese Festschrift soll keine Bramstedter Chronik sein. Ihre Hauptaufgabe ist es, die ersten Phasen der Nutzung der Heilquellen seit 1681 in Zusammenhang mit der Entwicklung der Bäderheilkunde darzustellen. Geschildert wird in einem weiteren Schwerpunkt das Wirken der Rheumaklinik Bad Bramstedt in 50 Jahren 1931 bis 1981.
Die medizinisch-wissenschaftlichen Beiträge werden durch Hintergrundschilderungen mit umfangreichem Meinungsspektrum ergänzt. Alle Verfasser betrieben eingehende Quellenforschungen,
Die vorliegende Schrift ist ebenso für die Einwohner der Kur- und Rolandstadt wie auch für die vielen Gäste der Rheumaklinik und alle die bestimmt, die Verbindungen mit der Rheumaklinik und Bad Bramstedt haben. Die Festschrift soll eine Orientierungshilfe darstellen, um eine sachgerechte Information über ,,300 Jahre Bad Bramstedter Heilquellen und 50 Jahre Rheumaklinik 1931/1981″ zu ermöglichen.
Stadt Bad Bramstedt
Rheumaklinik Bad Bramstedt
(7)
Professor Dr. med. Gerhard RUDOLPH
Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin und Pharmazie
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
300 Jahre Gesundbrunnen im Norden
Von der Trink- und Badekur zur umfassenden Physikalischen Therapie
1. Ursprung und antike Überlieferung
Eine über drei tausendjährige westeuropäische Tradition der Heilquellenverehrung und des Badewesens läßt vermuten, daß die Heilfaktoren Wasser, Mineral- und Temperaturwirkungen immer wieder mit Erfolg therapeutisch eingesetzt wurden. Während vieler Jahrzehnte des augusteischen Zeitalters, so versichert der ältere PLINIUS (23-79) „haben die Römer keine anderen Ärzte gekannt als ihre Bäder“. Von AUGUSTUS wird berichtet, daß er erfolgreiche Rheumakuren in Baiae und in Dax (heute ein bedeutendes südwestfranzösisches Heilbad) durchgeführt hat. Seit dem Altertum kennen wir Kurorte im modernen Wortsinn. Unter dem Wechsel kultureller, wirtschaftlicher und gesellschaftspolitischer Einflüsse haben sie ein gleichfalls wechselvolles Schicksal erlebt. Zeiten der Blüte, des Niedergangs, des völligen Verschwindens, aber auch der Wiedererweckung lösten sich ab. Damit ist die Geschichte des Bäderwesens zugleich ein Spiegel europäischer Kulturgeschichte.
Der Ursprung des Bäderwesens, wobei Badewesen und Bäderwesen in der Frühzeit begrifflich zusammenfließen, ist älter als alle schriftlichen Zeugnisse darüber. So wurde beispielsweise 1907 in bester Erhaltung die vorrömische, bronzezeitliche Quellfassung des Sauerbrunnens (Mauritiusquelle) von St. Moritz im Engadin entdeckt. Sie wurde im zweiten vorchristlichen Jahrtausend angelegt. Kelten und Germanen kannten und nutzten Heilquellen schon lange Zeit vor der Berührung mit der römischen Zivilisation.
Die frühe Hochkultur der Griechen, die das gesamte Abendland in Denken und Handeln geprägt hat, läßt sowohl die kultischen wie die medizinischen Ursprünge des Bäderwesens deutlich erkennen. Für den ursprünglichen Menschen, der sich von der Macht der umgebenden Natur noch bestimmt und getragen fühlt, der sich als Teil, als Abbild dieser Natur empfindet, ist das aus dem Erdreich fließende Wasser Gegenstand der Verehrung. Die Quelle bringt – von der mittelmeerischen Landbevölkerung nachhaltig empfunden- Fruchtbarkeit und Gedeihen. Sie spendet Leben. Als heilige Quelle wirkt sie Wunder; sie wird zum Born der Gesundheit, der Lebensverlängerung.

Hygienische Bedeutung des Wassers. Beispiel griechischer Vasenmalerei 6. – 4. Jh. Pelike aus Athen, Nationalmuseum
Orte, an denen Quellen entspringen, tragen den Charakter des Besonderen, der Unverletzlichkeit. Sie laden ein zu Besinnung und Einkehr. Zur heiligen Quelle gehört ihr unmittelbarer landschaftlicher Bezug, ein Felsen, eine Grotte, eine Gruppe von Bäumen, der heilige ,,Hain“. Denker und Dichter wie PLATO (um 428-348) und SENECA (um 465) bis hin zu KLOPSTOCK (1724-1803) im Norden, haben die „Ahnung des Göttlichen“ von Quelle und Hain in poetischer Sprache verdeutlicht. Die Quellen der Griechen befanden sich in göttlicher Hut. Die Quellnymphen sind die ältesten volkstümlichen Gottheiten; sie besaßen heilende Kraft. Sie wurden als „Arztkundige“, als „Löserinnen der Mühsal“ angesprochen und dem Heilgott Asklepios (Äskulap) im Kult verbunden.
Neben dieser lebenspendenden, Verehrung heischenden Bedeutung hat das Wasser aber noch die Funktion der Reinigung, der körperlichen wie der moralischen, der Befreiung von Schuld, auch der schuldhaften Ursache von Krankheit. Das Untertauchen im Wasser ist eine Art Wiedergeburt, ein Akt der Erneuerung. Von den Griechen wurde aus diesen frühen, metaphysischen Ursprüngen des Badens der säkularisierte moderne Gebrauch abgeleitet: die Anwendung des Wassers in der täglichen Hygiene und die Nutzung der Quellen, der Mineral- und Thermalquellen zu Kur- und Heilzwecken. Von der hygienischen Bedeutung des Bades geben zahlreiche Vasenbilder als Ausschnitte täglicher Gewohnheit lebendige Kunde (Abb.) und es erscheint fast trivial, in diesem Zusammenhang an den Spruch des Lyrikers PINDAR (518 – 438) zu erinnern: „Ariston men hydor – das Beste aber ist das Wasser.“
Der hippokratische Verfasser der Schrift „Über die alte Heilkunst“ (4. vorchristliches Jahrhundert) hat ganz hellsichtig die Ursprünge der ärztlichen Wissenschaft aus der sinnvollen Regelung der Lebensweise abgeleitet (Heinrich Buess), wofür die Griechen den Namen diaita, Diätetik gewählt haben. Die Diätetik umfaßt sechs Verhaltenskategorien, deren Ausgewogenheit der Arzt für jeden einzelnen gleichsam errechnet, um ihn so der bestmöglichen Lebensordnung – entsprechend dem Ideal leibseelischer Harmonie, wie die Griechen es forderten – zuzuführen. Die sechs Kategorien sind: 1. Umgebung (Wasser, Licht und Luft), 2. Speise und Trank, 3. Bewegung und Ruhe, 4. Schlafen und Wachen, 5. Ausscheidungen und Absonderungen, 6. Gemütsbewegungen (Psychosomatik). Sie haben über ein Jahrtausend mittelalterlicher Heilkunde als „Regimen sanitatis“ (Gesundheitsordnung) ihre unbestrittene Rolle gespielt und sind auch heute noch in den Kurplan einzubeziehen. Ein solches „Regimen“ verlangt von dem Patienten innere Umstellung und aktive Mitarbeit.

Badender Jüngling – Schale im Nationalmuseum Athen.
Die Griechen machten die ursprünglich regellose Bäderanwendung zur Kunst. Einreibungen, Massage, Gymnastik wurden planmäßig in das Behandlungsprogramm einbezogen. Bäder wurden in medizinischen Behandlungsstätten (Asklepiostempeln) eingerichtet und versahen ihren Dienst neben natürlichen, sogenannten herakleiischen (Wild-)Bädem und heilkräftigen Quellen.
Dieser reiche Erfahrungsschatz wurde von griechischen Ärzten auf die italische Halbinsel, und ab der Mitte des 3. vorchristlichen Jahrhunderts nach Rom übertragen. Dort fanden sie bereits eine etruskisch-römische Bädertradition vor. Anders als bei den noch stärker kultbezogenen Griechen hat sich dank des praktischen Verstandes der Römer die therapeutische Heilquellennutzung und die Bädertechnik zu erstaunlicher Höhe entwickelt, so in den künstlich erwärmten „Hypokaustbädern“, d. h. Bädern mit Unterflurbeheizung, wie sie SERGIUS ORATA um 100 v. Chr. eingeführt und der bedeutende Badearzt ASKLEPIADES von Prusa (1. Jh. v. Chr.) der Balneotherapie zugänglich gemacht hat. Der Besuch eines Heilbades wurde von römischen Ärzten bei chronischen, vor allem rheumatischen Erkrankungen und Lähmungen verordnet. Mineralquellen wurden nach PLINIUS zum Baden und Trinken, der Mineralschlamm unter Ausnutzung thermischer Effekte zu Packungen verwandt.
Die Anlage öffentlicher Bäder (Thermen), die gleichzeitig medizinischen Zwecken dienten, führte zu Leistungen der römischen Architektur (VITRUVIUS, 1. Jh.) von bewundernswerter Größe und Einheitlichkeit des Konzepts, aber auch zur Entwicklung eines kostspieligen Badeluxus. Neben raffinierten technischen Anlagen schmückten Marmor und Edelmetalle in verschwenderischer Pracht die großräumigen Hallen. Die Ruinen der Thermen der Kaiserzeit von Rom bis Trier und bis Paris geben noch heute einen Eindruck vom Ausmaß dieser Anlagen, aber auch von ihrer Ausbreitung in den weiten Grenzen des damaligen römischen Reiches. Im keltischen und im germanischen Bereich vorgefundene Badeanlagen wie Aachen, Baden/ Schweiz, Baden-Baden, Badenweiler, Bertrich und viele andere mehr sind von den Römern nach ihrer Vorstellung ausgebaut und für die Truppen, aber auch zivil genutzt worden.
Nach der reichen Entfaltung des römischen Bäderwesens (die Stadt Rom allein zählte an die 900 Thermen zur Zeit CONSTANTINs) kam es mit dem politischen Niedergang auch zum Niedergang der medizinischen und der Bäderkultur. Die Wirren der Barbarenzüge hatten den Aufbauwillen gebrochen, sie ließen die Bäderanlagen zerstört zurück. Das kostbare Material fand im Kirchenbau eine andere Verwendung. Nur gelegentlich blieb ein Teil der Bäder in vereinfachter Form funktionell bestehen. Auch dort, wo keine Zerstörung stattgefunden hatte, verfielen die Anlagen. Die von den Kolonisatoren gehegten Sauerbrunnen und warmen Quellen wurden bis auf wenige vergessen (J. Steudel). Eine Ausnahme ist die Wiederherstellung der Thermen von Abano während der Regierungszeit von THEODERICH durch CASSIODOR (455-526) und von Aachen durch Kaiser KARL d. Gr. (742-814).
2. Das Bäderwesen in Mittelalter und Neuzeit
Den Perioden des Niedergangs folgen solche der Wiedererweckung oft unter veränderten Aspekten. Das trifft sowohl das Bäderwesen insgesamt, wie einzelne Bader oder Quellen, die dank einer Modeströmung „wie Leibröcke und Damenhüte“ (L. Spengler 1854) eine Zeitlang in Gunst sind und wieder vergessen werden, was bei einer hinreichenden wissenschaftlichen Begründung ihres Nutzens wohl nicht der Fall gewesen wäre. Doch die konnte erst nach langdauernden und mühsamen Erkenntnisschritten eine moderne naturwissenschaftliche Medizin erbringen.
Das oft so genannte finstere Mittelalter war, auch wenn das römisch-antike Badewesen nahezu aus dem Bewußtsein geschwunden war, keineswegs eine Epoche balneologischer Nichtexistenz. Im Norden blieb der aus heidnisch-germanischem Brauchtum überkommene Quellenkult, der „hillige Born“ lebendig (Buschan), ebenso das Mai- und Johannisbad, wohl der volkspsychologische Ausgangspunkt noch später beliebter Frühlingskuren. Das griechische medizinische Wissen wurde von arabischen Ärzten bewahrt, übersetzt und erläutert. So gab beispielsweise RHAZES (865-925) nach griechischem Muster für Schwefel-, Alaun-, Kupfer- und Eisenwässer genau festgelegte Heilungsanzeigen an. In lateinischer Gestalt (etwa ab dem 11. Jh.) trat dies Wissen in das ärztliche Bewußtsein des Abendlandes. Die antike Badetradition wurde unter Beibehaltung des Grundschemas römischer Thermen (Benedum) im islamischen Einflußbereich weiter gepflegt.
Der Hohenstaufenkaiser FRIEDRICH II (1194 bis 1250), der die warmen Quellen von Puteoli aufgesucht hatte, welche auch im Mittelalter ihren Ruf zur Heilung von Gelenkleiden bewahrt hatten, interessierte sich für den Ursprung der Mineralquellen und stellte dem am sizilianischen Hofe lebenden Gelehrten MICHAEL SCOTUS (gest. um 1235) die Frage: ,,Wir möchten wissen, wie die salzigen und die bitteren Wässer entstehen, die an manchen Orten hervorbrechen, und die übelriechenden Wässer, wie man sie an vielen Plätzen mit Bädern und Piszinen findet, ob sie aus sich selbst entstehen oder anderswoher (Steudel), ARNALDO DE VILLANOVA (um 1235-1313), Professor in Montpellier und unter anderem Verfasser eines Kommentars zu den berühmten „Gesundheitsregeln“ von Salerno interessierte sich für die Mineralquellen und versuchte, sie nach ihren Eigenschaften einzuteilen. Wenn trotz dieses partiellen Interesses die physikalischen und chemischen Faktoren einer „Naturmedizin“, wie sie Quellen und Bäder boten, im Hochmittelalter weitgehend vernachlässigt wurden, so lag dies an dem Übergewicht der von den Arabern hochentwickelten Arzneimittelkunde, die auch die Einführung eines neuen Berufs, den des Apothekers, notwendig gemacht hatte. Immerhin erschienen an der Schwelle des 15. Jhs. die „Regeln für den Quellengebrauch“ („Canones“) des oberitalienischen Arztes PIETRO DATOSSIGNANO, die viele spätere Bäderschriften beeinflußt haben. Im gleichen Zeitraum kamen in Italien, aber auch nördlich der Alpen {Aachen, Plombieres) Quellen und Wildbäder zunehmend in Gebrauch.
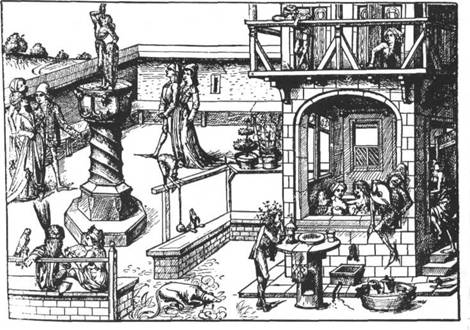
Mineralbad im 15. Jahrhundert — Nach dem Konstanzer mittelalterlichen Hausbuch
Die jährliche Badefahrt, auch ohne bestimmte medizinische Indikation, gehörte im 15. Jh. bald zum Selbstverständnis eines wohlhabend gewordenen Bürgertums. Die hier wiedergegebene Abbildung läßt einen Blick in das gesellige Treiben eines damaligen Mineralbades tun, wie es in anschaulicher Weise von Gian-Francesco POGGIO (1380-1459) geschildert wurde, der 1417 als Begleiter (und Sekretär) des Papstes JOHANNES XXIII. auf das Konzil in Konstanz die Quellen zu Baden im Aargau {kalkreiche Schwefelthermen) aufgesucht hatte, aber mehr Vergnügung als Heilung Suchende antrat. In oft engen Piszinen badeten Männer und Frauen fast nackt zusammen, die Badezeiten wurden bei Musik und Spiel überlange ausgedehnt, oft auch im Wasser Wein und Mahlzeiten eingenommen, wie zeitgenössiche Darstellungen hinlänglich belegen.

Oben: Badstube im16. Jahrhundert Links: Bad- und Tafelfreuden im Spätmittelalter. Rechts: Spätmittelalterliche Badstube.
In quellenärmeren Gegenden und Städten hatte die Badstube medizinisch und gesellschaftlich die Funktion der Badefahrt erfüllt (Abb.), bevor diese sich in breiteren Kreisen durchzusetzen begann. In Deutschland knüpfte die Badestube an die frühmittelalterliche Tradition der Wannen-Kräuter- und Schwitzbäder an. Sie hielt sich bis weit in das 16. Jh. (Abb.). Ein konzessionierter Bader massierte, salbte, setzte Schröpfköpfe oder ließ zur Ader, um so nach dem Verständnis der alten, Säftelehre“ überschüssige und schädliche Stoffe aus dem Körper zu entfernen (Abb.)

Kombinierte Bad- und Mineraltrinkkur nach ärztlicher Vorschrift – Holzschnitt von Urs Graf, Zürich 1509.
Im 16. Jh. erreichte das Bäderwesen mit vielen angesehenen Kurorten eine neue Blüte. Mineraltrink- und Badekuren wurden gewöhnlich miteinander verbunden. Eine Kur sollte in der Regel 3 Wochen in Anspruch nehmen, wovon mindestens 100 Stunden im Mineralwasser zu verbringen seien (Steudel). Damals waren die Quellen wegen ihrer schlechteren Quellfassung noch unwirksamer (Amelung). Die später kritisierten langen Badezeiten erscheinen heute in manchen Fallen sogar sinnvoll (Untersuchungen aus dem Institut für angewandte Physiologie der Freien Universität Berlin), nämlich dort, wo durch den anhaltenden Druck des Wassers auf dem Reflexwege eine Ausschwemmung des Körpers erfolgen soll. Doch wegen des falschen Gebrauchs hinsichtlich Zeit, Menge und Indikation wurde der Hinweis auf die strikte Befolgung ärztlicher Anweisungen immer notwendiger. (Lorenz FRIES, Straßburg 1519). So ist auch das Blatt (Abb.) des Baseler Grafikers Urs GRAF (um 1485-1527) zu verstehen.
Es gab noch keine eigentlichen Badeärzte zu dieser Zeit. Wer es sich leisten konnte, „hohe Herren und reiche Kaufleute“, reisten in Begleitung ihrer Hausärzte. Bald stand auch eine reiche medizinische Literatur zur Verfügung, an der Spitze das eindrucksvolle Sammmelwerk (Venedig 1553) des Zürcher Arztes und Humanisten Conrad GESSNER (1516-1565). Auch der heute vielleicht bekannteste Arzt des 16. Jh. PARACELSUS (1493-1541) hat sich, seinem Grundsatz „experientia ac ratio“ (Erfahrung und objektive Prüfung des Beobachteten) folgend, um balneologische Erkenntnisse bemüht (1535). Nach der These „alle Artzney ist in der Erden“ führt er, ohne allerdings darin über das Wissen seiner Zeit hinauszugelangen, die verschiedenen wirksamem Prinzipien auf. Erwähnenswert erscheint indessen seine ärztliche Feststellung, „daß zum guten Gelingen einer Kur eine bekömmliche Diät und entsprechende Lebensweise gehören“; auch sollte je nach Art und Alter der Krankheit eine zusätzliche „medikamentöse und physikalische Behandlung die natürlichen Heilmittel ergänzen“. Das „Weltbad“ Pyrmont wurde 1556 von über 10000 Heilungssuchenden aufgesucht, die z. T. im Freien unter Zelten ihre Behandlung fanden. Das beweist, daß die Bäder wie in römischer Zeit nahezu von der ganzen Breite sozialer Schichten in Anspruch genommen wurden.
Im 16. Jh. finden sich auch wirksame Ansätze einer chemischen Analyse der Heilquellen (DRYANDER, FALLOPPIO, VAN HELMONT). Einen entscheidenden Fortschritt leistete aber erst in den achtziger Jahren des 17. Jh. der englische Chemiker Robert BOYLE (1627-1691) und sein jüngerer schwedischer Zeitgenosse Urban HJÄRNE (1641 bis 1724). Bis dahin hatte sich aber das Bäderwesen völlig gewandelt. Mit der Verbreitung von Seuchen (Syphilis, Pest), politischen Wirren, Zerstörungen in Kriegszügen, allgemeiner Verarmung, auch dem Mangel an Heizmaterial kam es zu einem Erliegen des Badebetriebes in Badstuben und Kurorten. Den entscheidenden Einschnitt setzte der 30jährige Krieg. Als man sich nach dem Westfälischen Frieden erneut auf die Mineralbrunnen besann, wurden Badebecken und Wannen verlassen. An ihre Stelle trat, nahezu ausschließlich, die Trinkkur. „Die Bäder wurden zu Stätten einer vornehmen Geselligkeit, die sich neue Formen schuf und einen größeren architektonischen Rahmen verlangte, an die Stelle der Gemeinschaftspiszinen traten freie Plätze, gedeckte Bogengänge, schattige Alleen, die einer eleganten Welt erlaubten, sich zu sehen und gesehen zu werden“ (Steudel). 1681, im Jahr der ersten Quellentdeckung in Bramstedt, waren „nicht weniger als 40 fürstliche Personen mit großem Gefolge gleichzeitig in Pyrmont anwesend“ (Amelung), um hier den als Wunderheilmittel geltenden Sauerbrunnen zu trinken. Die neue Trinkkur stützte sich auf die theoretische Vorstellung (DE LE BOE SYLVIUS, 1614 bis 1672), daß alle Lebensvorgänge als eine Kette chemischer Reaktionen aufzufassen seien, in die die Inhaltstoffe der Mineralquellen bei Störungen ersatzleistend, vorbeugend, regulierend eingreifen können.
Die im Barock geschaffene neue Form, bei der die Brunnenpromenade durch den Schweizer Arzt und Freund VOLTAIRE’s Theodore TRONCHIN (1709 bis 1781) einen bewegungstherapeutischen Sinn erhielt (das „Tronchinieren“, Umherwandeln), setzte sich über das 18. in das 19. Jahrhundert fort. Der hannoversche Leibarzt Johann Georg ZIMMERMANN (1728 bis 1795), aber auch GOETHE schildern unter vielen anderen ihre Erlebnisse als Badegäste in dieser Zeit, in der Pyrmont, Karlsbad, Marienbad zu beliebten Modebädern geworden waren, nachdem schon im 17. Jh. Madame DE MONTESPAN, die Favoritin LUDWIGs XIV. Bourbonl’Archambault zu weitreichendem Ruf verhalf. Daher wundert es nicht, daß im 18. Jh. in Frankreich die Verpflichtung zur jährlichen Badekur sogar in den Ehevertrag aufgenommen wurde.
Es ist das besondere Verdienst von Franciscus BLONDEL (1613-1703), der als Badearzt von Spaa nach Aachen übergesiedelt war, daß er neben dem Ausbau der Trinkkur seine Aufmerksamkeit den technischen Verbesserungen des darniederliegenden Badebetriebes widmete und das Thermalbad wirksam mit neuer Indikation, vor allem gezielt zur Behandlung rheumatischer Erkrankungen einsetzte (V. Ott). Nicht zuletzt durch BLONDELs Initiative gewann der äußere Brunnengebrauch allmählich wieder seinen Platz. Wie GOETHE das Bad beurteilte, verrät eine Briefstelle aus Karlsbad an ZELTER vom 22. Juli 1816: „Ich sehne mich unsäglich ins Wasser und zwar diesmal in Schwefelwasser, denn weder Gelenke noch Haut wollen mehr dem Willen gehorchen und spielen ihr eigenes unbequemes Spiel“. Mit der systematischen Einrichtung der Solbäder (ab 1803) wurde die Trinkkur von ihrer bis dahin vorherrschenden Stellung wieder verdrängt.
Schließlich hat das späte 19. Jh., an dessen Beginn der Bäderimpuls von Christoph Wilhelm HUFELAND (1762-1836) steht, Bäderschriften: (1801, 1815), einer bis dahin herrschenden Erfahrungsheilkunde die objektivierbaren Grundlagen einer modernen naturwissenschaftlichen Medizin geliefert. Aus der riesigen Datenfülle der Grundlagenforschung, die hier nicht aufgeführt werden kann, sei nur an die für das Verständnis der Mineralwasserwirkung {Spurenstoffe) wichtige Entdeckung der elektrolytischen Dissoziation („the importance of being ionized“, wie ein moderner Physiologe im Anklang an Oscar WILDE scherzte) und die Bestimmung des Dissoziationsgrades aus der elektrischen Leitfähigkeit durch Svante ARRHENIUS (1859 bis 1927) erinnert (siehe die Ionen-Angaben aller neuzeitlichen Quellenanalysen). Im 20. Jh. ist vollends an die Stelle einer hauptsächlich empirischen Balneologie die Physikalische Medizin mit einem der wichtigsten Auswirkungsgebiete, die Rheumatologie, getreten.
Daß in dieser überaus erfolgreichen Zeit beherrschender Naturwissenschaftlichkeit die alte Diätetik, die HUFELAND noch überzeugend vertrat, häufig zu kurz gekommen ist, soll nicht verschwiegen werden. In den letzten 200 Jahren sind auch „Wandlungen im Verhältnis vom Kurpatienten zum Kurort“ eingetreten, die der Internist Fritz HARTMANN (1978) in vier charakteristische Punkte zusammengefaßt hat:
1. Die Wandlung von der Kur zur Krankenbehandlung.
2. Der Rollenwechsel vom Kurgast zum Kurpatienten.
3. Die Industrialisierung der Kurorte mit der zugehörigen Vermarktung der den Reichtum des Kurortes begründenden natürlichen Heilmittel.
4. Die Öffnung der Kurmöglichkeiten für alle Bevölkerungsschichten seit der Einführung der Sozialversicherung mit entscheidenden Einflüssen der Versicherungsträger auf den „Kur-Betrieb“.
„Kurwesen und Kurorte haben also an allen gesellschafts- und gesundheitspolitischen Entwicklungen teilgenommen.“ Nach HARTMANN sollte ein Weg beschritten werden, der auch den neuen Kurpatienten wieder zum Kurgast macht. Dazu hilft die alte, immer noch lebendige „Denkfigur: Rekreation – Repräsentation – Kommunikation“. Wie weit hier eine ärztlich-erzieherische Aufgabe der Gesundheitsbildung vorliegt, diese Frage wird sich der Kurarzt zwangsläufig stellen. Eine Antwort darauf geben schon die klugen Überlegungen von Hans Erhard BOCK im 1. Band der „Zeitschrift für physikalische Medizin“ (1970).
3. Das Musterbeispiel Bad Bramstedt
In der langen mehrtausendjährigen Geschichte des Bäderwesens ist die Entdeckung der Mineralquellen von Bramstedt verhältnismäßig jung. Andererseits ist die Zeitspanne von dreihundert Jahren, die sich 1981 vollendet hat, gemessen an der individuellen Erfahrung, eine durchaus ehrwürdige Zeit. Sie gewinnt besonderes Interesse, wenn man bedenkt, daß sie bedeutsamste Epochen der deutschen Kulturgeschichte einschließt, auf eine lange Zeit deutsch-dänischer Geschichte zurückblickt, denn Schleswig-Holstein war seit dem ausgehenden Mittelalter der dänischen Krone verbunden (Gedenkjahr an CHRISTIAN I., 1426-1481). Frühe Entscheidungen über Bramstedts Quellen im 18. und 19. Jh. unterlagen nominell der dänischen Verwaltung mit ihren höchsten Adressaten in Kopenhagen.
Bramstedt hat darüber hinaus den Vorzug, daß die fähigsten Gelehrten des Landes seine Quellen begutachteten. Gelehrte von solch medizingeschichtlichem Rang wie sie kaum ein älteres Heilbad in Deutschland aufzuweisen hat und die dadurch noch an Gewicht gewinnen, als ihre Arbeit bereits die exakt-naturwissenschaftliche Denkweise des späteren 19. Jh. vorausahnen läßt. Paradigma aber, ein Musterbeispiel ist Bad Bramstedt in der Folgerichtigkeit seiner Entwicklung, die zu seiner Weltgeltung als Rheumaheilbad geführt hat. Unabhängig von der Beachtung seiner Quellen in der Publikumsgunst ist es aufgrund seiner naturgegebenen Möglichkeiten einen zielgerichteten Weg gegangen, der von manchen anderen Heilbädern auf den ihnen qualitativ entsprechenden Sektoren erst noch vollzogen werden müßte.
Der Chronist von Bramstedt, Hans Hinrich HARBECK (1863-1950) gliedert in seiner Chronik (posthum 1959) die Geschichte des Kurortes Bramstedt – die amtliche Bezeichnung „Bad Bramstedt“ gibt es seit 1910 – in vier Abschnitte: drei Perioden sporadischen Aufblühens, „stoßweise und eigenwillig“ (1681, 1761, 1810) und die der „stetigen Entwicklung“ ab 1879.
1681 wird der „Gesundbrunnen“ in der Feldmark östlich des Ortes von einem Schweinehüter, der seinen Fieberdurst zu stillen suchte, zufällig entdeckt. Die Kunde seiner Heilung veranlaßt andere Fiebernde und chronisch Erkrankte, von dieser Quelle zu trinken, mit gleichem Erfolg. Der Zuspruch läßt sich aus den Geldern ermessen, die in dieser Zeit der Kirche durch Sammlung für die Armen zugeflossen sind, Ein Weihgeschenk nach erfolgter Heilung sind die Altarleuchter von Larenz JESSEN (1681) in der Bramstedter Kirche. Wenige Jahre später hatte die Quelle ihre „Anziehungskraft“ verloren.
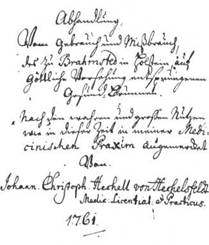
Titel der „Abhandlung vom Gebrauch und Mißbrauch des zu Brahmstedt in Holstein auf göttliche Vorsehung entsprungenen Gesundbrunnen“ 1761
1761 „hat man aufs neue angefangen, eine große Hoffnung zu diesem Brunnen zu fassen“ heißt es in dem Bericht des Segeberger Amtmanns von ARNOLD (15. Mai), der den Wunsch ausdrückt, den nutzbringenden Brunnen vor erneutem Verfall zu bewahren. Voraussetzung wäre natürlich eine genaue Kenntnis seiner Eigenschaften und seiner Anwendung. Die Benutzerzahl ist so groß, daß am 1. Juni eine vorläufige „Brunnenordnung“ erlassen und im Wortlaut seiner Königlichen Majestät in Kopenhagen mitgeteilt wird. In Bramstedt, dessen Ruf als Heilquellenort in die weitere Umgebung gedrungen ist, gibt es keinen Badearzt (..Brunnen-Medicus“). Daher bewirbt sich der Hamburger „Licentiat“ und „Practicus“ der Medizin Johann Christoph HECHEL von HECHELSFELDT mit einer zierlichen Denkschrift (Abb.) an den König zu „Dennemarc Norvegen“ um eine solche Stelle „unter freyer Wohnung und bestallung“, die aber in der Folge zweifellos nicht besetzt worden ist. Die Empfehlung, Kuren in ihrer Anzeige zu prüfen und ärztlich zu überwachen (wer das Wasser nicht richtig anwendet, hat sich „davon schlechter Hülfe zu getrösten, woll aber Ungelegenheit und Schaden zu befahren“) entspricht durchaus den seit FRIES und PARACELSUS (s. o.) erhobenen Forderungen. Dafür mußten natürlich Zusammensetzung und Eigenschaften des Wassers bekannt sein.

Titelseite des 134. Stücks aus Unzers Wochenschrift „Der Arzt“ 1761
Die Untersuchung „der unweit Bramstedt sich hervorgethanen Quelle“ wird von dem königlichen Ministerium in Kopenhagen anempfohlen. Von dem Staatsminister Exzellenz von BERNSTORFF, der inzwischen in die Korrespondenz eingeschaltet ist, werden bereits am 6. Juni dem Oberpräsidenten von QUALEN als Gutachter die Altonaischen Ärzte STRUENSEE, CILANO und UNZER benannt. Zugleich weist BERNSTORFF auf Vorsichtsmaßregeln hin, um die Eigenschaften des Wassers nicht durch den langen Transportweg nach Altona (45 km) zu gefährden. Wieweit die Bramstedter Quelle in kürzester Zeit Gegenstand der öffentlichen und medizinischen Erörterung geworden ist,beweisen Artikel (127. und 134. Stück) aus UNZERs „Der Arzt“ (Abb.), einer der bemerkenswertesten medizinischen Periodica jener Zeit, Artikel, die bereits eine vorwegnehmende Untersuchung von UNZER enthalten und die am 17. Juli durch von QUALEN an BERNSTORFF übermittelt worden sind. Mit diesen geistvollen Aufsätzen einer geistvollen Zeitschrift, die jeweils durch ein Motto aus den „Bremer Beiträgen“ und von Friedrich von HAGEDORN (1708-1754) eingeleitet werden, jenem Hamburger Nachfolger von HORAZ und LA FONTAINE und Privatsekretär des dänischen Gesandten in London, sind wir mitten im Vorfeld der deutschen Klassik – GOETHE ist fast zwölf, SCHILLER noch nicht zwei Jahre alt. Es ist eine Zeit, die durch LESSING und KLOPSTOCK charakterisiert ist und in der der dänische Staatsminister hannoverscher Abstammung Johann Hartwig Ernst Graf von BERNSTORFF (1712-1772) als Förderer und Anreger von Wissenschaft und Kunst eine kaum zu überschätzende Rolle spielt.

Friedrich V. König von Dänemark
Ein aufgeschlossener, reformfreudiger König, FRIEDRICH V.(Abb./1723-1766), wie FRIEDRICH der Große und LUDWIG XV. ein Vertreter des aufgeklärten Absolutismus, ermöglichte dies Mäzenatentum. Es schloß Persönlichkeiten wie Jean Baptiste CHARDIN, Friedrich Gottlieb KLOPSTOCK, Johann Andreas CRAMER, Christian Johann von BERGER, „den Arzt . . . Freund aller leidenden Menschen“, der später der Universität Kiel sein Vermögen und seine umfangreiche Bibliothek vermachte, und Carsten NIEBUHR, den Orientreisenden ein, aber auch „wichtige Untersuchungen auswärtiger Gelehrter“, „denn die Sache der Wissenschaft ist ein allgemeines (Anliegen) der Menschlichkeit“. Der geniale Peter Helferich STURZ (1736-1779), von dem diese Aufzählung stammt, schildert in seinen „Erinnerungen“ BERNSTORFF als Staatsmann, „der mit tiefer Menschenkenntnis den Lieblingsberuf verband, einemunter seiner Leitung allzuglücklichen Lande nützliche Bürger zu verschaffen . . .“ Er „lebte“ in Bernstorffs Hause mit Klopstock die seligsten Tage seines Lebens.
KLOPSTOCK, der auf Einladung FRIEDRICHS V. in Kopenhagen seinen „Messias“ vollenden sollte, hat BERNSTORFF dankbar die prachtvolle Ausgabe seiner „Oden“ gewidmet, in denen die „Wingolf“-Lieder (1767), aber auch viele andere Stellen das Naturerlebnis von Quelle und Hain mit einer bis dahin ungewohnten Ausdrucksstärke schildern. Dort „in den Kühlungen des hohen Ahorns, und in der Grotte Bach“, dort wo es „im Haine weht“, wird „die geistervolle silberne Flut geschöpft“, „schon glänzt die Trunkenheit des Quells dir … aus hellem, entzücktem Auge“. Gesundbrunnen des Körpers und „Mimer“, Quell der Dichtkunst und Weisheit scheinen zusammenzufließen.

Johann August Unzer.
Der bedeutende Arzt und wissenschaftliche Schriftsteller Johann August UNZER (Abb./1727 bis 1799), dem GOETHEin „Dichtung und Wahrheit“ anerkennend ein Denkmal gesetzt hat, tritt in seiner Wochenschrift „Der Arzt“ (1761) mit der wohlwollenden Skepsis des Aufklärers der naiven Volksmeinung entgegen, die allzu blind Wunderheilungen vertraut, doch will er nicht entmutigen: „Inzwischen“ (bis genaue Daten vorliegen) „wider rathe ich keinem die Reise, wer nur mit großen Hoffnungen eine Wassercur versuchen oder eine Lustreise thun oder auch nur einen ROLAND sehen will“. Im 134. Stück bestätigt er aber, daß das Bramstedter Wasser „wirklich mineralisch sey“, und „so geringhaltig esauch immer seyn mag, so haben wir doch in unseren Gegenden für erst keinen stärkeren Gesundbrunnen und es ist für tausend Kranke ein ausnehmender Vortheil, eine solche Quelle in der Nachbarschaft zu besitzen.“
Das angeforderte „amtliche“ Gutachten vereinigt UNZER, DE CILANO und STRUENSEE, ein wissenschaftliches Dreigestirn erster Ordnung. Georg Christian Matemus DE CILANO (Abb./1696-1773) gebürtig aus Preßburg, Arzt in Altona, seit 1738 königlich dänischer Professor der Physik (Naturwissenschaften) und der klassischen Altertumskunde – solche Verbindung war damals durchaus möglich – hat ein reiches wissenschaftliches Werk verfaßt, zu Fragen der Medizin und der Naturwissenschaft <z. B. dem Alterstod) kritisch Stellung genommen, sich über die Ursache des Nordlichts Gedanken gemacht (1743) und sich mit der Quellenkunde und Wasserversorgung in der Antike beschäftigt.

li.: Georg Christian Maternus de Cilano re.: Johann Friedrich Graf Struensee als Minister.
Eigentlich federführend und bestimmend, wobei UNZERS chemische Voruntersuchungen eine wichtige Rolle spielten, war Johann Friedrich STRUENSEE (Abb./1737-1772). Gleich der erste Satz des Berichtes „Nur Versuche an der Quelle konnten zum Ziele führen“ verrät STRUENSEEs Diktion. Seine überragenden medizinisch-wissenschaftlichen Qualitäten und sein Weitblick in der Organisation desGesundheitswesens sind von dem dänischen Medizinhistoriker Egill SNORRASON (J. Fr. Struensee, Laege og Geheimestatsminister, Kobenhavn 1968) monographisch dargestellt. STRUENSEEs kometenhafter Aufstieg am Himmel der dänischen Politik, wo er 1770 als Staatsminister den Grafen BERNSTORFF verdrängt, seine als Arzt des kranken CHRISTIAN VII. (1749-1808, in Rendsburg gestorben) nahezu unbegrenzte Macht, seine schicksalhafte Verstrickung mit der unglücklichen dänischen Königin CAROLINE MATHILDE (1751-1775), sein grausames Ende, all das wurde Anlaß zu zahlreichen Romanen und Bühnenstücken, darunter auch ein Entwurf des aus Wesselburen stammenden Friedrich HEBBEL (1813 bis 1863). Solch ein Aufstieg und Ende hat damals ganz Europa bewegt und, wie auch LESSINGs Korrespondenz beweist, vor dem Fall des Glücks erschauern lassen. STRUENSEE war gescheitert, weil er, der überzeugte Anhänger der französischen Aufklärungsphilosophie („Um Gespenster zu verscheuchen, muß man Licht anzünden“, Gedanken eines Arztes vom Aberglaubenund der Quacksalberey 1760), seine weitgespannten Reformen in einer dafür unvorbereiteten und in ihren Spitzen brüskierten Gesellschaft über das Knie brechen wollte. Das Schicksal fügte es, daß sie dann später unter seinen Nachfolgern Stück für Stück verwirklicht wurden.
Das Ergebnis des Dreiergutachtens (1761) war eine qualitative Aufnahme der Bestandteile des Bramstedter Brunnens, der in manchen seiner Eigenschaften dem Pyrmonter und Schwalbacher Wasser vergleichbar schien. Wegen der Transportverluste bei geringem Mineralgehalt soll er „bloß an der Quelle getrunken werden“. Die Verhinderung des Zuflusses von Fremdwasser würde die Wirkung, die sich medizinisch noch nicht eindeutig bestimmen läßt, verstärken können.

Philipp Gabriel Hensler.
Von anderen Quellenuntersuchungen (deren SÜERSEN noch eine ganze Anzahl vermerkt) ist die aus dem Jahre 1764 von dem damaligen Amtsphysicus zu Segeberg und späterem Kieler Professor der Medizin und Begründer des „Schleswig-Holsteinischen Sanitäts-Collegiums“ Philipp Gabriel HENSLER (Abb./1733-1805) erwähnenswert. HENSLER ist in Oldensworth auf der Halbinsel Eiderstedt geboren, also ein Sohn des Landes. 1775 zum dänischen Archiater (oberster Arzt) ernannt, begründet er mit einem umfangreichen, auch heute noch faszinierenden wissenschaftlichen Werk, in dem er sich u.a. für Diätetik und Lebensordnung (Luft, Wärme, Kälte, äußere und innere Bewegung, Geistesanstrengungen als Genesungsmittel) einsetzt, den Ruhm der Kieler Universität im ausgehenden 18. Jh. Sein (erst 1789 veröffentlichter) Bericht über Bramstedt erwähnt sechs, nach Ausschöpfung des Brunnens unterscheidbare Quellen, von denen er vier analysiert hat mit dem Nachweis von Schwefel, Eisen und Kochsalz. Nach HENSLERs Urteil ist das Wasser „nutzbar“. ,,Es scheint mit Kräften versehen zu seyn, die vermutlich einen Teil der Indicationen ein Genüge thun können, um deren Willen wir andere mineralische und leichte Wässer schätzen.“ „Die bisherigen Proben von Heilungen sind . . . zum Theil unleugbar wahr“. Um die Kräfte zu bestätigen und dauerhaft zu erhöhen, sind Mühe, Kosten und „ein bisgen Enthusiasmus“ nötig. Sie müßten sich „zum Vortheil des Brunnens vereinigen“.
Aus HENSLERs Bericht wird einsichtig, warum den Quellen eine Dauerwirkung versagt blieb. Es fehlten, von der Quellfassung abgesehen, die örtlichen Einrichtungen, die eine Trink- oder Badekur zu einem wiederholbaren Erfolg machen konnten und über die ältere, etablierte Heilbäder bereits verfügten. Einen Ansatz dazu hätte es vielleicht in den kommenden zehn oder fünfzehn Jahren nach dem Dreiergutachten (1761) gegeben, aber BERNSTORFFs Entlassung und STRUENSEEs baldiger Sturz ließen für solche Hoffnung keinen Raum.

Titel des Buches von J.F. Süersen über die Mineralquellen bei Bramstedt
1810, rund zwanzig Jahre nach HENSLERs Veröffentlichung wollen die Einwohner von Bramstedt selbst die Initiative ergreifen, um die „nöthigen Einrichtungen für die Bequemlichkeit der Kranken zu treffen“. König FRIEDRICH VI. (1768-1839), damals Verbündeter NAPOLEONS und, wie FRIEDRICH V. ein Förderer von Kunst, Wissenschaft, Handel und Agrikultur, erteilt das gewünschte Privilegium, in Bramstedt ein Brunnengebäude anzulegen. Wieder ist ein BERNSTORFF, diesmal der Großneffe Christian Günther (1769-1835) dänischer Staatsminister; sein Vater Peter Andreas (1735 bis 1797), ebenfalls Minister in Kopenhagen, hatte das Bauernbefreiungswerk vollendet und den jungen SCHILLER unterstützt.
Das Jahr 1810 sieht gleich zwei wichtige, voneinander unabhängige Veröffentlichungen über die Bramstedter Quellen in Buchform. Es sind dieersten quantitativen Analysen.
Johann Friedrich SÜERSEN (1771-1845), später Dozent für „Mineralogie und Pharmazie“ an der Universität Kiel, hat das Verdienst in seiner Darstellung alles über die Bramstedter Heilquellen Bekannte mit historischer Genauigkeit zusammengetragen zu haben. Er fügtseinem Buch (Abb.) eine Situationskarte bei (Abb.), aus der die Existenz mehrerer Mineralquellen hervorgeht. Neben dem alten, sogenannten „Schwefelbrunnen“ (Eisenoxydquelle) sind es Eisenquellen (vormals „Stahlquellen“ genannt) und eisenhaltige Salinen. SÜERSEN selbst verwendet den Ausdruck Eisenquellen in seinem Text und gibt eine ausführliche Beschreibung nach eigenen, im Auftrag des Schleswig-Holsteinischen Sanitäts-Collegiums durchgeführten Untersuchungen. Die Analysen in den Handbüchern der Heilquellenlehre von OSANN (1832) und VETTER (1845) beziehen sich auf ihn und auf die Analysen von PFAFF.

Situationskarte der Mineralquellen von Bramstedt (1810) nach einer Aufnahme von Jargstorff-Kellinghusen gezeichnet von Pastor Holst in Kiel.
Christoph Heinrich PFAFF (Abb./1773-1852), seit 1797 Professor an der Kieler Universität, einer der bahnbrechenden medizinischen Forscher des frühen 19. Jhs., hat in seinem überaus kritischen Buch (Abb.) die Bramstedter Quellen ebenfalls einer sorgfältigen Analyse unterzogen.

Christoph Heinrich Pfaff – königlich däni- scher Etatsrath und Professor der Medizin.
Er erkennt den Wert des schwach wirkenden Mineralwassers für bestimmte Konstitutionen und sieht darin einen Vorzug vor dem Pyrmonter und Driburger Bad. Nach Dr. GRAUER in Kellinghusen ist die Quelle mit überwiegendem Eisengehalt bei Lähmungen und Gelenkleiden wirksam. Heute würde man mit Heinrich VOGT bei Eisenwässern eher an eine allgemein erholungsfördernde Wirkung denken. Interessant ist schließlich der Vergleich der Salinen mit demMeerwasser, die quantitative Entsprechung der ältesten Bramstedter Quelle und der Kissinger Quelle, der Eisenquellen mit Rehburg und Bath in England. Einen ganz wesentlichen Anteil der Kurwirkung machen nach PFAFF veränderte Diät, Lebensart, veränderte Luft und Umgebung, sowie der Temperaturreiz von Bädernaus, so daß in seiner Darstellung für den alten Glauben an den Heileffekt der Mineraltrinkkur (die Flüssigkeit alleinkann schon ein ausreichender Reiz sein) nur noch wenig Raum bleibt.

Titel der Abhandlung von C. H. Pfaff über die Mineralquellen bei Bramstedt, Altona 1810.
Bereits 1814 werden neben Trinkkuren in Bramstedt auch Badekuren verordnet (Harbeck). Eine Vorstellung über die Anwendung der Kurmittel liefert die für uns Heutige amüsante kleine Schrift von Dr. Franz HAGELSTEIN „Entwurf einesallgemeinen Badereglements beimGebrauche der Oldesloer salz- und schwefelhaltigen Salzbäder“, Kiel 1813.
Der für Bramstedts Entwicklung als Heilbad entscheidende Schritt erfolgt 1879 – inzwischen istSchleswig-Holstein nach turbulenten Ereignissen und Kriegswirren preußische Provinz geworden – als Dank der Initiative eines Bramstedter Bürgers, Matthias HEESCH, ein Solbrunnen höherer Salzkonzentration erbohrt, ein Badehaus errichtet und erstmals warme Solbäder angeboten werden. Der frühzeitig sich ankündigende Rheumatismus ist bekanntlich ein ausgezeichnetes Behandlungsobjekt für Wärmetherapie, Solbäder, Kochsalzbäder und milde Schwefelthermen. Dauerhafte Erfolge bleiben nicht aus. Der Bau des Matthias-Bades (so benannt nach HEESCH), bald erweiterter Kuranlagen, eines zweiten Solbades (1911) zieht eine wachsende Zahl von Kurgästen nach Bad Bramstedt. 1913 wird bei Bimöhlen eine weitere Quelle erbohrt, die eine Zeitlang sogar als „Versandbrunnen“ (z. B. für Eppendorf) genutzt wird.
Die in Bramstedt vorhandene glückliche Verbindung von Moor und Sole (Moorsole und Mineralmoor) läßt, unmittelbar nach dem ersten Weltkrieg, dem Moor erhöhte Aufmerksamkeit zuteil werden. Die Moorbildung ist ein komplizierter Vorgang, für dessen Ablauf in der Natur 10000 bis 15000 Jahre erforderlich sind bei einemjährlichen Wachstum von nur etwa einem Millimeter. Das Moorschlammbad ist ein ideales Mittel, Wärme festzuhalten. Es ermöglicht die Anwendung hoher Wärmegrade bei sehr schonender Übertragung. Im Moorbewegungsbad unterschiedlicher Zähigkeit spielen die Reibungswiderstände, die eine erhöhte Arbeitsleistung erfordern, eine wichtigephysikalische und damit auch biologische Rolle. Schließlich hat das Moorbad auch chemische Eigenschaften durch seine natürlichen (oder zugesetzten) Mineralien und durch seine Extraktivstoffe. Die tiefgreifenden Wirkungen des Moorbades machen es zu einem idealen Behandlungsmittel für denRheumakranken. Der Nachweis der Radioaktivität derBramstedter Moorsole erweckt zusätzliches Interesse, da durch Radon eine schmerzlindernde, aber auch eine zellanregende, „verjüngende“ Wirkung zu erwarten ist, die sich zu den kreislaufwirksamen und hautkosmetischen Effekten des Moorbades addiert.
Mit der Ausnutzung des Moores wurde in Bramstedt der konsequente Weg zum großräumigen Rheumaheilbad beschritten, also zur Behandlung einer Krankheitsgruppe von größter sozialhygienischer Bedeutung. 1925 ist die Zusammenarbeit mit den Sozialversicherungen gesichert, 1926 die Aufnahme in den Bäderverband erfolgt. Es ist dies das Jahr, in dem eine in ihren Ausmaßen und ihrem Inhalt einzigartige Ausstellung der Gesundheitspflege, sozialen Fürsorge und Leibesübungen, der „Gesolei“ in Düsseldorf, nur acht Jahre nach einem verlorenen Krieg, das Auge der Weltöffentlichkeit auf das vordringliche Problem körperlicher und seelischer Gesundheit lenkt.
Dank einer großzügigen Geländestiftung der Stadt wird 1929-1930 das ebenso großzügige und ästhetisch fesselnde Bauprojekt (Karl FEINDT) der Rheumaheilstätte verwirklicht. Durchblättert man die 10. Auflage (1938) des damals noch schwergewichtigen „Reichshandbuchs der deutschen Fremdenverkehrsorte“, so springt die Luftaufnahme dieses neuen Kurhauses Bad Bramstedt beinahe vor allen anderen Abbildungen heraus (siehe Abb Seite 27) und läßt den Betrachter auf dieser Seite verweilen. Natürlich hat die Entwicklung hier nicht angehalten, Sanierungs- und Ergänzungsbauten bis 1981 zeigen flächenmäßig wohl mehr als eine Verdoppelungder Gesamtanlage. Sogar die Entdeckung neuer Quellen, die HECHEL von HECHELSFELDT 1761 in seiner Bewerbungsschrift richtig vermutet hatte, hat sich bis 1966, der Entdeckung der Solequelle am Raaberg, fortgesetzt.
Bramstedt liefert so ein am Ziel der Rheumabehandlung und etwaiger Begleiterkrankungen orientiertes Entwicklungsbeispiel, das von der bescheidenen Anwendung des alten Mineralbades im 19. Jh. hinführt zu breit gefächerten therapeutischen Möglichkeiten moderner physikalischer Medizin mit ihren vielfältigen apparativen, manuellen und bewegungstherapeutischen Hilfen. Die jüngste medizinische Vergangenheit hat neue Einsichten in das Wesen der Rheumaerkrankungen und ihrer Ursachen gebracht (Victor Ott). Diese fordern eine hochentwickelte Diagnostik, um Therapiemaßnahmen erfolgreich einsetzen zu können. Sie verlangen aber auch Forschungseinrichtungen, die einen weiteren Erkenntnisfortschritt ermöglichen.
Die moderne „kurörtliche Balneotherapie“, eine Umstimmungs- und Anpassungstherapie, führt in ein umfassenderes therapeutisches, rehabilitatives und gesundheitsbildendes Programm. Die naturgeebenen Möglichkeiten erkannt und sie im Interesse Heilungsuchender verwirklicht zu haben, ist das Verdienst vorausgegangener Generationen, die der „Gesundbrunnen des Nordens“ angeregt hat. Aber, „ein Bad und eine Quelle sind bekanntlich so gut wie die Ärzte, die sie anwenden“ (Hans Erhard Bock). Es ist nur zu wünschen, daß mit dieser erfolgreichen Entwicklung, die heutige universitäre Ausbildung junger Ärzte auch qualitativ Schritt hält. Wenn sich an Bad Bramstedts Naturheilschätzen der alte Spruch des PARACELSUS neu bewährt: „Alle Arztney ist in der Erden“, so bedarf es doch überlegter menschlicher Mitarbeit, um sie voll wirksam zu machen.
Schrifttum (in Auswahl und soweit nicht im Text angeführt).
Allen, C. F.: Geschichte des Königreiches Dänemark, Kiel 1842,
Amelung, W.: Bäder- und Klimaheilkunde im Wandel der Zeiten. Z. angew. Bäder- u. Klimaheilk. 19, 209 – 218 (1972).
Harbeck. H. H.: Chronik von Bramstedt, Hamburg 1959.
Hartmann, F.: Wandlungen im Verhältnis vom Kurpatienten zum Kurort. Z. angew. Bäder- u. Klimaheilk. 25, 1 – 16 (1978).
Krane, K.-W.: Vom Gesundbrunnen zur Rheumaklinik, Bad Bramstedt 1979.
Ott, V.: Balneotherapie der Rheumaerkrankungen im Wandel der Zeiten. Therapiewoche 29, 5994 – 6008 (1979).
Rudolph, G.: 100 Jahre wissenschaftliche Balneologie. Z. angew. Bäder- u. Klimaheilk. 26, 115 – 146 (1979).
Rudolph, G.: Die kulturgeschichtlichen und medizinischen Wurzeln des Bäderwesens. – Festvortrag auf der Fortbildungsveranstaltung
der Bundesärztekammer. Davos 1980 (im Druck).
Schipperges, H.: Geschichte der Christian-Albrechts-Universität Kiel, 1665 – 1965, Bd. 4,1, Kiel 1967.
Steudel, J.: Geschichte der Bäder- u. Klimaheilkunde in Amelung-Evers Handbuch der Bäder- u. Klimaheilkunde, Stuttgart 1962.
Vogt, H.: Einführung in die Balneologie und medizinische Klimatologie. Berlin 1945.
zurück
Dr. med. Gerhard JOSENHANS
Ärztlicher Direktor der Rheumaklinik Bad Bramstedt
Die Entwicklung der Rheumaheilstätte
zur Rheumaklinik 1931 – 1981
Fünfzig Jahre ist es her, daß am 1. Februar 1931 die Rheumaheilstätte Bad Bramstedt für die ersten Kranken geöffnet wurde, die in diesem Hause mit 325 Betten in 171 Krankenzimmern Heilung finden sollten. Der Eröffnung voraus ging ein langer Weg sorgfältiger Planungen.
Von 1931 bis 1981, in einem halben Jahrhundert also, sind mehr als 390 000 Kranke in der Rheumaheilstätte, die seit 1976 offiziell Rheumaklinik heißt, erfolgreich behandelt worden.
Rheumatologie um 1930
Vom Stand der „Reumatologie um 1930″ aus nahm die Bad Bramstedter Rheumaheilstätte ihre Tätigkeit auf. An der Spitze der Betrachtungen über „Rheumatologie um 1930″ soll eine Aussage stehen, die Dr. Anton FISCHER vom Rheuma-Forschungsinstitut Aachen im März 1931 verfaßte: „Unter der Bezeichnung „Rheumatismus“ werden gemeinhin alle diejenigen Erkrankungen des Bewegungsapparates zusammengefaßt, die in das therapeutische Gebiet der inneren Medizin gehören und die nicht als Teilsymptom einer spezifischen Allgemeinerkrankung (Lues, Tuberculose, Neoplasmen) erkannt wurden. Diese Bezeichnung enthält dabei zunächst etwas Negatives: Die unklare Ätiologie.
Da ferner sowohl akute wie chronische Prozesse, sowohl Gelenk- wie Nervenerkrankungen als „rheumatisch“ bezeichnet worden sind, so haftet an dieser Bezeichnung etwas Wechselndes und Unbestimmtes, was bei einem Teil der so bezeichneten Prozesse bei oberflächlicher Betrachtung auch zutreffen mag, der exakten klinischen Diagnostik jedenfalls nicht förderlich sein kann.
Das einzig Positive der als „rheumatisch“ bezeichneten Erkrankung war ihre Eigenschaft, auf physikalisch-therapeutische Maßnahmen günstig zu reagieren.“
Da die Behandlung der rheumatischen Erkrankungen damals im wesentlichen aus physikalischen und balneologischen Maßnahmen bestand, ist es nicht verwunderlich, daß die International Society of Medical Hydrology am 20. April 1925 in Paris ein interationales Komitee für Rheumatismus gründete und die Anregung gab, nationale Komitees zur Gründung von Rheuma-Gesellschaften ins Leben zu rufen.
Am 28. Januar 1927 wurde die Deutsche Rheuma-Gesellschaft geschaffen, nachdem schon in den beiden vorangegangenen Jahren ähnliche Vereinigungen in einer ganzen Reihe von Ländern entstanden waren. Am 15. Oktober 1928 kam die Internationale Rheuma-Liga zustande, der sich die Mehrheit der europäischen Länder anschloß.
Die Internationale Rheuma-Liga stellte es sich zur Aufgabe, die Krankheiten, die mit dem Sammelnamen „Rheuma“ bezeichnet wurden, in ihrem Wesen und in ihrer Ursache zu erforschen, Klarheit über den Begriff Rheuma auf dem Wege der Analyse und Synthese zu schaffen und eine allgemeingültige Nomenklatur aufzustellen. Sie verfolgte neben der wissenschaftlichen Forschung das Ziel sachgemäßer Behandlung zur Vorbeugung und Heilung, vor allem aber suchte sie das allgemeine öffentliche Interesse dadurch zu wecken, daß sie auf die wirtschaftliche Bedeutung der rheumatischen Erkrankung hinwies.
Rheumatische Erkrankungen hat es immer gegeben, sie stellen durch Schmerzen und Behinderung eine erhebliche Last für den Betroffenen dar, und sie haben eine erhebliche wirtschaftliche Bedeutung durch ihr häufiges Auftreten. Erst mit Einführung statistischer Erhebungen um die Jahrhundertwende 1900 gelang es, einen Überblick über die Zahl der Erkrankten zu gewinnen. Aus den Feststellungen des englischen Gesundheitsministeriums im Jahre 1924 ergab sich, daß der sechste Teil aller versicherten Kranken in Großbritannien „Rheumatiker“ waren (SCHOGER 1967).
Die Behandlung erfolgte durch die niedergelassenen Ärzte, die entgegen der weiten Verbreitung dieser Krankheiten im Studium nur wenig auf diese spätere Aufgabe vorbereitet wurden.
Der Geheime Sanitätsrat Dr. P. KÖHLER aus Bad Elster berichtete 1938 „als ich studierte, hörte ich wohl in den Vorlesungen der inneren Medizin von dem akuten Gelenkrheumatismus sprechen, auch von der chronischen Arthritis pauperum und von Ischias. In den chirurgischen Vorlesungen war von Arthritis deformans die Rede, am wenigsten wurde von den Krankheiten gesprochen, denen man in der Sprechstunde als .Gliederreißen‘ begegnete, von all den Krankheiten, die Ärzte und Publikum allgemein als Rheuma bezeichneten.Über keinen Begriff der Medizin herrschte soviel Unklarheit und so wenig Interesse und Verständnis!“

Luftaufnahme der 1931 eröffneten Rheumaheilstätte Bad Bramstedt: Ein großzügiges und ästhetisch wirkendes Bauwerk.
Soweit den niedergelassenen Ärzten eine klinische Behandlung erforderlich schien, erfolgte sie in den regionalen Krankenhäusern, von denen die wenigsten eine „Badeabteilung“ hatten. Lediglich in einigen Bädern mit Rheuma-Tradition gab es „Landesbäder“, klinische Einrichtungen, die später Schulen der Deutschen Rheumatologie wurden, wie z. B. die Landesbäder in Baden-Baden, Wildbad und Aachen, die im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts gegründet worden waren.
Wie es zur Gründung der Rheumaheilstätte kam.
In der am 1. Februar 1956 erschienenen Festschrift „25 Jahre Rheumaheilstätte Bad Bramstedt“ schrieb Präsident HELMS als Vorsitzender des Vorstandes der ehemaligen Landesversicherungsanstalt der Hansestädte: „Seit 1925 belegten die in der Vereinigung von Krankenkassen Groß-Hamburg e. V. und im Landesverband Norden des Haupt Verbandes Deutscher Krankenkassen zusammengefaßten Krankenkassen in steigendem Maße das von Direktor Oskar ALEXANDER als Pächter betriebene Kurhaus Bad Bramstedt mit Kassenpatienten, um so in einem günstig gelegenen („das Bad vor den Toren Hamburgs“) einfachen Bade ohne unverhältnismäßige Kosten Rheumakuren für Versicherte und deren Angehörige durchzuführen. Der steigenden Inanspruchnahme genügte aber die vorhandene alte und reichlich verschlissene Anlage nach Umfang und Einrichtung bald bei weitem nicht. So erwuchs . . . der Gedanke, anstelle des veralteten und unzulänglichen Kurhauses eine eigene, den Bedürfnissen der sozialen Versicherungsträger entsprechende Heilstätte – insbesondere für Rheumakranke – zu errichten.“
Am 2. April 1929 wurde der Gesellschaftsvertrag der „Rheumaheilstätte Bad Bramstedt GmbH“ abgeschlossen. Planung und Leitung des umfangreichen Baues, der 2 770 000 RM kosten sollte, wurde dem Hamburger Architekten Karl FEINDT übertragen. Der Bau- und Einrichtungsaufwand von 8 500 RM je Patientenbett war „gewiß auch nach den Preisen jener Zeit nicht übermäßig“.
Das therapeutische Zentrum der neuen Rheumaheilstätte lag im Rundbau des Badehauses, in dem die Bramstedter Moorsole in Wannenbädern, das Moor als Heißpackungen sowie als Moorbäder in Holzwannen angewandt wurde. Die Moorgewinnung erfolgte im Gelände südlich der Heilstätte von Hand, der Transport mittels Loren zum Badehaus, wo die Aufbereitung in Mühlen stattfand, von denen das Packungsmoor in die Badekabine getragen wurde. In dieselben Kabinen schob der Moorarbeiter die fahrbaren Wannen, deren Bademoor mit strömendem Dampf auf etwa 40 Grad erwärmt war.
Von Krisen geschüttelt
Mit der Weltwirtschaftskrise 1931/1932 kam die neugegründete Rheumaheilstätte schnell in finanzielle Schwierigkeiten, die zu einer Verpachtung an den bisherigen wirtschaftlichen Leiter Oskar ALEXANDER führten, Es wurden auch Privatpatienten als Selbstzahler aufgenommen, obwohl ursprünglich vorgesehen war, ausschließlich Kranken- und Invalidenversicherte aus den Bereichen der drei Hansestädte und Schleswig-Holstein aufzunehmen.
Die Ärztliche Leitung der Rheumaheilstätte hatte bis 1. September 1933 Dr. SCHULZ, der langjährige Badearzt des alten Kurhauses. Bis März 1935 war Dr. STROMBERGER als Chefarzt tätig. Als Dr. PAULUS am 4. März die Stelle des Chefarztes der Rheumaheilstätte übernahm, befand sich das Haus neben der wirtschaftlichen auch in einer ärztlichen Krise, da sein Vorgänger mit zwei anderen Ärzten plötzlich ausgeschieden war. Dr. PAULUS konnte den Internisten Dr. GROSSEKETTLER und den Röntgenologen Dr. GATZWEILER als Abteilungsärzte gewinnen. Diese personelle Besetzung führte zu einer Vergrößerung des Laboratoriums, zur Einrichtung eines Raumes für EKG und Grundumsatzbestimmung sowie zum Bau eines Rontgeninstitutes für Diagnostik und Therapie. 1935 wurde eine Diätküche mit Diätspeisesaal neu gebaut.
Mit 1130 Betten überfülltes Lazarett
Wenige Tage vor Kriegsausbruch wurde die Rheumaheilstätte am 25. August 1939 Reservelazarett, zunächst für Rheumakranke und Innere Leichtkranke. In der Zwischenzeit war die Heilstätte durch den Neubau des für Privatpatienten vorgesehenen Kurhauses an den Auen auf 360 Betten erweitert worden. Wirtschaftlich stand die Einrichtung wieder gefestigt da. Bei geringer Belegung des Lazaretts konnte der Heilstättenbetrieb aufrechterhalten bleiben, so daß im Januar 1940 neben 80 Soldaten noch 250 kranken- und invalidenversicherte Patienten vorhanden waren. Im Januar 1942 wurde das Lazarett auf 450 Betten vergrößert und eine chirurgische Abteilung mit 250 Betten eingerichtet, was eine Aufgabe des zivilen Betriebes bedingte. 1944/45 stieg die Bettenzahl bis auf 1 130 Betten, was nur durch Zuhilfenahme aller Flure, der Speise- und Aufenthaltsräume, des Badehauses und Gymnastiksaales möglich war.
Vom 12. Mai 1945 war die Rheumaheilstätte Reservelazarett unter Leitung eines aktiven Sanitätsoffiziers bis zur Auflösung des Lazaretts am 30. Januar 1946 und Umwandlung in ein Flüchtlings-Krankenhaus mit 700 Betten, zu dessen Leiter Oberarzt Dr. GROSSEKETTLER bestimmt wurde. Am 19. Oktober 1946 wurde das Flüchtlings-Krankenhaus endgültig aufgelöst.

Der alte Haupteingang zum Kurhaus, benutzt im Laufe von Jahrzehnten von hunderttausenden Patienten
Die Rheumaheilstätte Bad Bramstedt GmbH übernahm unter Leitung von Dr. PAULUS wieder den Betrieb des ganzen Hauses, in dem sich noch innere, chirurgische, neurologische, gynäkologisch-geburtshilfliche, Kinder- und Rheuma- Abteilungen befanden. Die neurologische Abteilung wurde Ende 1946, die Kinder-Abteilung im März 1947 aufgelöst und die innere, chirurgische und gynäkologische Abteilung verkleinert unter langsamer Vergrößerung der Rheuma-Abteilung.
Die gynäkologisch-geburtshilfliche Abteilung unter Leitung von Professor Dr. KRANE stand ebenso wie die innere Abteilung unter Dr. WIEDE der Bevölkerung von Bad Bramstedt und Umgebung zur Verfügung. In der chirurgischen Abteilung unter Dr. ZEHRER wurden zahlreiche neurochirurgische Operationen, vor allem Bandscheibenoperationen vorgenommen, nachdem die Wirbelsäule als Krankheitsfaktor erkannt worden war.
Im therapeutischen Bereich wurden Kabinen für die elektrophysikalische Behandlung eingerichtet und die Pendelapparate aus dem Zandersaal entfernt. Im Haus an den Auen konnte ein Saal für zwei Krankengymnasten benutzt werden. Im Badehaus wurden zwei hydrogalvanische Bäder, zwei Unterwassermassageräume und ein subaquales Darmbad eingebaut.
Viele Ärzte haben im Verlauf eines halben Jahrhunderts den Kranken in der Rheumaheilstätte/ Rheumaklinik gedient. Unzählig viele Mitarbeiter waren in anderen Bereichen ebenfalls für die Kranken tätig. Stellvertretend für alle soll der jahrzehntelange Einsatz von zwei Persönlichkeiten im Dienst der Klinik gewürdigt werden.
Über 30 Jahre war Landesverwaltungsrat Hans BLOBEL Geschäftsführer der Rheumaklinik Bad Bramstedt. Seinem Einsatz ist es mit zu verdanken, daß die damalige Rheumaheilstätte nach dem Niedergang durch den Zweiten Weltkrieg Aufbauphasen nie gekannten Ausmaßes erleben konnte. Es gelang, die Rheumaheilstätte ab 1950 als größte Heilstätte der Bundesrepublik auf den modernsten Stand zu bringen.

In dieser Form wurden Moorbäder bis 1979 verabreicht. Über 400 Moorbadewannen besaß die Rheumaheilstätte
Herbert ALEXANDER war seit 1947 Verwaltungsdirektor und ab 24. April 1967 Geschäftsführer der Rheumaheilstätte GmbH. Unter seiner Regie fanden umfangreiche Erweiterungen statt. Seit 1948 wurden durch seinen Einsatz Bauten im Wert von zehn Millionen Mark (einschließlich der Personenwohnhäuser) errichtet. Viele Ehrenämter bekleidete der 1976 verstorbene Geschäftsführer: Stadtverordneter, Mitglied des Kirchenvorstandes, Vorsitzender der AOK-Vertreterversammlung, Vorsitzender der Rheuma-Liga Schleswig-Holstein.
Entwicklung zum Spezialkrankenhaus
17 Jahre wirkte Dr. PAULUS als Chefarzt der Rheumaheilstätte. Seine Zielsetzungen für die Rheumaheilstätte erläuterte er am 15. April 1952, als er sein Aufgabenfeld verließ: „Es war mein Ziel, der Rheumaheilstätte allmählich den Charakter eines Spezialkrankenhauses für Rheumakranke zu geben. Die Bäderbehandlung sollte zwar ein sehr wichtiges und unentbehrliches Mittel, aber kein Allheilmittel sein. Es gab ja manche Rheumakranke, bei denen eine Bäderbehandlung durchaus nicht angezeigt war. Deshalb sollten alle Behandlungsmethoden, also außer der balneologischen, der verschiedenen elektro-mechanisch-physikalischen Methoden, Gymnastik, Diät, Röntgentherapie, Psychotherapie, orthopädische und operative Maßnahmen, Arzneimittelbehandlung usw. angewendet werden.
Viele Rheumakranke litten gleichzeitig noch an anderen Krankheiten, die zum Teil mit dem Rheumaleiden in einem ursächlichen Zusammenhang standen und die unbedingt mitbehandelt werden mußten. Dies waren vor allem Herz- und Kreislaufkrankheiten, Stoffwechselkrankheiten, Blutkrankheiten, Krankheiten der Verdauungsorgane und der inneren Drüsen, Nervenkrankheiten, Knochenkrankheiten, bösartige Geschwülste, Unterleibskrankheiten der Frauen, Krankheiten der Rachenorgane und der Nebenhöhlen, Zahnkrankheiten.
Aus diesen Gründen mußte ich bestrebt sein, daß außer den entsprechenden diagnostischen und therapeutischen Einrichtungen auch Ärzte zur Verfügung standen, die in den diesbezüglichen Fachgebieten eine genügende Erfahrung hatten. Dieses Ziel habe ich allerdings erst nach dem Kriege erreicht. Die Ansicht, daß es sich bei den Rheumakranken meist nur um Leichtkranke handele, die keiner eingehenderen Untersuchung und Behandlung bedürfen und bei denen es genüge, zu Beginn die Bäder zu verordnen und am Schluß zu fragen, wie es gehe, ist völlig abwegig. Gerade bei diesen Leichtkranken handelt es sich nicht selten um den Beginn einer sehr ernsten, ja tödlichen Krankheit.

Auch die alte Moorbahn gehört seit 1979 der Vergangenheit an. Vier- bis fünfmal am Tage fuhr sie Frischmoor in Massen heran. Jetzt kommt das für die Behandlung so notwendige Moor über eine Pipeline in die Klinik.
Je geringer die Beschwerden und der oberflächliche Befund erscheinen, desto genauer muß die Untersuchung sein. Die Diagnose, daß es sich um eine leichte und belanglose Krankheit handle oder daß überhaupt keine organische Krankheit vorhanden sei, kann erst nach einer ganz gründlichen Durchuntersuchung gestellt werden. Ganz besonders zu berücksichtigen ist gerade bei den Rheumakranken der psychische Faktor. Oft liegt dem sogenannten „Rheuma“ eine seelische Schädigung zugrunde. Diese Kranken bedürfen einer psychischen Behandlung, die mit der Bäderbehandlung verbunden werden kann.“

Untersuchungsarbeiten in der Rheumaforschung
Trotz Erweiterung der Belegungsmöglichkeiten auf 650 Betten, was durch eine Aufstockung des Hauptgebäudes erreicht wurde, traten insbesondere in den Sommermonaten lange Wartezeiten ein. Die Anzahl der Selbstzahler verdoppelte sich in den Jahren 1950 bis 1955.
Größte Rheumaklinik der Bundesrepublik
Im April 1952 übernahm Dr. GEHLEN nach ärztlicher Weiterbildung in der Rheumaklinik „Landesbad“ in Aachen von Dr. PAULUS die Aufgabe des Chefarztes und Ärztlichen Direktors. Im Frühjahr 1952 wurden die restlichen Krankenhausbetten mit Rheumakranken belegt. Die Gesamtkapazität betrug nunmehr 670 Betten. Damit war die Rheumaheilstätte Bad Bramstedt die größte in der Bundesrepublik geworden.
1953/1954 wurde das Moorsolebewegungsbad in der Mitte des Badehausringes errichtet, in dem zum ersten Male Krankengymnastik im Wasser erfolgen konnte. Gleichzeitig wurde ein Gymnastiksaal, ein Inhalationsraum sowie eine Massageabteilung errichtet. Die physikalische Therapie wurde durch Wechselduschen, Hauffe‘ sche Bäder sowie einKohlensäuregas-Trockenbad erweitert.
Die Aufenthaltsräume konnten 1958/1959 durch den Bau des Hauses Süd vergrößert werden, in dem auch ein Theatersaal mit über 400 behindertengerechten Sitzplätzen enthalten ist. Der Theatersaal, der durch gemeinsame Benutzung mit der Volkshochschule zur Verbindung von Stadt und Rheumaheilstätte beiträgt, hat das Freizeitangebot erheblich verbessert. In Haus Süd wurden auch Zimmer für 80 Patienten und 14 Krankenschwestern geschaffen.
Schwerpunkt: Rheumaforschung
Mit der Errichtung des „Haus des Ärztlichen Dienstes“ 1962/1963 wurden die Diensträume für Ärzte vermehrt, ein weiträumiges klinisches Labor sowie ein Forschungslabor eingerichtet und im 1. Geschoß ein Wohnheim für Schwestern und medizinische Assistenzberufe geschaffen, im 2. Obergeschoß ein Konferenzraum sowie eine wissenschaftliche Bibliothek.
Die Einrichtung eines Forschungslaboratoriums geht auf die Initiative des wissenschaftlichen Beirats der Rheumaheilstätte zurück, der gemeinsam mit den Gesellschaftern die Erforschung der Ursachen rheumatischer Erkrankungen für erforderlich hielt. Rheumaforschung wurde außerhalb der Universitäten bisher lediglich in der Rheumaklinik Aachen sowie im Rheumakrankenhaus Baden-Baden betrieben, sie sollte sich in der Rheumaheilstätte Bad Bramstedt schwerpunktmäßig auf morphologische Fragen mittels Elektronenmikroskop (Dr. DETTMER) sowie auf biochemische Vorgänge im Gelenk (G. BINZUS) konzentrieren.
Die bisherigen Forschungsziele von Dr. PAULUS lagen in der statistischen Auswertung der Erprobung neuer Arzneimittel sowie in der Auswertung diagnostischer und therapeutischer Erfahrungen. Dr. GEHLEN führte die medizinisch-statistischen Untersuchungen seines Vorgängers weiter und richtete sein Interesse auf die Einflüsse des Herdgeschehens in Entstehung und Entwicklung entzündlich-rheumatischer Erkrankungen.
Mit Erreichen der Altersgrenze von Dr. GEHLEN übernahm der Verfasser am 1. April 1964 die Ärztliche Leitung der Rheumaheilstätte mit dem Ziel, die Diagnostik auf klinischem, radiologischem und labormedizinischem Gebiet zu verbessern, die medikamentöse Therapie, insbesondere auf dem Gebiete der „Basistherapeutika“ zu erweitern und auf dem Gebiet der physikalischen Maßnahmen das aktivierende Prinzip zu verstärken durch einen Ausbau der krankengymnastischen Abteilung sowie durch Einrichtung der Beschäftigungstherapie. Begleitend dazu wurde das Freizeitangebot vergrößert, welches ebenso wie die aktive physikalische Therapie den Patienten für eine Weiterführung der begonnenen Maßnahmen motivieren soll.
Die EDV-Erfassung der Krankengeschichten unter Einschluß eines Teiles der Labordaten begann 1964/ 1965. In der Zwischenzeit liegen Lochkarten von mehr als 150 000 Krankengeschichten vor. Unter Anwendung dieses Verfahrens konnten die Arbeitsunfähigkeitsfälle sämtlicher AOK-Versicherter der Länder Schleswig-Holstein, später auch Hamburg, nach den Einflüssen der jeweiligen Behandlungen untersucht werden.
1964 wurde die Neurologische Abteilung mit Dr. STRAUBE neu besetzt, der elektroencephalographische, später elektromyographische Untersuchungen einführte und sich für psychosomatische Zusammenhänge interessiert.

Beschäftigungstherapie im Kurmittelhaus am Teich nach ärztlichen Verordnungen. Tätig sind drei examinierte Beschäftigungstherapeutinnen
Aufgrund der Erfahrungen, die im Konsiliarsystem mit der Orthopädischen Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf von Professor Dr. HARF und Dr. TILLMANN gemacht wurden, konnte mit Verständnis der Gesellschafter und Unterstützung durch Professor Dr. BUCHHOLZ vom Allgemeinen Krankenhaus St. Georg Hamburg 1965 eine orthopädisch-operative Abteilung eingerichtet werden mit dem Ziel, bewegungsunfähige Rheumakranke durch operative Maßnahmen wieder zu mobilisieren sowie durch operative Entfernung der entzündeten Gelenkkapsel richtunggebenden Einfluß auf die Entwicklung des rheumatischen Prozesses zu nehmen. Nach Studienreisen durch Finnland, wo die operative Behandlung entzündlich-rheumatischer Erkrankungen ihren Ausgang genommen hatte und der Schweiz wurde Dr. TILLMANN die Leitung der Orthopädischen Abteilung der Rheumaheilstätte übertragen. Es wurden dazu die früheren Operationsräume im III. Obergeschoß des Haupthauses wieder eingerichtet.
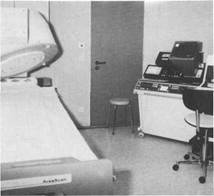
Gamma-Kamera mit Untersuchungs- tisch (links) und Meßwertverarbeitung (Rechner, rechts) zur Durchführung nuklearmedizinischer Untersuchungen (Isotopen-Diagnostik) des Skeletts, der Gelenke, der inneren Organe sowie des Gehirns
Um Raum für die aktivere physikalische Therapie zu schaffen, wurde 1966/1967 das „Kurmittelhaus am Teich“ errichtet mit einem Bewegungsbad von 100 Quadratmetern Größe, gefüllt mit 175 Kubikmeter Sole in einer Temperatur von 33 Grad Celsius, in dem Unterwassergymnastik erfolgt, ergänzt durch therapeutisches Schwimmen (unter Einschluß von Schwimmunterricht). Im selben Gebäude liegen eine Gymnastikhalle für Gruppentherapie, eine Abteilung für Beschäftungstherapie, Räume für die Abgabe von Massagen, Spielzimmer für Tischtennis und Billard sowie Umkleide- und Ruhehallen.
Neuer Name offiziell: „Rheumaklinik“
Die Gesellschafter haben durch eine Änderung des Namens in „Rheumaklinik“ der tatsächlichen Aufgabe einer Spezialklinik Rechnung getragen. Aufgrund der großen Nachfrage wird die Bettenzahl durch Belegung von Außenstationen zeitweilig bis auf 970 vergrößert. Durchschnittlich sind 600 bis 700 Betten durch die Rentenversicherungen, 200 Betten durch die Krankenversicherungen belegt, selbstzahlende Patienten machen weniger als fünf Prozent aus. Die Steigerung der Bettenzahl wird ermöglicht durch die Aufstockung des „Haus des Ärztlichen Dienstes“ 1970/1971, in dem 24 Patienten, nach Neubau eines Personalwohnhauses 1973 weitere 50 Patienten untergebracht werden.
Mit dem neuen Verwaltungsdirektor RATH begann eine großzügige Renovierung und Modernisierung der Klinikeinrichtungen. Als erstes wird das Haus an den Auen 1974 renoviert und auf Einbettzimmer umgestellt. 1975 ersetzte die neue Energiezentrale das alte Kesselhaus.
Durch gute Behandlungsergebnisse stieg die Nachfrage nach Unterwassergymnastik so stark, daß 1975/1976 ein zweites Bewegungsbad an das Kurmittelhaus am Teich angebaut werden mußte, in dem sich unter anderem feststehende Düsen zur Unterwassermassage befinden. Der Erweiterungsbau enthält auch zwei Saunen mit Tauchbecken und Freiluftraum, Tretbäder sowie eine Wechseldusche und Liegeräume.

Das Moorbewegungsbad – die „Attraktion der Rheumaklinik Bad Bramstedt“
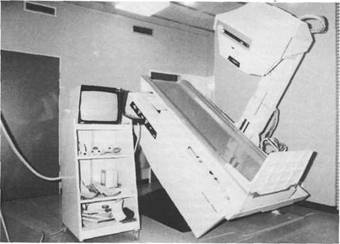
Gamma-Kamera mit Untersuchungs- tisch (links) und Meßwertverarbeitung (Rechner, rechts) zur Durchführung nuklearmedizinischer Untersuchungen (Isotopen-Diagnostik) des Skeletts, der Gelenke, der inneren Organe sowie des Gehirns
Mitte der siebziger Jahre beschließen die Gesellschafter langfristige Strukturmaßnahmen zur Intensivierung der Therapie sowie zur Verbesserung der Unterbringung. Als erste Maßnahme wird 1976 bis 1979 das Badehaus zu einem modernen Therapiering neugestaltet, wodurch sich die Abgabekapazität auf 3 400 Anwendungen pro Tag verdoppelt hat, so daß den stationären Patienten rund drei Anwendungen pro Tag zur Verfügung stehen. Der qualitativen Verbesserung der physikalischen Therapie dienen die neugeschaffenen Moorbewegungsbäder und Moortretbäder sowie die Neukonstruktion einer Großraum-Wanne, gefüllt mit fünfprozentiger Sole und ausgerüstet mit feststehenden und beweglichen Düsen für Unterwassermassagen sowie für Sprudelbäder. Die Moorbäder sind an das Leitungsnetz angeschlossen, welches von einer Mooraufbereitungseinrichtung über eine Druckleitung gespeist wird. Sämtliche Therapieeinrichtungen wurden behindertengerecht erbaut.

Zwei Bettenhäuser sind im Sommer 1981 auf dem Gelände der Rheuma- klinik im Bau, um den Patienten noch bessere Unterbringungsmöglichkeiten anzubieten. 160 Betten werden im „Haus am Park“ und „Haus am Wald“ geschaffen
Im Rahmen der Modernisierung wird die Belegung im Haupthaus reduziert auf zwei- und einbettige Belegung. Um einen Ausgleich in der Bettenzahl zu schaffen, erfolgt der Neubau des Klinikums.
Entzündlich-rheumatische Erkrankungen können bereits im Kindesalter beginnen. Die ambulante undstationäre Betreuung rheumatisch erkrankter Kinder und Jugendlicher übernimmt Dr. KÜSTER, auch die Mitbetreuung von Kindern während operativer Behandlungen.
Um einen Forschungsverbund zwischen den Fachbereichen Medizin der Universitäten Hamburg, Kiel und Lübeck und der Rheumaklinik Bad Bramstedt zu betreiben, wird der Verein zur Förderung der Erforschung und Bekämpfung rheumatischer Erkrankungen e.V. gegründet, der dazu beitragen soll, die Arbeiten in der Forschungsabteilung zu intensivieren.
Alle Behandlungen unter einem weiten Dach
Im August 1980 wird das Klinikum als Zentralbau der Rheumaklinik eingeweiht und mit dem Haus Alexander (Haupthaus) und Haus Süd durch Gänge verbunden. Das Klinikum umfaßt die zentrale Patientenaufnahme, die Planung der physikalischen Therapie sowie ein Postamt.
In der Abteilung für Radiologie (Dr. HAASS), deren Diagnostik durch nuklearmedizinische Einrichtungen erweitert wurde, findet auch eine konventionelle Strahlentherapie sowie eine Isotopenbehandlung (Radiosynoviorthese) statt, bei der durch intraarticuläre Applikation von Isotopen eine Beeinflussung der entzündlich verdickten Gelenkinnenhaut angestrebt wird. Im Erdgeschoß des Klinikum liegen weiterhin die internistischen, pädiatrischen und orthopädischen Ambulanz-Räume, im Untergeschoß das Zentralarchiv, Werkräume und die Bettendesinfektion. Das erste Obergeschoß wird ausschließlich durch Operations-Säle in Anspruch genommen, bei denen höchste Ansprüche an Sterilität gestellt werden. Im zweiten Obergeschoß befindet sich die orthopädisch-operative Abteilung, im dritten Obergeschoß die internistisch-rheumatologische Abteilung unter Einschluß von 6 radiologischen Betten. Insgesamt enthält das Klinikum 110 Betten.
1981 wurde mit dem Neubau von zwei Häusern mit je 80 Betten und Arzt- und Schwestern-Station begonnen. Diese Neubauten sollen mit Gängen die Verbindung zum Kurmittelhaus am Teich herstellen, so daß dann der Patient alle diagnostischen und therapeutischen Einrichtungen der Rheumaklinik in geschlossenen Räumen erreichen kann. Der Neubau der beiden Häuser ist erforderlich, um die Bettenzahl zu halten, da sich mit der Renovierung des Hauses Alexander (Haupthaus) Mitte der achtziger Jahre eine beträchtliche Reduktion ergeben wird.
Mitte der achtziger Jahre wird die Rheumaklinik ihre Strukturmaßnahmen abgeschlossen haben. Damit ist das Ziel der Modernisierung einer Klinik erreicht, als erste und einzige Spezialklinik in der Bundesrepublik Deutschland sämtliche diagnostischen und therapeutischen Einrichtungen zur Behandlung der rheumatischen Erkrankungen aller Lebensalter unter einem weiten Dache verbindet.
| Die Gesellschafter der Rheumaklinik Bad Bramstedt GmbH. |
Landesversicherungsanstalt Freie und Hansestadt Hamburg
vertreten durch Direktor Ewald RAMIN, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung |
Landesversicherungsanstalt Schleswig-Holstein in Lübeck
vertreten durch den Ersten Direktor Dr. Gerhard BLUHM, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung |
Landesverband der Ortskrankenkassen Hamburg
vertreten durch Direktor Heinz RUMPF |
Landesverband der Ortskrankenkassen Schleswig-Holstein
vertreten durch Direktor Günter MEYER |
Stadt Bad Bramstedt
vertreten durch Bürgermeister Heinz WEDDE |
| Stand 1. September 1981 |

Seite 38
Oben: Unterwassergymnastik im Solebewegungsbad.
Unten links: Fünffingerbad mit Unterwassermassage und Luftperlbad.
Unten rechts: Neugestaltete Brunnenhalle im Altbau.

Seite 39
Oben: Gruppengymnastik auf dem kleinen Sportplatz des Kurmittelhauses am Teich.
Unten links: Die Gärtner der Rheumaklinik sorgen stets dafür, daß die Kurgäste Freude an den Anlagen haben.
Unten rechts: Blick auf das Kurmittelhaus am Teich mit Schwimmhalle und Liegewiese.
zurück
Reinhold RATH
Verwaltungsdirektor der Rheumaklinik Bad Bramstedt
Sichere Arbeitsplätze in der Rheumaklinik
Unternehmen mit bedeutender Wirtschaftskraft
Auf einen Blick können Besucher der Rheumaklinik die Entwicklung der Rheumaklinik Bad Bramstedt im Abschnitt von 50 Jahren zwischen 1931 und 1981 nachvollziehen, wenn sie das Modell in der Empfangshalle des Klinikums eingehend betrachten. Alle Einzelheiten des vielfältigen Werdens der Heilstätte/Klinik und der Modernisierung werden am Modell verdeutlicht.
Ein halbes Jahrhundert lang erfolgte die Leitung der Rheumaheilstätte nach den Gesichtspunkten, die im Gesellschaftsvertrag vom 2. April 1929 für die Rheumaheilstätte festgelegt wurden: Der Betrieb des Kurhauses ist für „minderbemittelte Volkskreise“ bestimmt, „zur Bekämpfung von Rheuma und ähnlichen Krankheiten sowie Frauenkrankheiten.“
Die Rheumaheilstätte, 1931 in Betrieb genommen, gab zunächst dem Ganzen den Namen. Sie entwickelte sich im Laufe von fünf Jahrzehnten zu einer Anlage nie geahnten Ausmaßes. Standen ursprünglich 15 Hektar Land zur Verfügung, so besitzt die Rheumaklinik heute 57 Hektar Land dank einer vorausschauenden Bodenvorratsüberlegung.

Modell der Rheumaklinik Bad Bramstedt in der Empfangshalle des Klinikums. Erfaßt ist die Entwicklung der Rheumaheilstätte / Rheumaklinik in den vergangenen 50 Jahren
Die Gesellschafter waren sich 1976 mit dem Ärztlichen Direktor sowie der Geschäftsführung in derAuffassung einig, daß eine Bezeichnung „Rheumaklinik“ besser den aktuellen Zielsetzungen gerecht wird als der Name „Rheumaheilstätte“. So erfolgte die Umbenennung in Rheumaklinik.
Wie der Vorsitzende der Gesellschafterversammlung der Rheumaklinik Ewald RAMIN bei der offiziellen Eröffnung des neuen Klinikums als Mittelpunkt der Erweiterungsmaßnahmen am 29. August 1980 erklärte, ist es Hauptaufgabe der Rheumaklinik, den behinderten Menschen zu helfen. ,,Ihre Fähigkeiten und Kräfte sind zu entfalten, damit sie einen angemessenen Platz in der Gemeinschaft finden. Dazu gehört vor allem eine dauerhafte Eingliederung in Arbeit und Beruf.“
„Rehabilitation vor Rente“ – diese Zielsetzung streben die Sozialversicherungsträger als wichtigste Garanten der Rehabilitation auch in der Rheumaklinik Bad Bramstedt an. Die Versicherten sollen vor einer vorzeitigen Verrentung bewahrt werden.
Ab 1974 wurde in intensiver Teamarbeit mit den Gesellschaftern und Geschäftsführern, dem ärztlichen Direktor Dr. med. Gerhard JOSENHANS, dem Verwaltungsdirektor Reinhold RATH sowie dem Betriebsingenieur Edgar RIEHL geplant, die Rheumaklinik besser als bisher auszurüsten, um den Aufgaben der Rehabilitation gerecht zu werden.
Ziel war es, die technisch/medizinischen Einrichtungen ebenso wie die allgemeine technische Ausrüstung und eng damit verbunden die bauliche Konzeption grundlegend zu verbessern, um ein Optimum der Behandlung zu erreichen. Im Dienst der Rheumakranken waren physikalisch/therapeutische Einrichtungen zu erweitern und auch im großen Umfange überhaupt erst zu schaffen.

Patienten der Rheumaklinik Bad Bramstedt suchen gern die beschauliche Stätte des Verweilens vor dem 400 Plätze fassenden Kurhaustheater auf
Alle Strukturmaßnahmen zielten darauf an, den Rang und die Bedeutung der Rheumaklinik Bad Bramstedt als klinisches Zentrum zur umfassenden medizinischen und beruflichen Rehabilitation von rheumatischen Erkrankungen zu festigen sowie dieRheumaklinik zu einer Schwerpunktklinik auszubauen.
Das Papier über „Strukturmaßnahmen der Rheumaklinik11 schildert auf sechs Seiten alle Ausbauphasen. Für das Team der Rheumaklinik war es die Grundlage, der Kompaß, in sieben Jahren des Durchhaltens in der Aufbauarbeit. Die meiste Arbeit war geschafft, als der Zentralbau – jetzt offiziell Klinikum – als „Herzstück der Gesamtkonzeption“ am 29. August 1980 eingeweiht wurde. Bauten mit einem Gesamtaufwand von 60 Millionen DM wurden vollendet oder stehen unmittelbar vor dem Abschluß. Bauten in dieser Größenordnung hatte es seit 1931 im Bereich der Rheumaheilstätte / Rheumaklinik bisher nicht gegeben.
Ergänzend ist mitzuteilen, daß dabei auch die Freizeittherapie nicht zu kurz kam. Auf eine vollautomatische Kegelbahn mit vier Bahnen hatten sich die Kurgäste bereits seit langem gefreut. An Freizeitbetätigungen werden Wanderungen angeboten, für das Radwandern stellt die Rheumaklinik kostenlos Fahrräder zur Verfügung. Schwimmen und Gymnastik sind sehr gefragt. Neben Billard stehen für das „Königliche Spiel“ mehrere Bretter, davon eins mit Großfiguren, zur Verfügung.
Bei näherer Betrachtung des Investitionsaufkommens in den Jahren der Erneuerung und Sanierung derRheumaklinik läßt sich die Bedeutung der Wirtschaftskraft der Rheumaklinik für Bad Bramstedt erkennen.

Seit 1953 ist die Rheumaheilstätte, später Rheumaklinik, ständig modernisiert worden. Das gilt für den medizinischen Bereich ebenso wie für den wirtschaftlichen Zweig und die Verwaltung. Das Foto zeigt Erdarbeiten für den Neubau des Bade-hausringes. der 1976 / 1979 in zwei Abschnitten verwirklicht wurde
Firmen der norddeutschen Bauregion fanden für viele Jahre in der Rheumaklinik einen großen und sicheren Arbeitsplatz. Großaufträge dieser Art konnte das Bramstedter Baugewerbe natürlich nicht übernehmen, weil es überfordert war. Spezialausführungen wurden sogar an süddeutsche Firmen vergeben.
Die Rheumaklinik ist eine gemeinnützige Einrichtung und daher aufgrund einer gesetzlichen Regelung von allen Steuern und Abgaben befreit.
Über 40 Millionen DM beträgt das Haushaltsvolumen der Rheumaklinik für 1981. 57 Prozent der Gesamtaufwendungen – 23,2 Millionen DM – sind Personalkosten. Diese Gelder werden zum größten Teil in der Wohnstadt Bad Bramstedt und der näheren Umgebung ausgegeben.
Die Sachaufwendungen betragen 12,4 Millionen DM. Außerhalb der Klinik sind 240 Betten ständig besetzt. Für diese auswärtige Unterbringung zahlte die Rheumaklinik 1980 an Hotels und Pensionen einen Betrag von 3,4 Millionen DM. Für Lebensmittel gab die Rheumaklinik im Jahr 1980 rund 1.764.000 DM aus. Der größte Teil der Lebensmittel wurde in Bad Bramstedt gekauft.

Ständig finden in der Rheumaklinik Theater- und Musikveranstaltungen statt, um den Kurgästen etwas Kulturelles zu bieten. Inmitten des Kurparkes wurde eine große Musikmuschel (Bildmitte) errichtet, davor zahlreiche Zuhörerbänke. Im Sommer finden Kurkonzerte hauptsächlich im Freien statt.
606 Mitarbeiter sind in der Rheumaklinik beschäftigt: Davon 38 Ärzte, 56 medizinisch-technischeMitarbeiter, 84 Krankenschwestern und Pfleger, 122 im Bereich der physikalischen Therapie und Mooraufbereitung, 212 in der Haus- und Wirtschaftsabteilung, 37 Handwerker, 33 in der Verwaltung, zwei in der Forschungsabteilung sowie 22 Praktikanten und Lehrlinge.
Mit 606 Beschäftigten ist die Rheumaklinik Bad Bramstedt mit Abstand die weitaus größte Arbeitsstätte im Wirtschaftsraum Bad Bramstedt.
Es bedarf großer Anstrengungen, um Fachkräfte für Spezialtätigkeiten zu gewinnen. Einpendler kommen Tag für Tag zur Rheumaklinik aus den Räumen Richtung Neumünster, Kellinghusen / Henstedt-Ulzburg.
Durch den gesicherten Arbeitsplatz in der Rheumaklinik entschlossen sich in den vergangenen Jahrzehnten viele Mitarbeiter, in der ,,Rolandstadt im Grünen“ ihren Wohnsitz zu nehmen.
Mit den ehemaligen Betriebsangehörigen bestehen enge Verbindungen. Die Zahl der Altersrentenempfänger ist in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen. Diese Tatsache läßt positive Rückschlüsse auf die Betriebstreue der Beschäftigten der Rheumaklinik zu.
Aus dem Unterstützungsverein und dem Pensionsfonds wurden 1980 an 161 ehemalige Betriebsangehörige und an 30 Witwen insgesamt 820 000 DM an Renten gezahlt.
Durch die Vielzahl der Arbeitsplätze stützt die Rheumaklinik die wichtige Funktion des Unterzentrums Bad Bramstedt für den überörtlichen Wirkungsbereich.
(43)
zurück
Friedmund WIELAND
Ministerialrat u. Bürgervorsteher der Stadt Bad Bramstedt
Was Bad Bramstedt so liebenswert macht!
Oft stellen Besucher und auch Bewohner der Kur- und Rolandstadt Bad Bramstedt die Frage: „Was macht Bad Bramstedt eigentlich so liebenswert?“ Darauf eine Antwort zu geben, ist gar nicht so leicht. Vielleicht kommen wir der Beantwortung etwas näher, wenn wir uns einmal die „Rolandstadt im Grünen“ vom Turm des Intermar-Hotels „Köhlerhof“ anschauen.
Blicken wir von dort aus auf Bad Bramstedt und seine nähere Umgebung, so liegt eine wundervolle Parklandschaft zu unseren Füßen. Sechs Auen prägen das Bild der Landschaft: Bad Bramstedt zeigt sich von der besten Seite. Es ist wirklich eine Kur- und Rolandstadt im Grünen.
Liebenswert die Stadt und die Umgebung mit Feldern, Wiesen, dem Höhenzug des Liethberges und vielen Wäldern. Aus ihnen finden seit Jahrzehnten Weihnachtstannen den Weg in die Städte bis nach Westberlin hin.
Dort inmitten des großen Kurparks die Rheumaklinik, Zentrum des Sole- und Moorbades Bad Bramstedt. Sie genießt Weltruf und wird ständig entsprechend den medizinischen Anforderungen modernisiert. Jahr für Jahr finden in der Rheumaklinik etwa 10000 Patienten Genesung und Linderung von schweren Leiden.
Vom Turm erkennbar ist ein großes Wandernetz. Es wurde in jüngster Zeit vom Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt erschlossen. 16 Rundwanderwege von 140 Kilometer Länge führen durch die landschaftlich reizvollsten Gegenden innerhalb und außerhalb der Stadtgrenzen. Schon jetzt werden die Wege, die noch ergänzt werden sollen, von vielen Patienten der Rheumaklinik für Terrainkuren, von Hamburger Ausflüglern und nicht zuletzt von den Bramstedter Einwohnern für Spaziergänge genutzt. Außerdem beginnt und endet in Bad Bramstedt ein großes Radwegenetz.

Durch einen Grüngürtel ist in jüngster Zeit die Stadt Bad Bramstedt mit der Rheumaklinik verbunden worden. Besonders geglückt ist die Anbindung durch seenartige Teiche am Intermar-Hotel Köhlerhof.
Die Rolandstadt im Grünen besitzt einen hohen Wohnwert: In Bad Bramstedt wohnt es sich gut und schön. Deutlich erkennen wir das vom Hotelturm aus: Ganz bewußt haben es die Stadtväter in der Zeit des Wirtschaftswunders und auch danach abgelehnt, städtebauliche Exzesse von Hochhäusern zuzulassen. Einige wenige Dominanten wirken nicht störend, sondern lockern die Bebauung auf. Kleinere Mehrfamilienhäuser und auch viele Einfamilienhäuser erhielten in sehr guter Wohnlage den Vorzug.
Zu gleicher Zeit bemühten sich die Verantwortlichen in der Stadt, die Zahl der Arbeitsplätze in den verschiedenen Bereichen von Bad Bramstedt zu vergrößern oder zumindest zu festigen. Es war immer das Bemühen der Stadtväter, den Einwohnern eine Wohnung und einen Arbeitsplatz in der Stadt zu sichern. Das weite Auspendeln zu einer fern gelegenen Arbeitstätte sollte auf alle Fälle vermieden werden. Auch das ist ein Pluspunkt für Bad Bramstedt.
Bramstedt – das ist die „Ginsterstätte“ – Ende Mai/Anfang Juni können wir im Weichbild der Rolandstadt viele gelbe Farbtupfer erkennen. Es ist der prächtig leuchtende Ginster, niederdeutsch „Bram“ genannt, von dem die Stadt ihren Namen hat.
Schauen wir weiter aus: Dort unten liegt geschichtsträchtig inmitten des Ortes der Bleeck mit dem Roland, der im 16. Jahrhundert erstmals urkundlich erwähnt wird. In Nordwest-Deutschland gibt es außerdem noch Rolandstandbilder in der Hansestadt Bremen und in Wedel/Holstein.
Der Bleeck, zweitgrößter Marktplatz Schleswig-Holsteins, bildet den uralten Kern der jetzigen Stadt, die früher ein Flecken war. Im Mittelalter war der Bleck der ganze Ort. Die Liebe der Bramstedter zum Bleeck und Roland hat die Jahrhunderte überdauert und besteht immer noch. Auch heute ist der Bleeck die „gute Stube“ von Bad Bramstedt.
Der Bleeck war seit über 600 Jahren ein bedeutender Schnittpunkt der Verkehrswege. Vorbei führte der alte Ochsenweg. Unterm Roland wurde über Fragen des Ochsenhandels Recht gesprochen. Heute pulsiert der Verkehr der Bundesstraßen 4 und 206 in alle Himmelsrichtungen am Bleeck vorbei. Der Verkehr wäre unerträglich, wenn nicht die Autobahn Hamburg – Flensburg mit Zubringer nach Kiel, einige Kilometer östlich der Stadt, Bad Bramstedt an das große Fernverkehrsnetz anschließen würde. Befürchtungen, der Ort würde durch die Autobahn leer gefahren werden, haben sich nicht bestätigt.
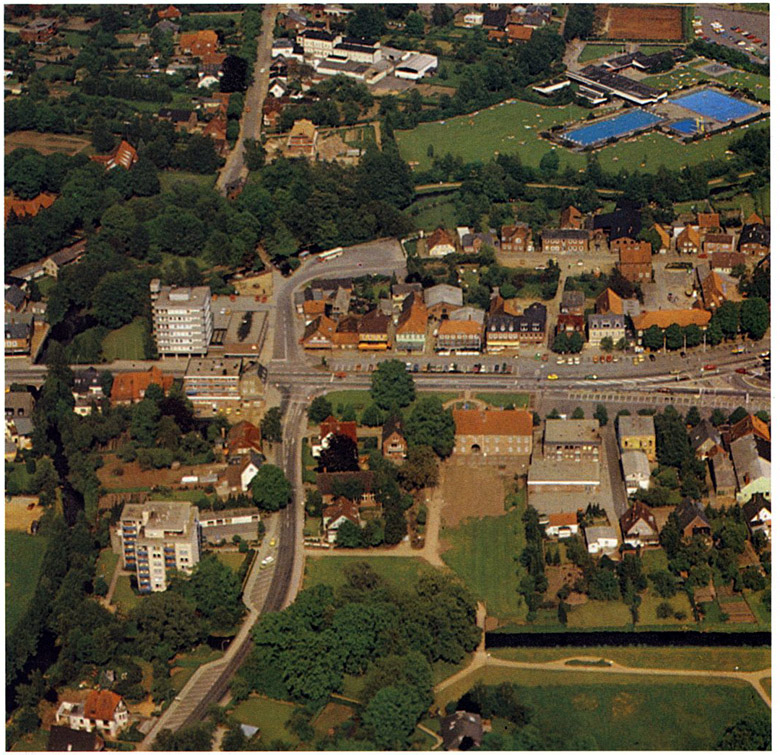
Seite 46 Der Bleeck aus der Vogelperspektive. Deutlich ist zu erkennen, daß sich bis heute der Charakter des zweitgrößten Marktplatzes Schleswig-Holsteins über Jahrhunderte hinweg erhalten hat. Der Bleeck blieb die Mitte des Ortes. Seine Einheit wurde auch nicht durch den Bau der Kreissparkasse (links) gestört. Auffallend ist in der Bildmitte das Schloß, das seit 1969 nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten Repräsentationszwecken dient und manche Kostbarkeit birgt. Rechts oben liegt das Warmwasserfreibad, das weit über Bad Bramstedt hinaus beliebt ist. Die Stadt ist bemüht, neue Freizeitaktivitäten zu ermöglichen. Sichtbar ist in der unteren Bildmitte an der Hudau ein Teil des Wanderwegenetzes zur Erschließung der Auenlandschaft (Freigabe des Luftbildes unter der Nr. SH 912/1).
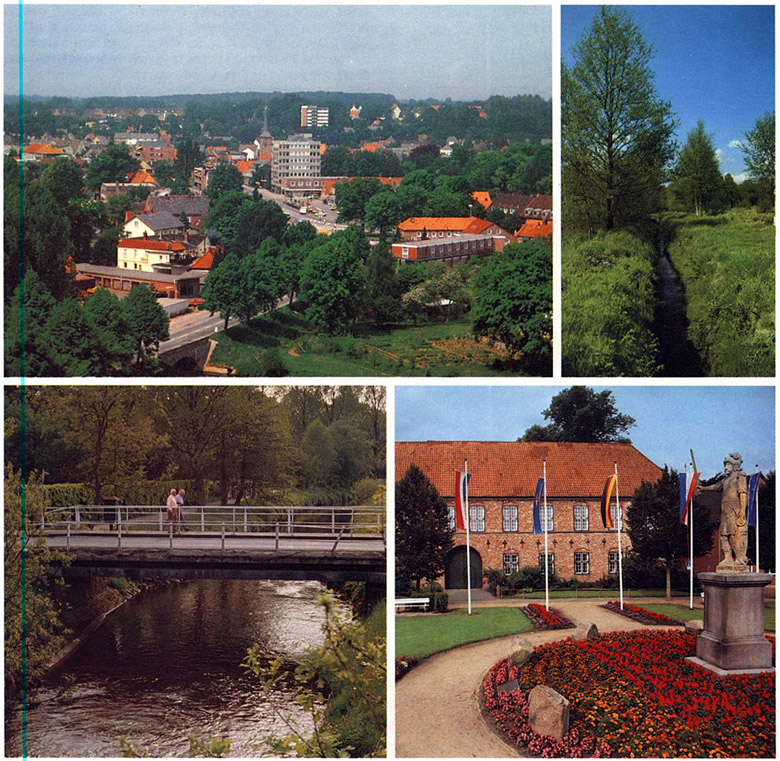
Seite 47
Oben; Blick auf die „Rolandstadt im Grünen“ vom Turm des Intermar-Hotels „Köhlerhof“.
Oben rechts: Heil ist die Welt noch in der Moorlandschaft bei Bad Bramstedt.
Unten links: Die Hambrücke, das Eingangstor zur Rheumaklinik. Bad Bramstedt besitzt 24 Brücken. Die Hambrücke ist wahrscheinlich die älteste. Urkundlich wird sie bereits 1317 erwähnt, als die Schlacht auf dem Strietkamp stattfand.
Unten rechts: Schloß und Roland – denkwürdige Zeugen der Vergangenheit auf dem Bleeck. Seit Jahrhunderten haben hier der Flecken und später die Stadt Bad Bramstedt ihren Mittelpunkt.
Ein Glückslos zieht der Besucher des Bleecks, wenn er einmal bei sommerlichen Temperaturen spätabends auf dem Platz verweilen kann. Er sollte sich dann von der eigentümlichen Atmosphäre des Bleecks gefangennehmen lassen. Er wird glauben, weit im Süden zu sein. Gedämpftes Licht strahlt aus den Gaststätten, die hier und dort von Weinreben umrankt sind: Wer glaubt da noch, einen Sommerabend im nördlichsten Land der Bundesrepublik zu erleben!?
Der träumende Besucher hört vielleicht einen besonderen Dreiklang am Bleeck: Die Vorbeifahrt alter königlicher Postkutschen, das Klappern der Pferdehufe und den Klang des Posthorns – liebenswertes Bad Bramstedt.
Traditionsreich auch die Küchen in den ausgezeichneten Bramstedter Gaststätten. Oft haben sie etwas Besonderes auf der Speisekarte. So mancher Gast hat sich schon in alte holsteinische Spezialitäten verliebt: Rode Grütt (Rote Grütze), Grönkohl mit Swiensback (Grünkohl mit Schweinebacke) oder Groter Hans (Warmer Semmelkuchen mit Vanillesauce). Liebenswürdige Einladungen zu Besonderheiten auf Speisekarten offeriert.
Ohne ,.Schloß“ wäre Bad Bramstedt nicht zu denken. Dem Schloß gehört die „heimliche“ Liebe der Rolandstädter. Es liegt am Bleeck und ist ein Kleinod, obwohl es eigentlich ein Torhaus ist. Der dänische König CHRISTIAN IV. ließ es im 30jährigen Krieg erweitern. Er schenkte es 1633 seiner ihm zur Linken angetrauten Frau WIEBKE KRUSE. Ihr Miteinander begann, als der König 1625 die Wäscherin Wiebke aus dem Nachbardorf Föhrden-Barl von der Beeckerbrücke aus beim Vorbeiritt erblickte. Kurz nacheinander wurden sie beide 1648 vom Tod hinweggerafft.
Doch die Liebe der Bramstedter zum „Schloß“ blieb über Jahrhunderte erhalten. Als 1964 das Schloß vor dem drohenden Verfall stand, erwarb die Stadt das Gebäude. Mit großem Einfühlungsvermögen wurde eine umfangreiche Restaurierung eingeleitet. Um die Erhaltung und werkgetreue Wiederherstellung der Bausubstanz bemühte sich vor allem der damalige Leiter des Segeberger Kreisbauamtes Peter O. EBERWEIN. Mit Sachverstand wurde er von Walter SCHULZE unterstützt, der sich schon um eine Darstellung der Maria-Magdalenen-Kirche zur 650-Jahr-Feier bemüht hatte.
Nur ein Beispiel der sachgerechten Restaurierung des Schlosses sei erwähnt: 17 verschiedene Backsteine mußten in Dänemark 1968 gebrannt werden, um die Schloßfassade im Stil des 17. Jahrhunderts wiederherzustellen. Bei einem Gang durch die Säle und Zimmer des Schlosses beeindrucken vor allem die Stuckelemente. Schöneren Stuck gibt es kaum in schleswig-holsteinischen Profanbauten.
Im Laufe der Jahrhunderte haben sich in den Städtebildern die Dominanten, die Dome, in ihrer Stellung geändert. Geblieben ist in Bad Bramstedt die seit 1316 bestehende Maria-Magdalenen-Kirche. Das ehrwürdige Gotteshaus ist ein eindrucksvolles Beispiel der Backsteingotik. Wertvolle Kunstschätze birgt die Kirche. Im Mittelpunkt steht der Altar – ein gotisches Triptychon. Einen tiefen Eindruck hinterläßt der Taufkessel, Anfang des 13. Jahrhunderts. Drei stützende Figuren besitzen das sogenannte „ archaische Lächeln“, eine Verwandtschaft zur Spätantike. Holzskulpturen und der reiche Silberschatz zählen zu weiteren Schätzen.

Larenz Jessen aus Glückstadt stiftete der Maria-Magdalenen-Kirche zu Bramstedt drei Leuchter, nachdem er durch Gebrauch des Wassers der Entdeckungsquelle 1681 vom Vier-Tage-Fieber genesen war.
Aus Anlaß der Entdeckung der ersten Bramstedter Heilquelle im Jahr 1681 vor 300 Jahren sei daran erinnert, daß sich in der Maria-Magdalenen-Kirche drei silberne Barock-Leuchter mit folgender Inschrift befinden: ,,Ann 1681 – den 1. Juli ist Larenz Jessen, Kön. Prov. Verwalter in Glückstadt durch Gebrauch des Wassers von Quartan (Vier-Tage-Fieber) befreit – verehrt diese drei Leuchter zum Gedächtnis“. Die Maria-Magdalenen-Kirche ist oft Stätte kirchenmusikalischer Veranstaltungen. Die Ev.-Luth. Kirchengemeinde macht seit Jahrzehnten den Patienten ein gottesdienstliches Angebot in der Rheumaklinik. Ähnlich bemühten sich die Katholische Kirchengemeinde und weitere Bramstedter Glaubensrichtungen.
Zur Sorgfalt der Stadtväter um die Einwohner gehört auch eine gute schulische Versorgung. Bad Bramstedt geht der Ruf voraus, auch für das große Umland ein gut ausgerüsteter schulischer Mittelpunkt zu sein. Der Jugend werden hervorragende Schulmöglichkeiten geboten: zwei Grundschulen, eine Hauptschule, je eine Sonderschule L und G, eine Realschule, ein Gymnasium (Jürgen-Fuhlendorf-Schule). Im vergangenen Jahrzehnt erfolgten viele Schulneubauten oder grundlegende Umbauten. Der mit dem Amt Bad Bramstedt-Land bestehende Schulverband hat sich in jeder Weise bewährt.

Die Maria-Magdalenen-Kirche zu Bad Bramstedt. 1316 erstmals urkundlich erwähnt. Die Kirche ist heute noch ein bedeutender geistlicher Mittelpunkt für ein großes Einzugsgebiet.
Jugend und Sport haben ein weites Feld für Sport- und Freizeit durch ein umfangreiches Angebot: Jugendzentrum, Sport- und Turnhallen, Sportplätze, modernes Warmwasserfreibad, Reithallen, Schießstände, Tennis, Golf, Angeln. Es gibt in Bad Bramstedt, außer dem großen Wassersport, wohl kaum eine Sportart, die nicht ausgeübt werden kann. Runden wir den Katalog von Antworten zur Frage „Was macht Bad Bramstedt eigentlich so liebenswert?“ ab. Da werden Bramstedter Neubürger beim Einleben in die Rolandstadt durch das reichgegliederte Vereinsleben fasziniert. Es gibt für jeden Geschmackund für jeden Geldbeutel etwas, um sich schnell zu integrieren: Jedermann ist in Bad Bramstedt willkommen.
Das Bild Bad Bramstedts wäre ohne den Standort des Bundesgrenzschutzes unvollkommen und entbehrte einer wichtigen Note. Das Grenzschutzkommando Küste und die Grenzschutzverwaltung Küste haben hier seit 1964 ihren Sitz. Der damalige Bürgermeister Heinrich GEBHARDT war es, der das Bundesinnenministerium in jahrelangen Verhandlungen davon überzeugte, das schöne Bad Bramstedt als BGS-Standort zu wählen. Seit 17 Jahren bestehen zwischen dem BGS und der Bramstedter Bevölkerung sehr gute partnerschaftliche Bande.
(51)
zurück
Heinz WEDDE
Bürgermeister der Stadt Bad Bramstedt
Im Ziel verbunden: Den Kranken zu dienen
50 Jahre Zusammenarbeit von Stadt Bad Bramstedt und Rheumaklinik
Partner der Rheumaheilstätte/Rheumaklinik ist die Stadt Bad Bramstedt seit über 50 Jahren. Diese Partnerschaft hat sich in jeder Weise bewährt, was an den Erfolgen der Rheumaklinik abzulesen ist. Bei der Interessenabgrenzung waren allerdings die Wünsche innerhalb der Partnerschaft mitunter sehr unterschiedlich.
Beim Start der Rheumaheilstätte gab die Stadt 1929/1931 wertvolle Hilfen, die den Bau überhaupt erst ermöglichten. Eingebracht wurden in die Gesellschaft mit 15 Hektar das erforderliche Gelände. Der Wert dieser Starthilfe hat sich im Verlauf eines halben Jahrhunderts vervielfacht. Es handelte sich um das Kernstück des „Kaiser-Wilhelm-Waldes“ (Stadtwald), das der Rheumaheilstätte mit den darauf befindlichen Holzbeständen zum Eigentum überlassen wurde. Der Wert des Grundstücks wurde auf 60 000 RM festgesetzt. Zum Stammkapital der Rheumaheilstätte GmbH von 100 000 RM leistete die Stadt eine Stammeinlage von 10 000 RM, mithin zehn Prozent.
Die weiteren 50 000 RM aus dem überlassenen Grundvermögen wurden in einer unverzinslichen Goldmark-Darlehns-Hypothek mit der Maßgabe angelegt, daß sie während des Bestehens der Gesellschaft unkündbar ist.
Damit gewährte die Stadt der Rheumaheilstätte eine unkündbare Dauersubvention. Das war eine Entscheidung, die sich nach heutiger Sicht zumindest aus finanzwirtschaftlichen Erwägungen als falsch erweisen sollte: Der Grund und Boden war 1929/1931 fast geschenkt. Von der großen Mitgift der 50 000 RM-Hypothek weiß im übrigen die große Öffentlichkeit in Bad Bramstedt kaum noch etwas.
Ein Studium der Protokolle der Bad Bramstedter Stadtverordnetenversammlung lehrt, daß sich die Stadtväter in den Jahren 1928/1931 die Entscheidungen über die Rheumaheilstätte nicht leicht werden ließen. Alle Sitzungen waren vertraulich, ähnlich wie in den Jahren 1962/1964, als es darum ging, Bad Bramstedt Standort des Bundesgrenzschutzes werden zu lassen.
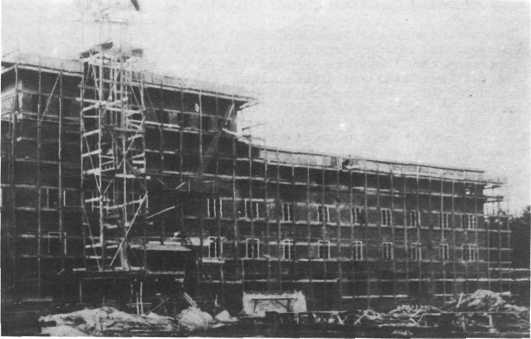
Ganz Bad Bramstedt nahm an dem großen Bau der Rheumaheilstätte 1930 teil. Ein so gewaltiges Vorhaben war in der Rolandstadt noch nie verwirklicht worden. 2,7 Millionen Steine wurden für den Bau benötigt, teilten die „Bramstedter Nachrichten“ mit, 134 Meter betrug die Gesamttiefe des Bauwerks
Aus den Verhandlungen der Stadt vom Frühjahr 1929 wegen der Gründung der Rheumaheilstätte GmbH ist zu entnehmen, daß die Stadt damals im Interesse der Sache auf eine grundbuchliche Eintragung der Hypothek von 50 000 RM verzichtete.
Rund 20 Jahre später verschlechterte sich die Stellung der Stadt als Gesellschafter nach der Währungsreform von 1948 wesentlich. Bedingt durch die sehr geringe Eigenkapitalausstattung und wegen der notwendigen Verstärkung der Betriebsmittel kam es in den 50er Jahren nach langwierigen Verhandlungen der Gesellschafter zu einer Erhöhung des Stammkapitals von 100 000 DM auf zunächst 300 000 DM und später auf 400 000 DM.
Diese Aufstockung brachte der Stadt nach der großen Starthilfe nunmehr harte, zusätzliche Belastungen. Beim Währungsschnitt von 1948 erwies sich die Grunderwerbsregelung von 1929 als sehr nachteilig. Die Stadt hatte mit ihrem Grundvermögen 60 000 RM (40 Prozent) in die Gesellschaft eingebracht, während die übrigen Gesellschafter 90 000 RM in Geldbeträgen (60 Prozent) zahlten.
Durch die Währungsreform wurde die städtische Hypothek von 50 000 RM auf ein Zehntel, 5 000 DM, dezimiert. Die baren Beteiligungen des Stammkapitals blieben dagegen unverändert. In Wahrung der Interessen der Bürger protestierte der damals amtierende Bürgermeister gegen diese Umstellung des Stammkapitals – leider vergeblich. Im jetzt gültigen Gesellschaftsvertrag wird das von der Stadt 1929 eingebrachte Grundvermögen mit lediglich 15 000 DM ausgewiesen. Das sind nur 3,75 Prozent des Stammkapitals. Die Höhe des städtischen Anteils wird weder den tatsächlichen Gegebenheiten der Gründung gerecht, noch entspricht sie den heutigen Wertvorstellungen über das Grundvermögen. Um wenigstens einen Anteil von 7,5 Prozent des Stammkapitals zu besitzen, überließ die Stadt der Rheumaheilstätte ein drei Hektar großes Waldstück „Am Wittrehm“ mit einem 50jährigen Kiefern- und Fichtenbestand. Der Anteil der Stadt erhöhte sich in der Gesellschaft auf 30 000 DM.
Monopolstellung der Rheumaheilstätte
Bereits vor dem Bau der neuen Rheumaheilstätte verlangten die Sozialversicherer für den Standort Zusicherungen und Garantien. Aufgrund eines Antrags der Vereinigung von Krankenkassen Groß Hamburgs e.V. vom 17. Dezember 1928 verpflichtete sich die Stadt, „auf dem jetzigen städtischen Grundstück beim Neuen Kurhaus (Stadtwald) weder selbst Erholungsheime und Gaststätten zu bauen noch deren Bau die Zustimmung zu geben“.
Damit wurde der gesamte Stadtwald zur ausschließlichen Benutzung der Kurgäste kostenlos zur Verfügung gestellt. Ausgeschlossen waren dadurch sämtliche Engagements der Stadt. Die Monopolstellung der Rheumaheilstätte blieb auch gegenüber einer möglichen Reaktivierung des „Alten Kurhauses“ – einst von Matthias HEESCH gegründet – in jeder Weise gewahrt. Hier hätte sich nach 1933 für das Neue Kurhaus eine Konkurrenz entwickeln können. Den beiden Hamburger Unternehmern KULLACK und WEINBERG gelang es allerdings nicht, im Alten Kurhaus den Badebetrieb fortzuführen.
Mit der Unterstützung der Rheumaheilstätte kaufte die Stadt 1934/35 die Liegenschaft „Altes Kurhaus“, um „die dort befindlichen Solequellen nicht in Privathand gelangen und damit eine Konkurrenz entstehen zu lassen“. Einige Jahre später übernahm die Rheumaheilstätte von der Stadt das alte Kurhaus.
Heute – 1981 – wird ein Teil der alten Badeanlagen für die Unterbringung von Personal der Rheumaklinik verwendet. Städtischer Grundbesitz sind die Flächen des ehemaligen Rügerparks und des Waldbades. Rheumaklinik und Stadt bemühen sich gemeinsam darum, hier rings um den alten Schwanenteich eine Parklandschaft entstehen zu lassen.
Eine großzügige Anbindung der Rheumaheilstätte von der Stadtseite aus ist leider unterblieben. So schlängelt sich noch heute der Verkehr durch das „Nadelöhr“ der Hambrücke über die AKN hinweg zu den Kuranlagen. Wie ganz anders wurde dieses Problem in anderen Bädern gelöst.

Die nahezu fertige Rheumaheilstätte, die im Herbst 1930 vollendet war . Der erste Patient wurde am 1. Februar 1931 aufgenommen.
Nach ihrem Vermögen hat die Stadt allerdings 1930 für den Ausbau der jetzigen Oskar-Alexander-Straße in sechs Meter Breite einen Zuschuß von 10 000 RM geleistet und dafür eine Anleihe aufgenommen.
Einige Monate zuvor hatte die Stadtverordnetenversammlung einem Stromlieferungsvertrag des städtischen Elektrizitätswerkes mit der Rheumaheilstätte zugestimmt. Es wurden Ausnahmetarife gewährt.
Ein guter Steuerträger ging für immer verloren
Auch in einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, die durch wechselseitige Beziehungen bedingt ist, bleibt es nicht aus, daß Interessenkollisionen auftreten. Jeder Partner hat in derartigen Situationen darauf bedacht zu sein, daß seine berechtigten Anliegen gewahrt bleiben, ohne allerdings die Partnerschaft zu gefährden. Im Miteinander von Rheumaheilstätte und Stadt trat ein Interessenkonflikt auf, als die Rheumaheilstätte als Krankenhaus die Gemeinnützigkeit und damit die Steuerfreiheit erhielt. Der Steuerausfall von jährlich 15 000 Mark brachte den Stadthaushalt von 270 000 RM im Jahre 1938 bedenklich ins Wanken. Ein „guter Steuerträger“, so 1939 der damalige Bürgermeister, war für immer verloren. Die Zeche hatten die Bürger zu zahlen, erhöht wurden die Bürgersteuer und die Grundsteuer.
Die Rheumaheilstätte hatte natürlich in Sachen Steuern ihren Part in jeder Weise zu wahren. Berechtigte Interessen lagen vor, als sie den Antrag auf Gewährung der Gemeinnützigkeit stellte und ihr die Steuerfreiheit aufgrund der gesetzlichen Gegebenheiten gewährt wurde.
Die Einsparung von 15 000 Mark Steuern bildete den Grundstock für den Bau eines Angestelltenhauses der „Rheuma“ und damit einen neuen Zankapfel mit der Stadt. Die noch in der Stadt wohnenden Angestellten der „Rheuma“ wurden zum Schaden der Stadt aus den Pensionen abgezogen. Der Bürgermeister sprach damals von nachteiligen Auswirkungen auf das Wirtschaftsleben der Stadt. Sein Antrag auf Erhöhung der Kurtaxe zum Ausgleich für die Steuerverluste wurde vom Oberpräsidenten nur zu einem kleinen Teil genehmigt.
Heute sollte man das Thema Steuerfreiheit der Rheumaklinik getrost in der Schublade versenken. Es ist eine gesetzliche Realität. An Auseinandersetzungen über das „liebe Geld“ sind schon Ehen und Freundschaften gescheitert. An endlosen Streitigkeiten ist der Bürger, der Hauptbeteiligte, wahrhaftig nicht interessiert.

Matthias Heesch – Begründer des Solbades Bramstedt. Er leitete 1879 die entscheidende, vierte Phase für den Kurort ein.
Blenden wir nochmals auf 1931, das Eröffnungsjahr des Neuen Kurhauses, zurück. In einer Versammlung des Bramstedter Fremdenverkehrsvereins trafen sich im März 1931 viele Bramstedter Bürger. In einem Bericht der „Bramstedter Nachrichten“ heißt es darüber: „Es sind schlechte Zeiten, das weiß jeder. Unserer Stadt ist durch das Geschenk der Rheumaheilstätte die Möglichkeit gegeben, die wirtschaftliche Lage wesentlich zu verbessern . . . Möge jeder bedenken, daß wir hier in Bramstedt vor dem Anfang einer neuen Entwicklung stehen und daß es auf jeden ankommt, ob wir die uns gebotenen Aussichten ausnutzen wollen oder nicht. Wenn wir jetzt nicht anpacken, dann geht uns vieles verloren, vielleicht alles.“
Einen Tag später wird in den „Bramstedter Nachrichten“ über einen Fremdenverkehrs-Vortrag von Bürgermeister ERLENBACH berichtet. Für die Fremdenverkehrswerbung müsse das erforderliche Geld durch den Zusammenschluß aller Bürger aufgebracht werden. „Nicht alle Fremden suchen gern ein großes Kurhaus auf, mancher wohnt lieber privat. Die Fremden werden unsere Gasthäuser, unsere Pensionen aufsuchen, bei Zimmervermietern anklopfen. Der Fremdenverkehr bringt unter Umständen mehr als die Industrie.“ „Unsere Nachkommen sollen uns einmal loben als einsichtige Menschen, die mit scharfem Blick erkannt haben, was für das Wohl der Stadt dienlich ist“, erklärte der Bürgermeister vor dem Fremdenverkehrsverein.
Das Wohl der Stadt, von der die Rede war, schloß 1931 ebenso wie in den nachfolgenden 50 Jahren einen kommunalen Kurbadbetrieb aus. Die Stadt hatte eine Fülle von Aufgaben zu bewältigen, die eine Übernahme von Aufgaben auf dem Kurbad-Sektor unmöglich machten. Die Stadt hätte sich sonst in ein finanzielles Abenteuer gestürzt. Das Sozialbad war seit 1925 vorhanden. Dank des Geschickes des Wirtschaftsdirektors Oskar ALEXANDER wurden nach dem Start der Rheumaheilstätte 1931 große wirtschaftliche Schwierigkeiten überwunden und durchgestanden.

Das alte Kurhaus – ein wertvolles Bild aus dem Bad Bramstedter Stadtarchiv
Auch bei der vierten Blüteperiode brauchte 1879 die Stadt nicht Pate zu stehen – 1681, 1761 und 1810 waren vorausgegangen. In der sogenannten Gründerzeit war es der privaten Initiative und dem Weitblick von Matthias HEESCH zu verdanken, daß er den Grundstock für die moderne Heilbadentwicklung in Bramstedt legte. Sie hat heute noch nach 100 Jahren Bestand. HEESCH vollzog auch die Umkehr von der Trink- zur Badekur. Nach seinem Tode im Jahr 1887 führten seine Kinder den Betrieb erfolgreich weiter und errichteten 1905 am Dahlkamp ein größeres Logierhaus. Behnkes Solbad kam 1911 als weiteres Unternehmen hinzu.
Inzwischen wurden Bramstedt 1910 die Stadtrechte verliehen, doch um den wichtigen Zusatz „Bad“ gab es Streitigkeiten. Sie wurden ausgerechnet vom Fleckensverordnetenkollegium ausgelöst. Zweimal lehnt es den Antrag der Altona-Kaltenkirchener Eisenbahn ab, die Station in Bad Bramstedt umzubenennen. Viele Güter waren irrtümlich nach Barmstedt geleitet worden. Als die Königliche Oberpostdirektion Kiel einen gleichlautenden Antrag stellte, kapitulierte das Fleckenverordnetenkollegium. Am 11. März1910 ist durch allerhöchsten Regierungserlaß die offizielle Ortsbezeichnung „Bad Bramstedt“ endlich perfekt.

Werbung für das Matthiasbad vor dem 1. Weltkrieg mit Pensionspreisen von 4 Mark bis 4.50 Mark
Die Wallfahrt zum rechten Heilbrunnen
Ein Engagement des Fleckens Bramstedt für eine Nutzung der Heilquellen ist während der drei Entdeckungs- und Wiederentdeckungsperioden der Jahre 1681, 1761 und 1810 nur für den letzten Abschnitt urkundlich belegt. Viel größer und weitgehender ist dafür der Einsatz des Staates, des dänischen Königs und seines Beamtenstabes.
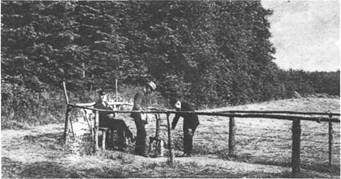
Pumpe auf der Brunnenwiese. Gastwirt Heinrich Fick ließ 1911 hier einen Brunnen bohren. Das gewonnene Wasser fand als „Roland-Sprudel“ starken Absatz
Die älteste Nachricht über die Entdeckung des Gesundbrunnens in der östlichen Feldmark des z.Fleckens Bramstedt im Jahre 1681 stammt vom Königlichen Propst des Amtes Segeberg, Dr. Christian v. STOECKEN in seiner Schrift ,,Gründliche Nachrichten wegen des Gesundbrunnens zu Bramstedt“. Mundpropaganda sorgte dafür, daß die Kunde von der Wunderheilung des Schweinehirten Gerd GIESLER und weiterer Heilungssuchender weithin im Holsteinischen, in Hamburg und darüber hinaus bekannt wurde.
Ein Unterkunftsproblem tauchte auf. Tausende waren im Flecken Bramstedt und den umliegenden Dörfern nicht unterzubringen. Für Quartier und Proviant blieb manche Mark im Flecken hängen, doch für die Masse wurden Zelte und Hütten rings um die Entdeckungsquelle errichtet. Als Propst v. STOECKEN seine berühmt gewordene Brunnenpredigt hielt, waren 3 000 Menschen von ihr fasziniert.
Von spektakulären Heilerfolgen berichtet eine zweite Schrift des Pröpsten: „Geistliche Wallfahrt zum rechten Heilbrunnen“. Der Chronik der Maria-Magdalenen-Kirche ist zu entnehmen, daß über 800 Menschen durch das heilende Wasser gesund wurden. Doch plötzlich ist die Quelle von 1681 vergessen.
Eine neue Wallfahrt zur Quelle begann ebenso plötzlich im März 1761. Aktiv wird darauf sofort der damalige Amtmann zu Segeberg, Conferenz- und Landrat von ARNOLD. Er berichtet dem Staatsminister v. BERNSTORFF nach Kopenhagen über den neuen Zulauf zur Quelle: „Es ist die Anzahl der Brunnengäste dergestalt angewachsen, daß hier im Flecken und in den nahe herumliegenden Dörfern für deren Bequemlichkeit kaum Platz vorhanden ist.“
Der Flecken und später die Stadt Bad Bramstedt haben sich im Verlauf von drei Jahrhunderten immer um die Lösung der Quartierfrage für viele Gäste kümmern müssen. Sie wurde vor allem in der vierten Blütezeit gelöst. Im gastfreundlichen Bad Bramstedt fanden viele nicht nur Aufnahme, sondern vor allem „Bequemlichkeit“. Dabei blieb natürlich so manche Mark in der Kasse der Quartierswirte.
Aktivitäten des Staates
Nach der Wiederentdeckung der Quelle im Jahr 1761 war der Staat, vertreten durch den königlichen Amtmann v. ARNOLD, schnell zur Stelle, um für Ordnung rund um den Brunnen, von Hunderten, mitunter Tausenden aufgesucht, zu sorgen. Plakatiert wurde eine Fünf-Punkte-Verordnung. Allein der Brunnenmeister darf das Heilwasser schöpfen. An der Quelle ist bereits ein Gebäude aufgerichtet worden. „Keiner soll sich auf eine umgestüme Art bey dem Brunnen betragen und Zänkereyen anfangen.“
Um die Rechte der königlichen Autorität, die sich laufend über die Wunderheilungen unterrichten ließ, zu sichern, wurde eine Wache von neun Mann und drei Unteroffizieren am Brunnen aufgestellt. Sie hatte sich täglich abzulösen.
Sicher ist das Leben im Flecken Bramstedt während der Entdeckungsperioden der Heilquellen durch den starken Zustrom der Gäste beeinflußt worden. Sehr hohe Spenden wurden im Armenstock der Kirchengemeinde in der Nähe der Quelle vereinnahmt. In drei Monaten sind nach Heilerfolgen spontan 2 022 Mark und acht Schillinge für die Armen gestiftet worden. Das war damals eine gewaltige Summe. Allerdings mußte der Armenstock auch dazu herhalten, für 461 Mark und acht Schillinge ein hölzernes Brunnenhaus und ein Wachhaus zu errichten.
Der Staat hat durch die königlichen Beamten alles versucht, um den Massenansturm in geregelte Bahnen zu bekommen. Unbekannt ist, warum der Zustrom fast über Nacht fünf Monate nach der Wiederentdeckung völlig abriß. Erneut geriet der heilkräftige Gesundbrunnen für fast 50 Jahre in Vergessenheit.
Aus der Sicht unserer Tage ist das große Engagement des Staates in der zweiten Entdeckungsperiode hervorzuheben. Der Staat hatte das Sagen und nicht die Männer des Bramstedter Fleckenskollegiums. Auch in der nächsten Periode, die 1810 beginnt, wird die königliche Regierung aktiv, um etwas für die „Vision eines Staatsbades Bramstedt“ zu tun. Eingefaßt wurden die Quellen, nachdem einige zusätzliche entdeckt worden waren, auf königliche Kosten. Die Quellen erhielten hölzerne Dächer, Wälle grenzten sie deutlich von der Umgebung ab. In der Nähe des alten Gesundbrunnens sollen zwei Badehäuser, mit je einer großen Badewanne, errichtet worden sein.
Kunst am Bau bereits im Jahr 1810
Der Flecken ist wach geworden. Es kommt 1810 zu einer spektakulären Petition dreier Bramstedter Ratsmänner an den Landesherrn, den dänischen König Friedrich VI. Anton SCHMIDT, Hans LAHRSEN und Hinrich STECKMEST haben die Zeichen der Zeit verstanden und bitten am 17. April 1810 den König, am Bramstedter Gesundbrunnen die nötigen Einrichtungen für die Bequemlichkeit der Kranken zu schaffen: „Die Kranken haben noch keine Bequemlichkeiten beim Gebrauch des Brunnens und der Bäder.“
Diese Petition kreuzte sich mit einem Privilegium des Königs an den Fleckenseingesessenen Johann HÜBNER, dem auf Antrag gestattet wurde, Brunnengebäude zu errichten. Im Privilegium wird sogar der Gedanke von „Kunst am Bau“ laut. HÜBNER darf „Künstler, Kunstsachverständige und andere Arbeiter zum Bau der Gebäude nach eigenem Gutdünken nehmen“. Zoll- und Abgabenfreiheit wurden gewährt. Doch zum Bau der vom König genehmigten Gebäude ist es nicht gekommen. Das Privilegium erlosch, falls von ihm nicht innerhalb von zwei Jahren Gebrauch gemacht wurde.
Oftmals wird aus früheren Zeiten und um 1810 davon berichtet, daß zahlreiche Brunnengäste im Freien nächtigen mußten. Der Flecken konnte Hunderte und Tausende einfach nicht zusätzlich fassen, denn Bramstedt hatte um 1810 etwa 1 000 Einwohner. Für die Jahrhundertmitte – etwa um 1855 – werden Ackerbau, die bürgerlichen Gewerbe und die Gastwirtschaften als die Haupterwerbszweige der Bramstedter Fleckensbewohner bezeichnet. „Verdursten“ brauchte niemand, denn es gab im Flecken bei 1 800 Einwohnern immerhin 40 Gasthäuser und Schenken sowie sechs Brenner und Brauer.
Zur Frage der Quartiere, die für den Ruf der Heilbäder stets eine eminente Bedeutung haben, sei ein Sprung um 70 Jahre von 1855 auf 1925 erlaubt. Ein damals von Direktor Oskar ALEXANDER herausgegebener Werbeprospekt nennt für das (alte) Kurhaus, zu dem damals die beiden Bäder vereinigt waren, die Zahl von 140 Betten. Sie kommen „den besten Privatbetten an Güte und Bequemlichkeit gleich. Seit den letzten Jahren hat das Kurhaus einen ausgesprochenen Sanatoriumscharakter“. Stolz ist man auf die Zahl von vier Ärzten – in den Jahren 1925/26. Jetzt – 1981 – sind in der Rheumaklinik 38 Ärzte tätig.
Im Prospekt heißt es weiter: „In den letzten Jahren steht das alte Kurhaus zwar vorwiegend den Krankenkassen zur Verfügung, jedoch werden, soweit Platz vorhanden ist, Privatgäste aufgenommen. Diese finden außerdem in dem nur wenige Minuten entfernten Städtchen in einer Reihe guter Pensionen bei sehr mäßigen Preisen vorzügliche Unterkunft.“ Soweit der Prospekt, der sich in erster Linie an die Hamburger wendet.

Für „Das moderne Rheuma- und Frauenbad seit 1681″ warb am Hamburger Hauptbahnhof um 1930 ein Verkehrspavillon. Die Werbung war erfolgreich, denn viele Hamburger kamen als Kurgäste nach Bad Bramstedt
Bad Bramstedt – das ist auch in der damals besonders aktiven Werbung ,,Das Bad vor den Toren Hamburgs“. In der Hansestadt wurde 1930 ein großer Werbekiosk ausschließlich für Bad Bramstedt eröffnet. Er warb für „Das moderne Rheuma- und Frauenbad seit 1681″. Die Kaltenkirchener Bahn gab Badefahrkarten mit 50 Prozent Ermäßigung aus, wobei ein Solbad frei war. Außer zu Tagesaufenthalten nutzten die Hamburger auch Wochenendkarten zu einem längeren Verweilen in Bad Bramstedt.
Für die Sache der Rheumaheilstätte warben kurz vor dem Zweiten Weltkrieg Chefarzt Dr. med. R. PAULUS und seine Abteilungsärzte. Sie suchten mehrfach im norddeutschen Raum Ärzte auf, um sie über die Möglichkeiten bei der Bekämpfung rheumatischer Leiden in Bad Bramstedt zu unterrichten. Aufgrund dieser Aktionen wurden viele Patienten zusätzlich in die Rheumaheilstätte eingewiesen. Ärzteinformationen erfolgten auch in der Klinik selbst.
Nach einem Vortrag vor norwegischen Ärzten im Osloer Reichshospital besuchte Chefarzt Dr. PAULUS in Skandinavien einflußreiche Mediziner. Diese Imagepflege der Rheumaheilstätte zahlte sich 1938 aus: Die Rheumaheilstätte hatte in diesem Jahr 203 Patienten aus Dänemark, Norwegen und Schweden.
Im Anhang ist die Fremdenverkehrsstatistik 1938 veröffentlicht: Patienten kamen aus allen deutschen Ländern und Provinzen nach Bad Bramstedt, mit Schwerpunkt natürlich aus Hamburg und Schleswig-Holstein. Die Tabelle zeigt auch die Beliebtheit vieler Privatpensionen, deren Gäste zum Teil sechs Wochen lang in der Pension wohnten.
390 000 Patienten
Sehr eindrucksvoll ist die Aufstellung über die Belegung der Rheumaheilstätte/ Rheumaklinik in den Jahren 1931 bis 1980 (siehe Anhang). Insgesamt wurden im genannten Zeitraum 385 968 Patienten gezählt. Darunter befinden sich 329 043 Versicherte, 40 156 Privatpatienten und aus der Zeit des Reservelazarettes der Wehrmacht (1939/1946) 16 769 Soldaten. Wird das Jahr 1981 mit acht Monaten berücksichtigt, dann haben in der Rheumaklinik in 50 Jahren über 390 000 Patienten Aufnahme gefunden.
In der Vorkriegszeit erlebte die Rheumaheilstätte nach Überwindung von Anlaufschwierigkeiten ab 1935 einen steilen Aufstieg. Er wirkte sich auf die ganze Stadt aus. Die Werbung, Vorreiter war der Fremdenverkehrsverein, wurde durch Erfolge belohnt.
Zwischen dem Kurhaus, der Stadt und den Vermietern kommt es in den folgenden Jahren zu einer intensiven, zugleich erfreulichen Zusammenarbeit. Schon 1936 werden Pauschalkuren mit Pensionen in der Stadt den Gästen angeboten. Sie umfassen 28 Tage Vollpension, entweder mit oder ohne Moorbäder, einschließlich ärztlicher Behandlung durch die Ärzte des Kurhauses. Mit Beginn des Zweiten Weltkrieges reißt die Entwicklung jäh ab, die Rheumaheilstätte wird Reservelazarett.
Vierzehn Jahre sollte es dauern bis ab 1. April 1953 die Rheumaheilstätte wieder vollständig der Behandlung Rheumakranker dienen konnte. Die Auflösung der Inneren und Chirurgischen Abteilung unter dem Leitendem Arzt Dr. ZEHRER löste in der Bramstedter Bevölkerung einen schweren Schock aus. Bad Bramstedt hatte plötzlich kein allgemeines Krankenhaus mehr. Neubau eines Krankenhauses in Bad Bramstedt oder Ausbau des Kaltenkirchener Vereinskrankenhauses? – diese Frage bewegte monatelang die Kreispolitiker. Die „Krankenhausschlacht“ erreichte 1953 im alten Segeberger Kurhaussaal ihren Höhepunkt. Zum Entsetzen der Bramstedter Vertreter gab der Kreistag in einer Kampfabstimmung Kaltenkirchen den Vorzug. Bad Bramstedt mobilisierte darauf alle Reserven, um wenigstens am Schlüskamp ein kleines Krankenhaus zu erhalten.

Im Bramstedter Schloß kann vieles bewundert werden. Die Aufnahme wurde allerdings bereits vor rund 100 Jahren gemacht.
In der Rheumaheilstätte ging es jedenfalls aufwärts (siehe Anhang). 1958 wird die Schwelle von 10 000 Aufnahmen überschritten. Für Bad Bramstedt werden bald 400 000 Übernachtungen im Jahr und mehr registriert, nur die Kurkrise der Jahre 1977/78 bringt einen vorübergehenden Abschwung.
Schleswig-Holstein ist in der Bundesrepublik das führende Fremdenverkehrsland. Zu seinen etwas ruhigeren Fremdenverkehrsorten zählt Bad Bramstedt. Es ist kein „Übernachtungsmillionär“, nimmt aber unter den Heilbädern und Kurorten des Binnenlandes eine führende Rolle ein. Seine Spitzenstellung liegt in der hohen Bettenauslastung mit durchschnittlich 235 Tagen im Jahr begründet. Die jahreszeitliche Unabhängigkeit bedeutet für alle Fremdenverkehrsbetriebe des Sol- und Moorbades Bramstedt einen Idealzustand.
Mit einem Angebot von 1 670 Betten liegt Bad Bramstedt unter 138 deutschen Heilbädern im Mittelfeld. Davon entfallen allein auf die Rheumaklinik 605 Betten. Die Klinik hat in der Stadt außerdem 240 Betten ständig belegt. Für Tagungen stehen 260 Betten bereit. Die restlichen 565 Betten, davon 212 in Privatquartieren, stehen dem allgemeinen Fremdenverkehr zur Verfügung.
Das Gastgewerbe stellt in Bad Bramstedt einen beachtlichen Teil der Arbeitsplätze und ist damit ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Bad Bramstedt ist weithin bekannt für das hohe Niveau der Gastronomie, für ein vielseitiges und preiswertes Angebot. Verfünffacht wurde in vergangenen 20 Jahren das Angebot von Hotelbetten; Pensionen und Privatvermieter standen mit Investitionen nicht nach. Ölkrise und der Rückgang der Kuren in den 70er Jahren brachten Rückschläge, führten aber in Sicht auf eine Qualitätssteigerung zu einer gewissen Auslese. Heute sind gute Privatzimmer inzwischen wieder Mangelware geworden. Ungeachtet von Abschwüngen sind Privatvermieter immer wieder das Risiko eingegangen, ihre Wohn- und Übernachtungsmöglichkeiten unter einem hohen Kostenaufwand zu verbessern. Sie tragen zum hohen Niveau des Bramstedter Fremdenverkehrsgewerbes bei.

Vorstellung im Kurhaustheater, das über 400 Plätze hat, die so eingerichtet sind, daß auch Behinderte das Theater besuchen können. Stadt Bad Bramstedt und Rheumaklinik bieten gemeinsam den Kurgästen ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm an
Bad Bramstedt gehört zweifellos zu den bedeutenden deutschen Rheumabädern, vor allem wegen der großartigen medizinischen Leistungen der Rheumaklinik. Als Schwerpunktklinik steht sie an der Spitze ähnlicher Einrichtungen in der Bundesrepublik. Rheumaforschung wird außer in Bad Bramstedt nur in den Rheumakliniken von Aachen und an Universitäten betrieben. Diese Faktoren führten dazu, daß die Rheumaklinik Bad Bramstedt oft als „größte deutsche Rheumaklinik“ bezeichnet wird.
Aus der Sicht des Bürgermeisters der Stadt Bad Bramstedt und zugleich des Gesellschafters der Rheumaklinik meine ich nach reiflicher Überlegung, es war ein kluger Schritt, die Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Rheumaheilstätte nicht von den Hauptnutzem – den Sozialversicherern – zu trennen. Bad Bramstedt hat in der Gesamtheit seines Fremdenverkehrs die Kurkrisen auch deswegen so gut durchgestanden, weil die Landesversicherungsanstalten und die Krankenkassen ihre Belegung in der Flaute nicht so stark zurücknahmen. Sie dachten dabei auch an die Wirtschaftlichkeit der Klinik. Andere Kurorte hatten die Rezession viel schwerer zu ertragen. Auf viele Betten wurde dort einfach verzichtet.
Die Versorgung mit Sole gehört zu den Verpflichtungen der Stadt gegenüber der Rheumaklinik. Genutzt wird allerdings noch heute, seit 1929, die eigene Moorsolequelle der Klinik aus 54 Meter Tiefe. Mit Erfolg wurde die bisher letzte Bohrung nach Sole von der Stadt 1977 am Raaberg niedergebracht. Die Sole mit 23 Prozent Salzgehalt wird per Pipeline zur Klinik gepumpt, um dort – wesentlich verdünnt – in den Bädern genutzt zu werden.
Lange bestand für die Klinik eine eigene Wasserversorgung. Seit 1980 besorgt das die Stadt, die umfangreiche Erweiterungen am Wasserwerk vornahm.
Ohne ausdrückliche Verpflichtung warben Stadt und Fremdenverkehrsverein um Gäste. Neue Motivationen ließen 1981 den Bürger- und Verkehrsverein Bad Bramstedt aktiv werden, um den Fremdenverkehr durch eine Zusammenarbeit mit den Medien zu mobilisieren. Für Werbungsmaßnahmen gibt die Stadt im Jahr 25000 bis 30000 DM aus. Die Stadt ist Mitglied des Deutschen Bäderverbandes, der in der Hauptsache Werbeträger der Bäderwirtschaft ist.
Das Bad mit einer 300jährigen Heilquellentradition ist vom Sozialminister des Landes offiziell am 28. September 1977 als Heilbad anerkannt worden. Das hatte wegen der Kurtaxe nur abgabenrechtliche Gesichtspunkte. Der Satz der Kurtaxe von zehn DM pro Person und Jahr ist sehr niedrig, außerdem wird den Sozialversicherungen eine Ermäßigung von 25 Prozent gewährt. Die vergleichsweise niedrige Kurtaxe ist natürlich für die Rheumaklinik ein günstiger Wettbewerbsfaktor. Allerdings unterhält die Rheumaklinik einen beträchtlichen Teil der Kureinrichtungen selber; sie liegen sonst oft in kommunaler Hand.
Das Kurtaxaufkommen der Stadt beträgt jährlich etwa 60 000 DM. Rund 80 000 DM werden allein für Kurveranstaltungen ausgegeben, die im Kurtheater der Rheumaklinik stattfinden. Die Rheumaklinik trägt aber mit dem Gebäude und seiner Bewirtschaftung einen Teil der Veranstaltungskosten.
Rückblick auf 300 Jahre Bramstedter Heilbadentwicklung
Wenn wir die 300jährige Geschichte der Bramstedter Heilquellen eng zusammengefaßt überblicken, haben wir ganz objektiv festzustellen, daß die vergangenen 50 Jahre (1931/1981) die erfolgreichsten in der Heilbadentwicklung der Stadt Bad Bramstedt waren.

Die Kurhaus-Haltestelle der Altona-Kaltenkirchener Eisenbahn (AKN) vor rund 50 Jahren. Immer war die AKN für den Antransport der Kurgäste wichtig. Verbilligte Fahrkarten gab die AKN für die Strecke Hamburg- Bad Bramstedt heraus. Auch heute noch ist die AKN für die An- und Abreise der Patienten der Rheumaklinik von Bedeutung. Geblieben ist wie vor 50 Jahren die an sich bescheidene Kurhaus-Haltestelle, wie es das Foto vom Sommer 1981 zeigt.
Es war bestimmt der richtige Schritt, 1929 für die Trägerschaft des Kurwesens eine GmbH zu gründen. Wohin wäre das Kurwesen gesteuert, wenn die Stadt eine Eigenentwicklung betrieben hätte? Im modernen Kommunal recht unseres Landes ist seit 1977 die Vorschrift verankert, nur dann ein kommunales Angebot zu schaffen, wenn der Zweck nicht besser und wirtschaftlicher auf andere Weise erfüllt werden kann. 1929 wurden Starthilfen – sie waren erheblich – von der Stadt für die Entwicklung des Kurwesens geleistet. Sie hatten gegenüber einer städtischen Eigenentwicklung Priorität. Diese Haltung hält noch heute nach über 50 Jahren durch. Expandiert ist inzwischen der Haushalt der Rheumaklinik auf über 40 Millionen DM, der Stadthaushalt beträgt etwa zehn Millionen DM. Bei einer städtischen Entwicklung des Kurwesens wäre eine nicht zu überbrückende Diskrepanz entstanden: Sicher zum Schaden der Bürger.
Zukunftsperspektiven für eine echte Kurstadt
An der Schwelle von 50 Jahren Gemeinsamkeit von Stadt und Rheumaklinik Bad Bramstedt, ist die Entwicklung von Zukunftsperspektiven für eine echte Kurstadt ein Gebot der Stunde. Bestandssicherungen und Qualitätsverbesserungen sind vorrangige Ziele der Stadt für die Rheumaklinik. Mit der Bauleitplanung wurde 1970 für das Kurgebiet – wie bereits 1928 – jede Fremdentwicklung ausgeschlossen. Gesichert wird durch einen Landschaftsplan die Erhaltung und Gestaltung der Landschaft im Kurgebiet.
Angesichts der Investitionen der Rheumaklinik in den Jahren 1973/1981 mit rund 60 Millionen DM ist der Nachholbedarf gerade der Stadt um so dringender. Die finanzielle Situation der Stadt schafft jedoch Barrieren, die nicht leicht wegzuräumen sind. Das Straßen- und Verkehrsnetz bedarf einer grundlegenden Neugestaltung. Die Klinik muß endlich straßenmäßig gut anzufahren sein. Vordringlich sind Parkprobleme an der Kurhaus-Haltestelle zu lösen. Der Katalog von Prioritäten der Qualitätsverbesserungen umfaßt außerdem Arbeiten an Kuranlagen wie Kurpark, Tiergehege, Wander- und Radwege, Ruheplätze, Aussichtspunkte, Spielplätze für Kinder der Besucher.

Der Gondelteich am Alten Kurhaus ist wahrscheinlich 1911 fertiggestellt worden. Schon damals spürten die Bad Bramstedter etwas von der „ Faszination des Wassers“, wie heute betont wird. Im Fremdenverkehrskonzept 1980 wird ausdrücklich betont, daß sich für Bad Bramstedt der Bereich „Freizeitaktivitäten“ wesentlich intensivieren läßt, wenn Wasserflächen geschaffen werden
Einwohnern und Gästen ist eine verkehrsberuhigte Innenstadt und eine landschaftlich interessante Fußgängerverbindung zwischen Kurgebiet und Stadtmitte anzubieten. Erfolgversprechende Ansätze sind bereits vorhanden. Der Reiz unserer ,.Kleinstadt im Grünen“ soll möglichst vielen erschlossen werden.
Der Fremdenverkehr gilt mehr und mehr als ein „Bollwerk der Stabilität“, vor allem dann, wenn er wie in Bad Bramstedt ein so gutes und festes Fundament besitzt. Daher gibt ein fremdenverkehrspolitisches Entwicklungskonzept des schleswig-holsteinischen Fremdenverkehrsverbandes dem Fremdenverkehr in Bad Bramstedt gute Chancen. Vorgeschlagen werden die Ausdehnung des Kurbereichs in östliche Richtung über die Schmalfelder Au und Freizeitangebote im Osterautal. Die „Faszination des Wassers“, die viele Menschen gerade heute in Kurorte lockt, müsse auch in Bad Bramstedt geschaffen werden, meint das Konzept. Das steigende Gesundheitsbewußtsein in der Bevölkerung läßt größere Erfolgsmöglichkeiten in Bad Bramstedt erwarten.
Die Rheumaklinik wird nicht nur in der Werbung oft als „Zugpferd“ oder als „Aushängeschild“ der Stadt Bad Bramstedt bezeichnet. Für mich ist sie etwas anderes: eine schmucke Visitenkarte, die sehr viele zum Verweilen in ganz Bad Bramstedt einlädt.
Die Stadt wird alles tun, um den guten Ruf dieser Klinik zu sichern. Möge sich der vor über 50 Jahren begonnene und so erfolgreiche Weg im gemeinsamen Bemühen von Rheumaklinik und Stadt Bad Bramstedt fortsetzen. Zum Wohle aller Beteiligten wird der Erfolg auf die Dauer dann sicher sein, wenn das gleiche Ziel immer im Blickfeld bleibt.
(65)
zurück
Horst ZIMMERMANN, Redakteur
Persönlichkeiten, die Bad Bramstedt prägten
Vom 16. bis zum 20. Jahrhundert
Die Beiträge in dieser Schrift wollen in erster Linie die gestaltenden Kräfte darstellen, die seit 300 Jahren auf das Bramstedter Kurwesen wirkten oder direkte Beziehungen zu ihm hatten. Es hieße den Charakter der Festschrift sprengen, wenn außerdem eine Fülle chronologischer Daten für den Ablauf einer 1100jährigen Geschichte Bramstedts aneinandergefügt würde. Wahrscheinlich ist 830/831 im Zuge des Wirkens von ANSGAR, des Apostels des Norden, in Bramstedt zusammen mit Kellinghusen und Wipenthorp-Faldera eine Kirche errichtet worden. Urkundlich ist das jedoch nicht belegt.
Seit nahezu 670 Jahren hat die Maria-Magdalenen-Kirche inmitten Bad Bramstedts „Menschen dieses holsteinischen Landes mitgeformt und ihrem Denken und Handeln einen unzerstörbaren Charakter aufgeprägt“, stellte der damalige Ministerpräsident Dr. LEMKE bei der 650-Jahr-Feier der Kirche fest. Der Bischof von Holstein, Dr. Friedrich HÜBNER, fügte hinzu, daß die Kirche vom ,.Schaffen, Glauben und Hoffen der Generationen vergangener Jahrhunderte“ zeuge.
Vom Schaffen in vergangenen Jahrhunderten zeugen viele Persönlichkeiten, die in Bad Bramstedt geboren wurden, nach Bramstedt zogen, für den früheren Flecken und später wertvolle Spuren hinterließen. Sie überdauerten oft nicht nur den Alltag, sondem mitunter Jahrhunderte. Längst nicht alle Persönlichkeiten können erwähnt werden.
Dirick Vaget schuf die Urzelle des Gutes
Bramstedts wechselvolle Geschichte spiegelt sich in der Geschichte des Gutes Bramstedt wider, das 1540 adliges Gut wird. In einer Urkunde „begnadet König CHRISTIAN III. Füh und seine unmündigen Brüder seinen und seines Vaters, König FRIEDRICH I., langjährigen Sekretär Caspar FUCHS mit den Gütern, die Dirick VAGET zu Bramstedt von König FRIEDRICH I. innegehabt hat“.
Der eigentliche Begründer des Gutes Bramstedt, das bis zum 19. Jahrhundert bestehen soll, ist also Dirick VAGET. Reichtum und Herrendienst waren die bestimmenden Faktoren für seinen Aufstieg in die ständisch höhere Schicht. ,,Kern seiner Macht“ war der große Grundbesitz in und um Bramstedt. Dirick VAGET trug den ehrenden Zunamen „VON BRAMSTEDT“. Er wird 1530 im Bramstedter Fleckensbuch als Bürgermeister bezeichnet. Erst nach 340 Jahren gab es diesen Titel in Bramstedt wieder. Ein jäher Tod ruft Dirick VAGET 1538 in der Höhe der Schaffenskraft ab.
Eine Romanze war es nicht

König Christian IV., der volkstümlichste dänische König. Wiebeke Kruse aus Föhrden-Barl bei Bramstedt
gebürtig.
Rund 100 Jahre später schenkte 1633 der dänische König CHRISTIAN IV. WIEBEKE KRUSE und ihren Erben das Gut Bramstedt, das zuvor erweitert worden war. Damals soll auch das Torgebäude entstanden sein, das heute allgemein als „Schloß“ bezeichnet wird.
Mitten in den Wirren des 30jährigen Krieges hatte das Leben der Wäscherin Wiebeke KRUSE aus dem Bramstedter Nachbardorf Föhrden-Barl eine entscheidende Wende bekommen. An einem Frühlingstag 1625 erblickte der damals 48jährige König CHRISTIAN IV. die 18jährige WIEBEKE. Der König ist von ihr beeindruckt. Sie holte das Einverständnis ihres Vaters ein und wurde Kammerjungfrau der Königin. Die Hauptbeteiligten einer Romanze sind CHRISTIAN IV. und WIEBEKE nicht. Der große Altersunterschied des Paares und die unterschiedliche soziale Herkunft sind unüberwindliche Hindernisse. Nach förmlicher Trennung von seiner zweiten Frau Christine wird Wiebeke KRUSE 1630 dem König zur „linken Hand“ angetraut. „Womit Wiebeke, um ehrlich zu bleiben, in Reihenfolge mindestens die dritte .linke‘ Frau Christian IV. war“, stellte ein Chronist fest.
Wiebeke betrachtete sich aber als rechtmäßige Gattin des Königs. Vom Hof in Kopenhagen aus bewirtschaftete sie das in erster Linie als königliches Gut geführte Bramstedter Gut. Anerkannt wurde sie auf dem Gut, wie Stadtarchivar Hans FINCK 1967 ermittelte, als eine Wohltäterin.
WIEBEKE KRUSE starb im April 1648 im 40. Lebensjahr. 71jährig war zuvor König CHRISTIAN IV. am 28. Februar 1648 verschieden.
Befreit von der Zwangsherrschaft
Zu den Persönlichkeiten, die Bramstedt entscheidend prägten, gehört der Fleckensvorsteher Jürgen FUHLENDORF, der 1685 den Flecken dank seiner Tapferkeit in einer dramatischen Befreiungstat, unterstützt von vielen Bewohnern, von der Zwangsherrschaft des Barons von KIELMANNSEGGE freikaufte.
König CHRISTIAN V. hatte aus Geldmangel das gesamte Amt Segeberg verpfändet. Baron von KIELMANNSEGGE erwirbt das Pfandrecht. Er verlangt von den Bramstedter Fleckensbewohnern Leistungen, die einer Leibeigenschaft gleichkommen. Die Ratmänner werden unter Druck gesetzt, fügen sich aber nicht, an der Spitze Jürgen FUHLENDORF.
Im Verlauf weiterer Auseinandersetzungen wird Jürgen FUHLENDORF niedergeschlagen und ins Gefängnis geworfen. Fast der ganze Flecken zieht auf den Gutshof, um den Fleckensvorsteher zu befreien, was gelingt. Nach vielen Verhandlungen kann unter zahlreichen Opfern der Flecken schließlich aus der Zwangsherrschaft freigekauft werden.
Die Fleckensgilde von 1677 erinnert noch heute an die Befreiungstat, wenn am Dienstag nach Pfingsten nach Sonnenuntergang um den Roland getanzt wird.
(67)
Am Rande der europäischen Literatur
Christian Günther Graf zu STOLBERG war Kammerherr und Amtmann des Amtes Segeberg. Das adlige Gut Bramstedt besaß er von 1751-1755. Der fortschrittliche Mann hob als Musterbeispiel späterer Bauernbefreiungen auf dem Gut die Leibeigenschaft auf.
Durch seine drei Kinder gelangt „Bramstedt im 18. Jahrhundert an den Rand europäischer Literatur“. Der älteste Sohn Christian Graf zu STOLBERG wurde am 15. Oktober 1748 in Hamburg geboren, in Bramstedt Friedrich Leopold Graf zu STOLBERG am 7. November 1950. Auguste Louise Gräfin zu STOLBERG erblickte am 7. Januar 1753 ebenfalls in Bramstedt das Licht der Welt.
Die Grafen STOLBERG waren mehr Übersetzer griechischer Epen als Dichter. Beide studierten in Göttingen und traten dort einem Zusammenschluß junger Dichter, dem „Hainbund“ bei. Es kam zu verschiedenen Begegnungen mit Johann Wolfgang GOETHE.

Friedrich Leopold Graf zu Stolberg
Mit dem Dichterfürsten unternahmen sie 1775 eine Reise in die Schweiz. Mit dabei war der gemeinsame Freund HAUGWITZ. Die jungen Menschen standen ganz unter dem Einfluß des Zivilisationskritikers ROUSSEAU „Zurück zur Natur“. Es ging darum, die Gesundheit zu erhalten, die heilsamen Kräfte des Wassers zu suchen, sich von der „Faszination des Wassers“ gefangennehmen zu lassen.
Wegen der Badelust GOETHES und der Grafen STOLBERG kommt es am Züricher See zu einem Skandal. Darüber schreibt GOETHE in „Dichtung und Wahrheit“ im 19. Buch: „Ich selbst will nicht leugnen, daß ich mich im klaren See zu baden mit meinen Gesellen vereinte, und wie es schien, weit genug von allen menschlichen Blicken. Nackte Körper jedoch leuchteten weit, und wer es auch mochte gesehen haben, nahm Ärgernis daran.“ Die vier nackt Badenden wurden kurz darauf an einer abgelegenen Stelle mit Steinen beworfen.
Beide Grafen STOLBERG hatten sehr enge Beziehungen zu KLOPSTOCK, dem Dichter des Messias. Ihre Schwester Auguste Louise Gräfin zu STOLBERG, ein „Bramstedter Kind“, ging auch in die Literaturgeschichte ein. Sie war die Vertraute GOETHES in der Zeit des Verlöbnisses mit Lili aus der Bankiersfamilie SCHÖNEMANN. Vor der Verlobung um 1775 schreibt GOETHE der „fremden Freundin Gustchen STOLBERG aufgewühlte Bekenntnisbriefe“. Die Gräfin heiratete 1783 den dänischen Minister Peter Graf Ernst zu BERNSTORFF.
Drei Mitglieder der Familie Graf STOLBERG – eng verwachsen mit Bramstedt: Begleiter des großen Dichterfürsten Goethe.
Ein „Weltmann“ zog sich nach Bramstedt zurück
Das Gut Bramstedt und damit auch das Schloß/ Torhaus haben im Verlauf von 450 Jahren 22 Besitzer gehabt. Unter ihnen befindet sich Professor Friedrich Ludwig Wilhelm MEYER, der das Gut 1796 für 40000 Taler erwarb. Am 1. September 1840 starb MEYER In Bramstedt. Seine Erben bekamen das Gut.

Professor Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer
Ein in seiner Form aufwendiges Grabmal gleich links neben dem Eingang der Maria-Magdalenen-Kirche erinnert an Professor MEYER.
Als „Harburger Meyer“ ist der in Harburg gebürtige – 28. Januar 1759 – in die Literaturgeschichte,zumindest als Nebenfigur, eingegangen. 1785 wurde er als 26jähriger außerordentlicher Professor der Philosophie und der Deutschen Literatur an der Universität Göttingen. Eine Brieffreundschaft verband ihn mit einer der geistreichsten Frauen ihrer Zeit, mit Caroline SCHELLING, geschiedene Schlegel. Caroline über Meyer 1780: „Seine edle Seele drückt sich auf seinem Gesicht so sehr aus und macht einem so sicher“. Geschildert wird der „Harburger Meyer“ als gutaussehender Mann, als Weltmann, der außerdem sehr belesen ist. – Jäh bricht die Freundschaft mit Caroline ab, es kommt zu einer Trennung für immer.
Prof. Friedrich Ludwig Wilhelm MEYER, der spätere Bramstedter Gutsbesitzer, im Urteil der Literaturgeschichte: ,,Der Weltmann, der reichbegabte Mann, ist in seinem 81 Jahre langen Leben nie imstande gewesen, ein Werk zu schreiben, das ihn überdauert. 13 dicke Bände, darunter viele Theaterstücke, waren schon bei Lebzeiten vergessen“.
Von Prof. MEYER stammt die Meyersche Stiftung. Sie besagt: „Sterbe ich als Besitzer des Gutes Bramstedt, so vermache ich der Bramstedter Armenkasse 500 Reichsthaler . . . und der Weddelbrooker Armenkasse gleichfalls 500 Reichsthaler. Nach dem Tod von Prof. MEYER wurden Arme aus Bad Bramstedt und Weddelbrook erstmals am 1. September 1841 mit Gaben aus der Stiftung bedacht.
Astronom Schumacher wieder entdeckt
Bad Bramstedter Heimatforscher hatten bisher das Wirken des in Bramstedt gebürtigen Astronoms Heinrich Christian SCHUMACHER nur oberflächlich in wenigen Zeilen geschildert. Wertvoll war für weitere Nachforschungen der Hinweis, daß in Hamburg/Altona eine Straße nach ihm benannt worden sei.
In jüngster Zeit ist das Leben von Heinrich Christian SCHUMACHER vor allem durch eine Arbeit von Lutz BRANDT, Hamburg, aufgehellt worden.

Astronom Heinrich Christian Schumacher, geboren am 3. September 1780 in Bramstedt
Heinrich Christian SCHUMACHER wurde am 3. September 1780 in Bramstedt geboren. Sein Vater war hier königlich-dänischer Kammerherr. Der Sohn verlebte in Bramstedt und in Segeberg seine Jugend.
Umfangreiche Studien der Mathematik und der Astronomie folgten. Es kam zu einer engen Verbindung mit dem berühmten bahnbrechenden Mathematiker und Direktor der Göttinger Sternwarte Carl Friedrich GAUSS (1777-1855). 1810 wurde SCHUMACHER Professor der Kopenhagener Universität und königlich-dänischer Konferenzrat. Der Astronom unternahm ab 1815 die sehr wichtige Gradmessung und Triangulation des dänischen Gesamtstaates; es folgten topographische Aufnahmen von Holstein, Hamburg und Lauenburg. „Im Treppenhaus des Segeberger Rathauses hängt ein Abdruck eines schönen Planes der Stadt und ihrer Umgebung aus dem Jahre 1825″ (Brandt, S. 25). Zu den Hauptwerken SCHUMACHERS zählt die Gründung der Altonaer Sternwarte an der Palmaille im Jahr 1821. Hier wirkte er rund drei Jahrzehnte und starb am 28. Dezember 1850.
Unter den Überresten des Heilig-Geist-Kirchhofes, ein Relikt der Hamburger Bombardierungen des 2. Weltkrieges, steht noch heute der Grabstein SCHUMACHERS und seiner Frau. Wenige Schritte davon entfernt wurde am Eingang des S-Bahnhofes Königstraße eine Gedenktafel für ihn angebracht. Der in den Boden eingelassene Altonaer Meridian erinnert an die Sternwarte Altona, Hauptwirkungsstätte des Astronomen SCHUMACHER, der aus Bramstedt stammte.
Johanna Mestorf: Vorkämpferin der Frauen
Bei der Würdigung von Persönlichkeiten, die in Bramstedt beheimatet waren, nimmt das Lebenswerk von Johanna MESTORF einen besonderen Platz ein. Sie wurde am 17. April 1928 in Bramstedt als Tochter des Arztes Jacob MESTORF geboren. Dank ihrer Persönlichkeit wurde Johanna MESTORF nicht nur eine große Forscherin auf dem Gebiet der Prähistorik. Ihr war es auch zu verdanken, daß den Frauen endlich akademische Berufe erschlossen wurden.
 Die Geschichtsforscherin verfaßte 1866 als Erstlingsarbeit ,,Wiebeke Kruse“. Aus dieser Arbeit ist ein tiefes Heimatgefühl ablesbar. Viele Jahre später schreibt sie als 76jährige an Pastor HÜMPEL: „Sie haben Recht, daß ich mein liebes Bramstedt sehr liebe“. 36 Jahre lang diente sie der prähistorischen Forschung. Ein für damalige Zeiten ungewöhnlicher Schritt erfolgte 1891. Minister v. GOSSLER berief eine Frau, Johanna MESTORF, zur Direktorin des Kieler Museums für vaterländische Altertümer. Damit nicht genug, wurde ihr zum 70. Geburtstag als ersten schleswig-holsteinischen Frau der Titel einer Professorin verliehen. Zum 80. Geburtsag schickte Kaiser WILHELM II. ihr sein Bild mit eigenhändiger Unterschrift – eine damals ungewöhnliche Ehrung für eine Frau. An Bramstedt erinnerte sich die Professorin oft. Sie setzte 1906 ein Legat für die Kirchengemeinde Bramstedt aus, um einmal im Jahr zwölf bedürftige Frauen in den Genuß einer „kräftigen Rindfleischsuppe mit Klößen kommen zu lassen“. Die Währungsschnitte haben 500 Goldmark des Legats inzwischen verschmelzen lassen. Johanna MESTORF starb 81jährig und wurde auf dem Friedhof zu Hamburg-Ohlsdorf begraben. Im Nachruf der Kieler Unviersität hieß es: „Aus dem Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit Schleswig-Holsteins drang durch sie manch heller Schein in die Gegenwart“.
Die Geschichtsforscherin verfaßte 1866 als Erstlingsarbeit ,,Wiebeke Kruse“. Aus dieser Arbeit ist ein tiefes Heimatgefühl ablesbar. Viele Jahre später schreibt sie als 76jährige an Pastor HÜMPEL: „Sie haben Recht, daß ich mein liebes Bramstedt sehr liebe“. 36 Jahre lang diente sie der prähistorischen Forschung. Ein für damalige Zeiten ungewöhnlicher Schritt erfolgte 1891. Minister v. GOSSLER berief eine Frau, Johanna MESTORF, zur Direktorin des Kieler Museums für vaterländische Altertümer. Damit nicht genug, wurde ihr zum 70. Geburtstag als ersten schleswig-holsteinischen Frau der Titel einer Professorin verliehen. Zum 80. Geburtsag schickte Kaiser WILHELM II. ihr sein Bild mit eigenhändiger Unterschrift – eine damals ungewöhnliche Ehrung für eine Frau. An Bramstedt erinnerte sich die Professorin oft. Sie setzte 1906 ein Legat für die Kirchengemeinde Bramstedt aus, um einmal im Jahr zwölf bedürftige Frauen in den Genuß einer „kräftigen Rindfleischsuppe mit Klößen kommen zu lassen“. Die Währungsschnitte haben 500 Goldmark des Legats inzwischen verschmelzen lassen. Johanna MESTORF starb 81jährig und wurde auf dem Friedhof zu Hamburg-Ohlsdorf begraben. Im Nachruf der Kieler Unviersität hieß es: „Aus dem Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit Schleswig-Holsteins drang durch sie manch heller Schein in die Gegenwart“.
Eine Generation lang Bürgermeister
30 Jahre lang wirkte Gottlieb Carl Christian FREUDENTHAL von 1879 bis 1909 als Bramstedter Bürgermeister. Der Anschluß Bramstedts an die Kaltenkirchener Bahn im Jahr 1898 ist sein Werk. Elektrifizierung des Ortes, Gründung einer Fleckenssparkasse, eines Krankenhausvereins und schließlich des Vereins für die Gründung einer höheren Privatschule sind wichtige Marksteine für die aktive Ortsentwicklung, die Gottlieb FREUDENTHAL betrieb. 40 Jahre lang war er Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr.

Bürgermeister Gottlieb Freudenthal
In seine Amtszeit fällt der Beginn der entscheidenden Badeentwicklung durch Matthias Heesch im Jahr 1879. Fast seherisch erwarb Freudenthal um 1890 rund 100 Morgen des Ödlandes an der Hambrücke vom Fiskus für ganze fünf Mark. Es wurde 1929/31 der Grundstock für die Rheumaheilstätte.
Der größte Teil des Ödlandes war bei der Verkoppelung um die Jahrhundertwende 1800 herrenlos geblieben und in Staatsbesitz gekommen. Tippelbrüder, auch Monarchen genannt, sorgten dafür, daß Zug um Zug eine Aufforstung in Gang kam. Die Tippelbrüder arbeiteten damit Kost und Unterkunft ab, die ihnen in einer Bramstedter „Verpflegungsstation“ gewährt worden war.
Ein Leben für das Kurbad
,,In Würdigung der Opfer des Faschismus und in Anerkennung der Verdienste eines dieser Opfer um die Stadt Bad Bramstedt haben die Gemeinderäte einstimmig beschlossen, die Straße von der Segeberger Straße ab bis zur Hohenstegener Brücke, soweit sie bebaut ist, als Oskar-Alexander-Straße zu benennen“ – diesen Beschluß faßte am 11. November 1947 die Bad Bramstedter Stadtverordnetenversammlung.
Geehrt wurde damit Oskar ALEXANDER, geboren am 29. Oktober 1881 in Visselhövede/Lüneburger Heide, ein Mann, der bereits 1919 die entscheidenden Weichenstellungen für die Bad Bramstedter Heilbadentwicklung vorgenommen hatte.

Oskar Alexander
Die Verfasser dieser Festschrift bemühten sich mit Erfolg, den Lebensweg Oskar ALEXANDER aufzuhellen. In den Akten der Rheumaklinik fand sich ein Schreiben von Oskar ALEXANDER, datiert am 19. Februar 1936, gerichtet an den „Stellvertreter des Führers“, Reichsminister Rudolf HESS. Es beweist in tragischer Weise den Mut des Mannes, der als Jude aktiv am 1. Weltkrieg teilnahm und mehrere Kriegsauszeichnungen erhalten hatte: Eisernes Kreuz II. Klasse, Frontkämpferabzeichen, Hanseatenkreuz und für eine schwere Verwundung das Verwundetenabzeichen.
Der Grund des Schreibens an Rudolf HESS: „Der Vorsitzende der Rheumaheilstätte GmbH, der Präsident der Landesversicherungsanstalt der Hansestädte Lübeck, Herr Dr. STORCK, ist in der letzen Zeit angegriffen worden, weil er mit mir, einem Nichtarier, den Pachtvertrag für das Neue Kurhaus bis 1940 verlängert hat“. Das ist mir unerträglich, deshalb „wende ich mich an Sie im Vertrauen auf Ihre geäußerte Bereitsamkeit, jeden Deutschen anzuhören“.
Oskar ALEXANDER schilderte Rudolf HESS seinen ideellen und materiellen Einsatz für die Heilbadentwicklung Bad Bramstedt. Er war von 1919 bis 1930 Pächter des Alten Kurhauses und schuf 1919/1931 die Voraussetzungen für die Rheumaheilstätte GmbH und den Bau des großen Hauses.
In dem sechs Seiten langen Schreiben bittet Oskar ALEXANDER, „eine klare Entscheidung zu fällen. Wenn die oberste Instanz glaubt, daß ich (als Jude Anm. d. Verfassers) weiter als Pächter hier tätig sein kann, so ist damit allen Angriffen die Spitze abgebrochen“.
Unbekannt ist, ob Rudolf HESS das Schreiben von Oskar ALEXANDER beantwortet hat. Wir wissen nur, daß Oskar ALEXANDER zum 31. Mai 1936 seine Tätigkeit als Pächter wenige Monate später für immer aufgeben mußte. Sein Einsatz für Deutschland im Ersten Weltkrieg wurde in keiner Weise gelohnt.
Bei der 25-Jahr-Feier der Rheumaheilstätte würdigte der langjährige Vorsitzende des Vorstands der ehemaligen Landesversicherungsanstalt, Präsident HELMS, das Wirken von Oskar ALEXANDER. Beim Start habe die Rheumaheilstätte bereits 1931 eine schwere Wirtschaftskrise durchstehen müssen. Es sei das Verdienst des ersten wirtschaftlichen Leiters, Direktor Oskar ALEXANDER, gewesen, daß diese Krise gemeistert wurde. Der Betrieb wurde mustergültig geführt. „Er setzte seinen persönlichen Kredit ein, warb private Kunden, übernahm zeitweise den Betrieb und damit das Risiko als Pächter.“
Präsident HELMS weiter wörtlich: „Dem trefflichen Mann, der als Volljude im Lazarett des Konzentrationslagers Oranienburg am 25. Januar 1942 (als 61jähriger) an Lungenentzündung starb, sei im Rückblick auf jene Zeit der Sorge und Not auch an dieser Stelle gedankt“.
Im Haus „Alexander“, wie das „Neue Kurhaus“ jetzt offiziell heißt, erinnert im Haupteingang eine Tafel an den ehemaligen Verwaltungsdirektor Oskar ALEXANDER.
(72)
zurück
Anhang
Literatur
Brandt, Lutz: Heinrich Christian Schumacher in Heimatkundliches Jahrbuch des Kreises Segeberg 1980
Goethe, Johann Wolfgang: Dichtung und Wahrheit
Hahn-Gernat von Schönfels: Wunderbares Wasser, Aarau/Schweiz 1980
Hans Kasper
Harbeck, Hans-Hinrich: Chronik von Bramstedt, Hamburg 1959
Heimatkundliche Jahrbücher des Kreises Segeberg seit 1956
Kähler, Johann: Das Stör-Bramautal, Kellinghusen 1905
Kleßmann. Eckart: Das Leben der Caroline Michaelis Böhmer – Schlegel – Schelling, München 1979
Landesarchiv Schleswig: 66 Folien Bramstedter Gesundbrunnen betreffend 1761-1810
Mestorf, Johanna: Wiebeke Kruse, Hamburg 1866
Prange, Dr. Wolfgang: Entstehung und innerer Aufbau des Gutes Bramstedt, ZSHG Neumünster 1966
Puls Dieck: Erste Berichte von den Bramstedter Quellen in „Die Heimat“ 73. Jahrgang 1966 Neumünster
Röstermundt, Max: Dad Bramstedt – Der Roland und seine Welt, Neumünster 1952
Sach, Prof. August: Vaterländisches u. Norddeutsches Lesebuch, Halle 1885
Schadendorf, Jan-Uwe: Alt-Bramstedt im Bilöd, Bad Bramstdt 1978
Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung seit 1927
25 Jahre Rheumaheilstätte Bad Bramstedt – Festschrift – 1956
Rheumaklinik Bad Bramstedt – Zentralbau – 1980
Bramstedter Nachrichten seit 1881 und folgende
Akten der Rheumaheilstätte / Rheumaklinik Bad Bramstedt seit 1931
(74)
Aufstellung über die Belegung der Rheumaheilstätte Bad Bramstedt
in den Jahren 1931 – 1980
| Belegung mit |
|
Belegung mit |
| Jahr |
Versicherten |
Privaten |
Soldaten |
zusammen |
|
Jahr |
Versicherten |
Privaten |
Soldaten |
zusammen |
| 1931 |
2 464 |
– |
– |
2 464 |
|
1957 |
8 302 |
1 004 |
– |
9 306 |
| 1932 |
1 513 |
439 |
– |
1 952 |
|
1958 |
9 089 |
1 066 |
– |
10 155 |
| 1933 |
1 461 |
791 |
– |
2 252 |
|
1959 |
9 519 |
1 170 |
– |
10 689 |
| 1934 |
2 915 |
663 |
– |
3 578 |
|
1960 |
9 650 |
1 142 |
– |
10 792 |
| 1935 |
2 939 |
715 |
– |
3 654 |
|
1961 |
9 659 |
1 172 |
– |
10 831 |
| 1936 |
3 228 |
611 |
– |
4 039 |
|
1962 |
9 549 |
1 093 |
– |
10 642 |
| 1937 |
3 782 |
767 |
– |
4 549 |
|
1963 |
9 453 |
1 055 |
– |
10 508 |
| 1938 |
4 267 |
824 |
– |
5 091 |
|
1964 |
9 979 |
1 075 |
– |
11 054 |
| 1939 |
3 614 |
829 |
81 |
4 524 |
|
1965 |
10 044 |
1 171 |
– |
11 215 |
| 1940 |
2 695 |
832 |
860 |
4 387 |
|
1966 |
10 137 |
1 085 |
– |
11 222 |
| 1941 |
3 260 |
775 |
804 |
4 839 |
|
1967 |
10 174 |
1 094 |
– |
11 268 |
| 1942 |
216 |
37 |
2 715 |
2 968 |
|
1968 |
9 976 |
1 250 |
– |
11 226 |
| 1943 |
– |
– |
3 454 |
3 454 |
|
1969 |
9 940 |
1 166 |
– |
11 106 |
| 1944 |
– |
– |
3 500 |
3 500 |
|
1970 |
10 101 |
1 097 |
– |
11 198 |
| 1945 |
414 |
42 |
4 230 |
4 686 |
|
1971 |
10 277 |
1 139 |
– |
11 416 |
| 1946 |
5 269 |
839 |
1 125 |
7 233 |
|
1972 |
10 240 |
896 |
– |
11 136 |
| 1947 |
5 022 |
1 202 |
– |
6 224 |
|
1973 |
10 502 |
852 |
– |
11 354 |
| 1948 |
4 489 |
1 306 |
– |
5 795 |
|
1974 |
10 577 |
675 |
– |
11 252 |
| 1949 |
4 955 |
923 |
|
5 878 |
|
1975 |
10 294 |
548 |
– |
10 842 |
| 1950 |
4 622 |
676 |
– |
5 298 |
|
1976 |
8 927 |
342 |
– |
9 269 |
| 1951 |
4 855 |
740 |
|
5 595 |
|
1977 |
9 214 |
304 |
– |
9 518 |
| 1952 |
5 289 |
942 |
– |
6 231 |
|
1978 |
9 064 |
369 |
– |
9 433 |
| 1953 |
6 275 |
1 063 |
– |
7 338 |
|
1979 |
9 082 |
296 |
– |
9 378 |
| 1954 |
6 692 |
1 246 |
– |
7 938 |
|
1980 |
9 654 |
217 |
– |
9 871 |
| 1955 |
7 284 |
1 377 |
– |
8 661 |
|
Sa. |
329 043 |
40 156 |
16 769 |
385 968 |
| 1956 |
8 120 |
1 039 |
– |
9 159 |
|
|
Versicherte |
Private |
Soldaten |
insgesamt |
Anmerkungen:
25. 8.1939 – 30. 1.1946: Wehrmachtslazarett mit zunächst teilweiser, ab 1.2.1942 voller Inanspruchnahme sämtl. Betten.
1. 2.1946 – 19.10.1946: Influx- und Hilfskrankenhaus für den Kreis Segeberg mit 700 Betten.
20.10.1946 – 31. 3.1953: Allgemeines Krankenhaus mit 550 Betten – ab Frühjahr 1947 jedoch 150 und ab Oktober 1948
mehr als 400 Betten für Rheumakranke -.
1. 4. 1953: Wiederverwendung in vollem Umfang für Rheumakranke.
(75)
Fremdenverkehrsstatistik 1938
| Betrieb |
|
Gäste |
Übernachtungen |
|
|
|
|
|
|
| Rheumaheilstätte GmbH |
5 090 |
146 998 |
|
| davon (Ausquartierte) |
|
(16 443) |
|
| Hotel Rolandseck. Bleeck 2 |
220 |
220 |
|
| Hotel Holsteinisches Haus. Bleeck 1 |
503 |
658 |
|
| Heinrich Freese, Maienbeeck 23 |
25 |
33 |
|
| Max Fick, Mühlenstraße 25 |
7 |
77 |
|
| Hermann Harms, Bleeck 25 |
105 |
105 |
|
Wilhelm Therkorn, Altonaer Str. 37
(ab 1. 8. 1938 Karl Bockwoldt) |
91 |
97 |
|
| Anna Köhncke. Butendoor 42 |
44 |
608 |
|
| Friedrich Fick, Bleeck 29 |
118 |
190 |
|
| Hans Rathje, Landwg 6 |
250 |
250 |
|
| K. Hesebeck, Bleeck 28 |
98 |
2386 |
|
| Robert Hauschildt, Lohstücker Weg 13 |
60 |
1253 |
|
| Diedrich Wesselmann. Kirchenbleeck 8 |
22 |
24 |
|
| H. Lesch, Zum Stadtwald 20 |
20 |
306 |
|
| Heinrich Rave, Butendoor 6 |
29 |
496 |
|
| O. Heckert, Altonaer Str. 53 |
7 |
302 |
|
| Pension Clausen, Altonaer Str. 64 |
4 |
70 |
|
|
zusammen |
6.693 |
154.073 |
|
| dazu Jugendherberge |
|
45 |
45 |
|
| sonstige Herbergen und Masssenquartiere |
|
267 |
267 |
|
|
insgesamt |
7.005 |
154.385 |
|
| 2 Herkunft der Gäste |
3. Herkunft der
ausländischen Gäste |
|
|
| Herkunftsland |
Gaste |
Herkunftsland |
Gäste |
Über-
nachtungen |
| Groß Hamburg |
2 921 |
Dänemark |
151 |
963 |
| Schleswig-Holstein |
1692 |
Norwegen |
26 |
29 |
| Stadt Berlin |
430 |
Schweden |
26 |
6 |
| Prov Hannover |
420 |
Niederlande |
17 |
17 |
| Ausländer |
235 |
England |
3 |
3 |
| Land Bremen |
201 |
Schweiz |
3 |
20 |
| Land Mecklenburg |
152 |
Balten-Länder |
3 |
3 |
| Rheinprovinz |
124 |
Griechenland |
2 |
2 |
| Land Oldenburg |
85 |
Argentinien |
2 |
2 |
| Provinz Pommern |
53 |
Tschechoslowakei |
2 |
2 |
| Prov. Brandenburg |
46 |
zusammen |
235 |
1 067 |
| Land Thüringen |
46 |
|
|
|
| Prov. Schlesien |
42 |
|
|
|
| Prov. Westfalen |
39 |
|
|
|
| Provinz Sachsen |
37 |
|
|
|
| Provinz Ostpreußen |
31 |
|
|
|
| Land Braunschweig |
25 |
|
|
|
| Land Bayern |
20 |
|
|
|
| Land Sachsen |
0 |
|
|
|
| Provinz Hessen-Nassai |
20 |
|
|
|
| übrige deutsche Provinzen und Länder |
54 |
|
|
|
| zusammen |
6.693 |
|
|
|
(76)
a) Analyse der Moorsolequelle am Lohstücker Weg
| Kationen: |
Gramm in 1 Liter bei 18° |
| Kalium-Ion |
K |
0,1127 |
|
| Natrium-Ion |
Na |
1,3100 |
|
| Calcium-Ion |
Ca |
0,0476 |
|
| Magnesium-Ion |
Mg |
0,0066 |
|
| Eisen-(Ferro)-Ion |
Fe |
0,0043 |
|
| Aluminium-Ion |
AI |
0,0047 |
|
| Anionen: |
|
|
|
| Chlor-Ion |
Cl |
2,1530 |
|
| Sulfat-Ion |
SO4 |
0,0512 |
|
| Hydrocarbonat-Ion |
HCO3 |
0,1035 |
|
|
Summe |
3,7936 |
|
| Meta-Kieselsäure |
H2Si03 |
0,0298 |
|
| Organische Stoffe: |
|
|
|
| kolloidal gelöste Huminsauren |
0,0727 |
0,2463 |
| molekulardisperse Huminsäuren |
0,1736 |
| organischer Rest und bei 105° |
|
|
| nicht flüchtiges Wasser |
|
0,1009 |
|
|
Gesamtsumme |
4,1706 |
|
2. Oktober 1936
Preußische Geologische Landesanstalt gez. Prof. Henseler
(77)
b) Analyse der 1967 erschlossenen neuen Solequelle
| In 1 kg der Sole sind enthalten: |
Milligramm |
Millival |
Millival.% |
| Kationen |
Kalium-Ion (K +) |
14,9 |
0.38 |
0,10 |
|
Natrium-Ion (Na +) |
8.720 |
379,13 |
98,57 |
|
Calcium-Ion (Ca++) |
57,3 |
2,86 |
0,74 |
|
Magnesium-Ion (Mg++) |
16,3 |
1,34 |
0,35 |
|
Kationendifferenz |
|
0.91 |
0,24 |
|
|
|
384,62 |
100,00 |
| Anionen |
Chlorid-Ion (Cl-) |
13.500 |
380.77 |
99,00 |
|
Phosphat-Ion (PO4— ) |
0,26 |
0,01 |
0,00 |
|
Sulfat-Ion (SO4– ) |
30,0 |
0.62 |
0,16 |
|
Hydrogencarbonat-Ion
(HCO3-) |
196,2 |
3,22 |
0.84 |
|
|
22.534,96 |
384.62 |
100,00 |
|
|
|
Millimol |
|
| Kieselsäure, meta (H2SiO3) |
26.0 |
0,33 |
|
| Kohlensäure, frei (CO2) |
12,4 |
0,28 |
|
|
|
22.573,36 |
|
|
8, Mai 1967 Städtisches Laboratorium Kiel, gez. Dr. Heinke
( 78)
c) Analyse der 1977 erschlossenen neuen Solequelle am Raaberg
| Kationen |
Milligramm / kg |
Millival/kg |
Millival-% |
| Lithium {Li+) |
0,35 |
0,0504 |
0,001 |
| Natrium (Na+) |
78.310 |
3.406 |
97,20 |
| Kalium (K+) |
206,30 |
5.276 |
0,15 |
| Rubidium (Rb+) |
0.02 |
0,00023 |
_ |
| Ammonium (NH4+) |
0.14 |
0,0078 |
_ |
| Magnesium (Mg2+) |
231.10 |
19,02 |
0,54 |
| Calcium (Ca2+) |
1.462 |
72,95 |
2,08 |
| Strontium (Sr2*) |
29,90 |
0,6825 |
0,02 |
| Barium (Ba2+) |
0,021 |
0,0003 |
– |
| Mangan (Mn2+) |
0,45 |
0,0164 |
– |
| Eisen (Fe2+/3+) |
3,10 |
0,1110 |
0,003 |
| Aluminium (Al3+) |
0.12 |
0.0133 |
– |
|
|
3.504 |
100.0 |
| Anionen: |
|
|
|
| Fluorid (F–) |
0,45 |
0.0237 |
0,001 |
| Chlorid (C1-) |
121.090 |
3.416 |
97,48 |
| Bromid (Br -) |
11.1 |
0,1389 |
0.004 |
| Jodid (J -) |
0,91 |
0,0072 |
_ |
| Sulfat (SO42-) |
4.143 |
86,26 |
2,46 |
| Hydrogenphosphat (HPO42-) |
) 0,012 |
0,0003 |
_ |
| Hydrogencarbonat (HCO3-) |
123,9 |
2.03 |
0,06 |
| Summe: |
205.613 |
3.504 |
100,0 |
| Undissoziierte Stoffe: |
|
|
|
|
|
Millimol/kg |
|
| Kieselsäure (meta, H2SiO3) |
2,70 |
0.035 |
|
| Borsäure (meta. HBO2) |
12,40 |
0.283 |
|
| Summe: |
205.628 |
|
|
12. September 1980
Institut Fresenius, Bad Schwalbach
(79)
Personenregister
A
Alexander, Herbert, Geschäftsführer der Rheumaklinik (1967-1976). 30
Alexander, Oskar, Mitbegründer des Kurbades Bad Bramstedt (1920-1936). 28, 56, 59, 71/72
Ansgar, Apostel des Nordens (9. Jahrhundert). 66
Arnaldo de Villanova, Prof., (um 1235-1313). 11
Arnold, von – Segeberger Amtmann (1761). 17, 58
Arrhenius, Svante (1859-1927). 16
Asklepiades, Badearzt (100 v. Chr.). 10
Augustus, röm. Kaiser (63 v.-14 n. Chr.). 8
B
Berger, Johann Christian von, Kieler Arzt (18. Jahrhundert). 19
Bernstorff, Johann Hartwig Ernst Graf zu, dän. Minister (1712-1772). 18, 19, 20
Bernstorff, Peter Andreas Graf zu, dän. Minister (1735-1797). 21,58
Bernstorff, Christian Günther Graf zu, dän. Minister (1769-1835). 21
Binzus, Gerhard, Rheumaforschung Bad Bramstedt. 32
Blobel, Hans, Geschäftsführer der Rheumaheilstätte Bad Bramstedt (1934-1966). 30
Blondel, Franciscus, Badearzt (1613-1703). 15, 16
Bluhm, Dr. Gerhard, Gesellschafter d. Rheumaklinik Bad Bramstedt. 37
Bock, Hans Erhard. 16
Boyle, Robert, engl. Chemiker (1627-1691). 15
Brandt, Lutz, Schriftsteller. 69
Buchholz, Prof. Dr. 33
Buess, Heinrich. 9
C
Caroline Mathilde, dän. Königin (1751-1775). 20
Cassiodor (455-526). 11
Chardin, Jean Baptiste, franz. Maler (1699-1779). 19
Christian I., dän. König (1426-1481). 17
Christian III., dän. König (1503-1559). 66
Christian IV., dän. König (1577-1648). 48, 67
Christian VII., dän. König (1749-1808). 20
Cilano, Johann Christian Maternus de, Arzt. Prof. der Physik (1696-1773). 18, 19, 20
Constantin, der Große, röm. Kaiser (306-337). 10
Cramer, Johann Andreas (18. Jahrhundert). 19
D
Dettmer Dr. (Rheumaforscher). 32
E
Eberwein, Peter O., Kreisbaudirektor a. D. (1968).
Erlenbach, Bramstedter Bürgermeister (1931). 56
F
Falloppio, Gabriele, ital. Anatom (1523-1562). 15
Feindt, Karl, Architekt (1929-1931). 24, 28
Finck, Hans, Stadtarchivar um 1970. 66
Fischer, Anton (Rheumatologe (1931). 26
Freudenthal, Gottlieb, Bramstedter Bürgermeister (1879-1909). 71
Friedrich 1., dän. König (1471-1533). 66
Friedrich II., Hohenstaufenkaiser (1194-1250). 11
Friedrich II., der Große, preuß. König (1712-1786). 19
Friedrich V., dän. König (1723-1766). 18, 19
Friedrich VI., dän. König (1768-1839). 21, 58
Fries, Lorenz (1519). 15, 18
Fuchs, Caspar, königl. Sektretär und Gutsherr (1540). 65
Fuhlendorf, Jürgen, Fleckensvorsteher (17. Jahrhundert) 67
G
Gatzweiler Dr., Abt.-Arzt (1935). 29
Gauss, Carl-Friedrich, Mathematiker (1777-1855). 70
Gebhardt, Heinrich, Bramstedter Bürgermeister (1950-1964). 51
Gehlen Dr., Chefarzt (1952). 32, 33
Gessner, Conrad, Züricher Arzt (1516-1565). 15
Giesler, Gerd, Entdecker der Bramstedter Heilquelle (1681). 58
Goethe. Johann Wolfgang (1749-1832). 15. 16, 18, 19, 68
Gossler von, Minister (um 1900). 71
Graf, Urs (1485-1527). 15
Grauer Dr. 23
Grossekettler Dr., Abt.-Arzt (1935). 29
H
Haas Dr. Abt.-Arzt. 36
Hagedorn, Friedrich von (1708-1764). 18
Hagelstein Dr., Franz (1813). 23
Harbeck, Hans Hinrich (1863-1950). 17
Hart, Prof. Dr. 33
Hartmann, Fritz (1978). 16
Haugwitz, Reisebegleiter Goethes (1775). 68
Hechelsfeldt, Hechel von, Licentiat (1761). 18, 24
Hebbel, Friedrich, Dichter (1813-1863). 20
Heesch, Matthias, Begründer des Alten Kurhauses (1879). 23, 54 ff., 71
Helmont, van. 15 Helms, Präsident (1956). 28, 72
Hensler, Philipp Gabriel, Arzt (1773-1805). 20, 21
Heß, Rudolf, Reichsminister (1933-1941). 72
Hjärne, Urban, schwed. Chemiker (1641 -1724). 15
Horaz, röm. Dichter (65-8 v. Chr.). 18
Hübner, Dr. Friedrich, Bischof (1965-1981). 66
Hübner, Johann, Bramstedter Unternehmer (1810). 59
Hümpel, Pastor in Bramstedt (1904). 69
Hufeland, Christoph Wilhelm, Arzt, Prof. (1762-1836). 16
J
Jessen, Larenz (1681). 17, 49
Johannes XXIII.. Papst (um 1415). 12
Josenhans, Dr. Gerhard, Ärztl. Direktor der Rheumaklinik. 41
K
Karl d. Große (742-814). 11
Kielmannsegge, Baron von ( 17. Jahrhundert). 67
Klopstock, Friedrich Gottlieb, Dichter (1724-1803). 9. 18, 19, 68
Köhler, Dr. P., Geheimer Sanitätsrat (1938). 27
Krane, Dr. Wilhelm, Prof. (1948). 30
Küster, Dr., Abt.-Arzt. 36
Kullack, Unternehmer (1920). 54
L
La Fontaine, franz. Fabeldichter (1621-1695) 18
Lahrsen, Hans, Bramstedter Bürger (1810). 59
Lemke, Dr. Helmut, Ministerpräsident a. D., Landtagspräsident (1966). 66
Lessing, Gotthold Ephraim, Dichter und Kritiker (1729-1871). 18, 20
Ludwig XV.. franz. König (1710-1774). 19
M
Mestorf, Jacob, Arzt (1825). 70
Mestorf, Johanna, Professorin, Forscherin (1828-1909). 70/71.
Meyer, Friedrich Ludwig Wilhelm, Prof. (1759-1840). 68, 69
Meyer, Günther, Gesellschafter der Rheumaklinik. 37
Montespan, Francoise, Marquise de, Geliebte Ludwig XIV (1641 – 1707). 15
N
Napoleon I., franz. Kaiser (1769-1821). 21
Niebuhr, Carsten, Forschungsreisender (1733-1815). 19
O
Ott, Victor. 16, 25
P
Paracelsus, Naturforscher, Arzt (1493-1541). 15, 18, 25
Paulus. Dr.. Chefarzt (1935). 29ff, 59
Pietro da Tossignano, oberital. Arzt (15. Jahrhundert), 11
Pfaff, Christoph Heinrich, Prof. (1773-1852). 23
Pindar, griech. Dichter (518-438). 9
Plato, griech. Philosoph (428-348). 9
Plinius, röm. Schriftsteller (23-79) 8. 10
Poggio, Gian Francesco, Papst-Begleiter (1380-1459). 12
Q
Qualen, von, Oberpräsident (1761). 1
R
Ramin, Ewald, Vors. der Gesellschafterversammlung der
Rheumaklinik. 37, 41
Rath, Reinhold, Geschäftsführer der Rheumaklinik. 34, 41
Rhazes, arab. Arzt (865-925). 11
Riehl, Edgar, Betriebsingenieur. 41
Rousseau, Jan-Jaques, Philosoph und Schriftsteller (1712-1778). 68
Rumpf, Heinz, Gesellschafter der Rheumaklinik. 37
S
Scotus, Michael (gestorben um 1235). 11
Seneca, röm. Dichter und Philosoph (4-65). 9
Sergius Orata (100 v. Chr.). 10
Snorrason, Egil (1968). 20
Sprengler, L. (1854) 11
Süersen. Johann Friedrich (1771-1845). 20, 21
Sylvius, De le boe (1614-1672). 15
Sch
Schelling, Caroline, weibl. Mittelpunkt der Frühromantik (1763-1809). 69
Schiller, Johann Friedrich, Dichter (1759-1805). 18, 21
Schmidt, Anton, Bramstedter Bürger (1810). 59
Schönemann, Lili, Verlobte Goethes (1775). 68
Schumacher, Heinrich Christian, Astronom (1780-1850). 69,70
Schulz, Dr., Chefarzt (1933). 29
Schulze. Walter, Denkmalspfleger. 49
St
Steckmest, Hinrich, Bramstedter Bürger (1810). 59
Stoecken Dr. Christian von, Propst (1681). 58
Stolberg, Christian Günther Graf zu, Kammerherr und Amtmann (1765). 67
Stolberg, Christian Graf zu (1748-1821). 68
Stolberg, Friedrich Leopold Graf zu (1750-1819). 68
Stolberg, Auguste Louise Gräfin zu (1753-1835). 68
Storck. Dr., Vors. der Rheumaheilstätte (1936). 72
Straube, Dr., Abt.-Arzt. 33
Stromberger, Dr., Chefarzt (1935). 29
Struensee, Johann Friedrich, dän. Staatsminister (1737-1772). 18, 19 ff.
Sturz, Peter Helferich (1736-1779). 19
T
Theoderich der Große, König der Ostgoten (um 456-526) 11
Tillmann, Dr., Abt.-Arzt. 33, 34
Tronchin, Theodore, Schweizer Arzt (1709-1781). 15
U
Unzer, Johann August, Arzt und Schriftsteller (1727-1799). 18, 19
V
Vaget, Dirick, Begründer des Gutes Bramstedt (1530) 66
Vogt, Heinrich. 23
Voltaire, franz. Dichter und Philosoph (1694-1778). 15
W
Wedde, Heinz, Bramstedter Bürgermeister und Gesellschafter der Rheumaklinik. 37
Weinberg, Unternehmer (1920). 54
Wiebeke Kruse, Frau Christian IV. (1608-1648). 48, 67
Wiede, Dr., Internist (1950). 30
Wilde, Oscar, engl. Dichter (1856-1900). 16
Wilhelm II. (1859-1941). 71
Z
Zehrer, Dr. Gerhard, Chirurg (1950). 30, 60
Zelter, Karl Friedrich, musik. Begleiter Goethes (1758-1832). 16
Zimmermann, Johann Georg, Leibarzt (1728-1795). 15
Bildnachweis
Archiv der Stadt Bad Bramstedt. 55, 56, 59, 60, 63, 66, 67, 70
Archiv der Rheumaklinik Bad Bramstedt. 27, 29, 30. 31, 42
Bibliotheque de l’Arsenal, Paris, MS 50 70. 13
R. Ginouves, Balaneutike, Paris 1962. 9, 10
Urs Graf, Zürich 1508. 14
M. Hero, Schachtafeln der Gesundheit, Straßburg 1533. 13
Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel
Kupferstich von M. Bernigroth 1749. 19
Kupferstich von Fritzsch 1764. 19
Kupferstich von Fritzsch 1775. 20
Landesarchiv Schleswig-Holstein. 17
Martin, Deutsches Badewesen Jena 1906. 12
Österreichische Nationalbibliothek Wien MS 2561. 13
Jan Uwe Schadendorf, Bad Bramstedt: Farbtafeln. 2, 38, 39, 46, 47 und Abb. 32, 34, 35, 40, 41, 43, 45, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 70, 71
Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek. 21, 23
Sternwarte Hamburg. 68
J. F. Süersen. 22
Universitäts-Bibliothek Kiel. 18
Kupferstich von A. Stöltrup. 21, 23
Horst Zimmermann. 36, 69
 EICHHÖRNCHEN nehmen im Bad Bramstedter Kurpark seit Jahrzehnten eine
EICHHÖRNCHEN nehmen im Bad Bramstedter Kurpark seit Jahrzehnten eine
ausgesprochene Sonderstellung ein. Überall sind die possierlichen, ach so flinken Tierchen im Park zu finden. In sie sind die Kurgäste verliebt, die sich von morgens bis abends emsig darum bemühen die EICHHÖRNCHEN möglichst aus der Hand zu füttern. Ein Spiel, das Tag für Tag im Kurpark zu beobachten ist. Woher die besondere Liebe der Rheumakranken zu den EICHHÖRNCHEN kommt? Verbirgt sich dahinter etwa der Wunschtraum, wie diese Tierchen behende zu sein? Nur Linderung von
ihrem Leiden können Rheumakranke erfahren, meinte ein Rheumatologe zu diesen Fragen. Eichhörnchen-Behendigkeit können sie nie mehr erhalten. – Doch im Bramstedter Kurpark bleibt die Zuneigung der Patienten zu den EICHHÖRNCHEN von Kur zu Kur erhalten: Eine Liebe, die immer dauert.

 Das schönste Denkmal, das die Kasse sich gesetzt hat, ist wohl das Herrenholz. In früheren Zeiten zum adligen Gut gehörend, wurde der Waldbestand in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf Anordnung des Gutsherrn niedergelegt und das entwaldete Gelände an hiesige Einwohner verpachtet, bis sich einige Jahrzehnte später 60 Einwohner zusammentaten und das etwa 10 Hektar große Stück kauften. Von ihnen erwarb die Sparkasse das Land und forstete es auf. Später räumte sie der Stadtgemeinde auf ewige Zeiten – solang de Wind weiht un de Hahn kreiht – das Recht ein, das Gehölz, das mit seinen prächtigen Eichen und Buchen eine Zierde der Stadt ist, als öffentlichen Park zu nutzen. Inzwischen hatte die Kasse auch noch den im Westen sich anschließenden Bauernwald hinzugekauft. Als dann das adlige Gut um die Jahrhundertwende parzelliert wurde, kaufte die Sparkasse von den Gutswiesen einen Streifen, der von der Glückstädter Straße bis zum Dahlkamp reichte, und schuf dort durch Aufschüttungen den viel begangenen, wegverkürzenden Wiesensteig. daß Bad Bramstedt ein vielbesuchter Kurort geworden ist, ist ebenfalls der Kasse zu verdanken. Wohl wurde das alte Kurhaus mit seinem schönen Park von dem Zimmermeister Matthias Heesch aus kleinen Anfängen nach und nach geschaffen, aber er wäre dazu nicht imstande gewesen, wenn nicht die Sparkasse ihm immer wieder mit Darlehen unter die Arme gegriffen hätte. Der Sparkasse verdankt die Stadt die Bürgersteige mit dem Klinkerbelag. Als in Hamburg die Straßenbeleuchtungen auf Gas umgestellt wurden, kaufte die Sparkasse einen Teil der überflüssig gewordenen Petroleum-Laternen und ließ sie in den Straßen aufstellen. Auch das Reinigen der Lampen und ihre Versorgung mit Brennstoff wurde von ihr bezahlt, und wo sich ein Bedürfnis dafür ergab, wurden weitere Straßenlampen aufgestellt. Nachdem aber auch hier die Petroleumlampen ausgedient hatten, zahlte die Sparkasse zur Bestreitung der durch Einführung der elektrischen Straßenbeleuchtung entstehenden Kosten jährlich 3 000 M an die Stadt. Den Bau der Jürgen-Fuhlendorf-Schule ermöglichte die Fleckensparkasse durch Hergabe der Baugelder; ebenso war sie bei dem Bau der Turnhalle finanziell wesentlich beteiligt, wie ihr auch sonst die Turnerschaft für geldliche Unterstützung bei Beschaffung von Geräten und dergleichen seit ihrem Bestehen zu großem Dank verpflichtet ist. Wo es galt, das Stadtbild zu verschönern, sprang die Kasse ein. Erinnert sei nur an das früher wüst aussehende Dreieck vor der Post, das durch ihre Unterstützung in einen Schmuckplatz verwandelt wurde. Durch die Kasse wurde manchem aufstrebenden jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, Schulen zu besuchen, und wenn jemand sich ein eigenes Heim bauen lassen wollte, so wandte er sich an die Kasse; wenn er ihr als strebsam bekannt war, konnte er sicher auf Hergabe der erforderlichen Summe rechnen. Das alles sind nur einige Beispiele, um zu zeigen, wie die Kasse arbeitete. Die Inflation setzte ihrem Wirken zunächst ein Ende, aber sobald wieder normale Geldverhältnisse eintraten, ging es auch bei ihr an ein Aufbauen, und sie war auf dem besten Wege, ihre gemeinnützige Tätigkeit, wenn auch vorläufig in beschränktem Maße, wieder aufzunehmen. Diese Pläne können jetzt zur Ausführung gelangen. Was aber die Fleckensparkasse in den 94 Jahren ihres Bestehens für das Gemeinwesen geleistet hat, das sichert ihr für alle Zeiten einen Platz in der Geschichte Bad Bramstedts.
Das schönste Denkmal, das die Kasse sich gesetzt hat, ist wohl das Herrenholz. In früheren Zeiten zum adligen Gut gehörend, wurde der Waldbestand in den fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts auf Anordnung des Gutsherrn niedergelegt und das entwaldete Gelände an hiesige Einwohner verpachtet, bis sich einige Jahrzehnte später 60 Einwohner zusammentaten und das etwa 10 Hektar große Stück kauften. Von ihnen erwarb die Sparkasse das Land und forstete es auf. Später räumte sie der Stadtgemeinde auf ewige Zeiten – solang de Wind weiht un de Hahn kreiht – das Recht ein, das Gehölz, das mit seinen prächtigen Eichen und Buchen eine Zierde der Stadt ist, als öffentlichen Park zu nutzen. Inzwischen hatte die Kasse auch noch den im Westen sich anschließenden Bauernwald hinzugekauft. Als dann das adlige Gut um die Jahrhundertwende parzelliert wurde, kaufte die Sparkasse von den Gutswiesen einen Streifen, der von der Glückstädter Straße bis zum Dahlkamp reichte, und schuf dort durch Aufschüttungen den viel begangenen, wegverkürzenden Wiesensteig. daß Bad Bramstedt ein vielbesuchter Kurort geworden ist, ist ebenfalls der Kasse zu verdanken. Wohl wurde das alte Kurhaus mit seinem schönen Park von dem Zimmermeister Matthias Heesch aus kleinen Anfängen nach und nach geschaffen, aber er wäre dazu nicht imstande gewesen, wenn nicht die Sparkasse ihm immer wieder mit Darlehen unter die Arme gegriffen hätte. Der Sparkasse verdankt die Stadt die Bürgersteige mit dem Klinkerbelag. Als in Hamburg die Straßenbeleuchtungen auf Gas umgestellt wurden, kaufte die Sparkasse einen Teil der überflüssig gewordenen Petroleum-Laternen und ließ sie in den Straßen aufstellen. Auch das Reinigen der Lampen und ihre Versorgung mit Brennstoff wurde von ihr bezahlt, und wo sich ein Bedürfnis dafür ergab, wurden weitere Straßenlampen aufgestellt. Nachdem aber auch hier die Petroleumlampen ausgedient hatten, zahlte die Sparkasse zur Bestreitung der durch Einführung der elektrischen Straßenbeleuchtung entstehenden Kosten jährlich 3 000 M an die Stadt. Den Bau der Jürgen-Fuhlendorf-Schule ermöglichte die Fleckensparkasse durch Hergabe der Baugelder; ebenso war sie bei dem Bau der Turnhalle finanziell wesentlich beteiligt, wie ihr auch sonst die Turnerschaft für geldliche Unterstützung bei Beschaffung von Geräten und dergleichen seit ihrem Bestehen zu großem Dank verpflichtet ist. Wo es galt, das Stadtbild zu verschönern, sprang die Kasse ein. Erinnert sei nur an das früher wüst aussehende Dreieck vor der Post, das durch ihre Unterstützung in einen Schmuckplatz verwandelt wurde. Durch die Kasse wurde manchem aufstrebenden jungen Menschen die Möglichkeit gegeben, Schulen zu besuchen, und wenn jemand sich ein eigenes Heim bauen lassen wollte, so wandte er sich an die Kasse; wenn er ihr als strebsam bekannt war, konnte er sicher auf Hergabe der erforderlichen Summe rechnen. Das alles sind nur einige Beispiele, um zu zeigen, wie die Kasse arbeitete. Die Inflation setzte ihrem Wirken zunächst ein Ende, aber sobald wieder normale Geldverhältnisse eintraten, ging es auch bei ihr an ein Aufbauen, und sie war auf dem besten Wege, ihre gemeinnützige Tätigkeit, wenn auch vorläufig in beschränktem Maße, wieder aufzunehmen. Diese Pläne können jetzt zur Ausführung gelangen. Was aber die Fleckensparkasse in den 94 Jahren ihres Bestehens für das Gemeinwesen geleistet hat, das sichert ihr für alle Zeiten einen Platz in der Geschichte Bad Bramstedts.
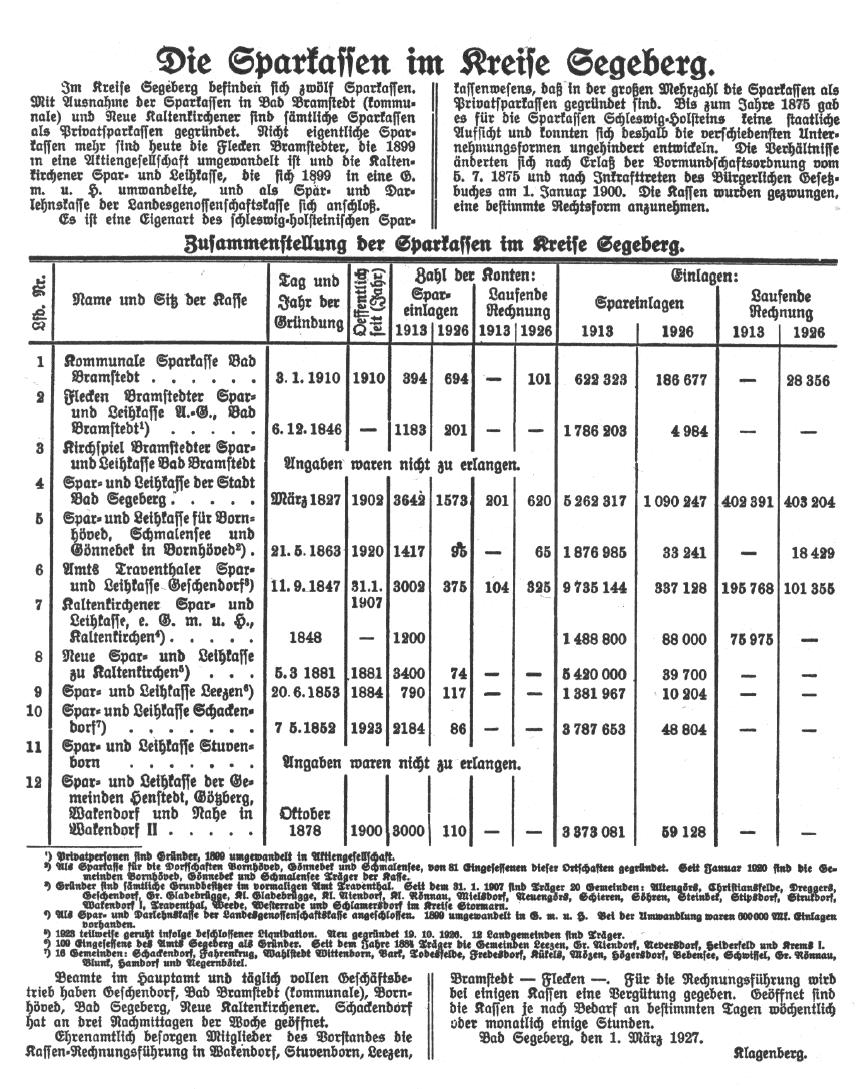




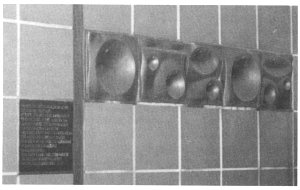
 Die Bedingungen für das Erscheinen einer solchen Zeitschrift waren insofern günstig, als Schumacher sich auf eine Reihe von Mitarbeitern stützen konnte, wie sie in der Regel zu seiner Zeit dem Herausgeber einer wissenschaftlichen Zeitschrift kaum zur Verfügung standen. Die erste Nummer der A. N. erschien im September 1821 in Altona als Verlagsort. Sie stellt die einzige noch heute erscheinende deutschsprachige astronomische Fachzeitschrift aus dem 19. Jahrhundert dar, deren 159. Jahrgang nunmehr vorliegt.
Die Bedingungen für das Erscheinen einer solchen Zeitschrift waren insofern günstig, als Schumacher sich auf eine Reihe von Mitarbeitern stützen konnte, wie sie in der Regel zu seiner Zeit dem Herausgeber einer wissenschaftlichen Zeitschrift kaum zur Verfügung standen. Die erste Nummer der A. N. erschien im September 1821 in Altona als Verlagsort. Sie stellt die einzige noch heute erscheinende deutschsprachige astronomische Fachzeitschrift aus dem 19. Jahrhundert dar, deren 159. Jahrgang nunmehr vorliegt. Wann und wie Fuhlendorf entstanden ist, wissen wir nicht. Wie kam es zur ersten Erwähnung seines Namens?
Wann und wie Fuhlendorf entstanden ist, wissen wir nicht. Wie kam es zur ersten Erwähnung seines Namens? Als Besitzgrundlage erhielt Kloster Reinfeld das Gebiet nördlich der Trave beiderseits der Heilsau bis zur Reinsbek zur Rodung und Erschließung, „eine Gegend des Schreckens und der endlosen Einsamkeit“ (in loco horroris vastae solitudinis)1).
Als Besitzgrundlage erhielt Kloster Reinfeld das Gebiet nördlich der Trave beiderseits der Heilsau bis zur Reinsbek zur Rodung und Erschließung, „eine Gegend des Schreckens und der endlosen Einsamkeit“ (in loco horroris vastae solitudinis)1).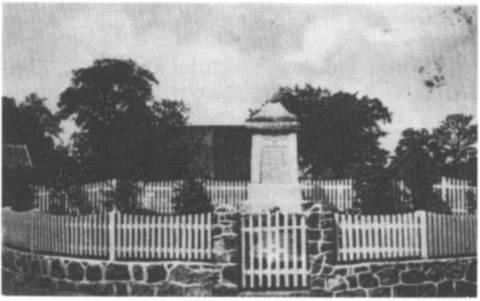 Auf dieser Steuerliste lernen wir die ältesten uns bekannten Namen Fuhlendorfer Hufner kennen. Drei Hufen sind im Eigentum eines Verst8). Ob und wie diese verwandt sind, wissen wir nicht. Zwei Höfe gehören einem Oerth, später Orth, auch Ordt, Ortt geschrieben. Mit Marquart Runge kommt ein Name vor, der auch am Ende des 20. Jahrhunderts als Hofbesitzer im Dorf lebendig ist. Weitere drei Hufen gehören Tymme Hennecke, Tygges Becker und Hennecke Tithkenn.
Auf dieser Steuerliste lernen wir die ältesten uns bekannten Namen Fuhlendorfer Hufner kennen. Drei Hufen sind im Eigentum eines Verst8). Ob und wie diese verwandt sind, wissen wir nicht. Zwei Höfe gehören einem Oerth, später Orth, auch Ordt, Ortt geschrieben. Mit Marquart Runge kommt ein Name vor, der auch am Ende des 20. Jahrhunderts als Hofbesitzer im Dorf lebendig ist. Weitere drei Hufen gehören Tymme Hennecke, Tygges Becker und Hennecke Tithkenn.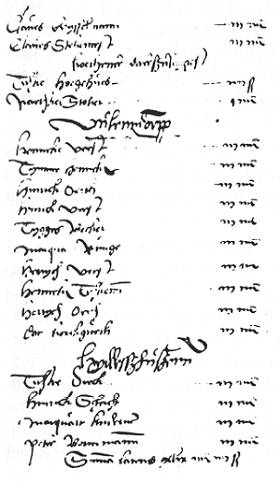
 Ich möchte den Publikationen nicht eigene Ausführungen anfügen, sondern hier auf einige im Internet publizierte Artikel und Seiten zurückgreifen, die den Stand der Forschungen wiedergeben.
Ich möchte den Publikationen nicht eigene Ausführungen anfügen, sondern hier auf einige im Internet publizierte Artikel und Seiten zurückgreifen, die den Stand der Forschungen wiedergeben.
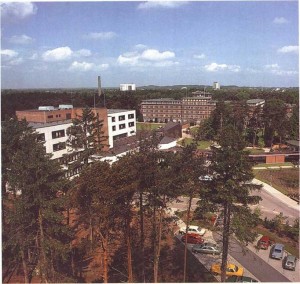


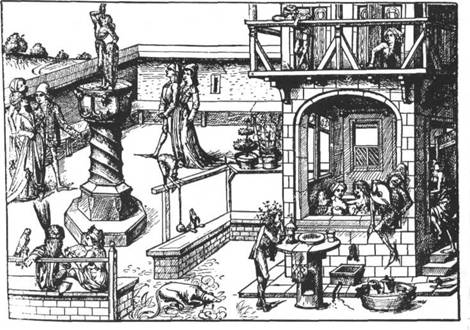


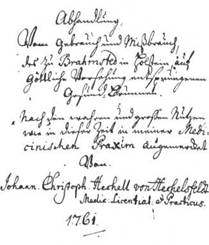















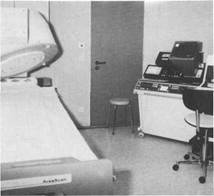

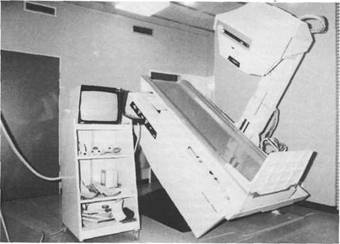








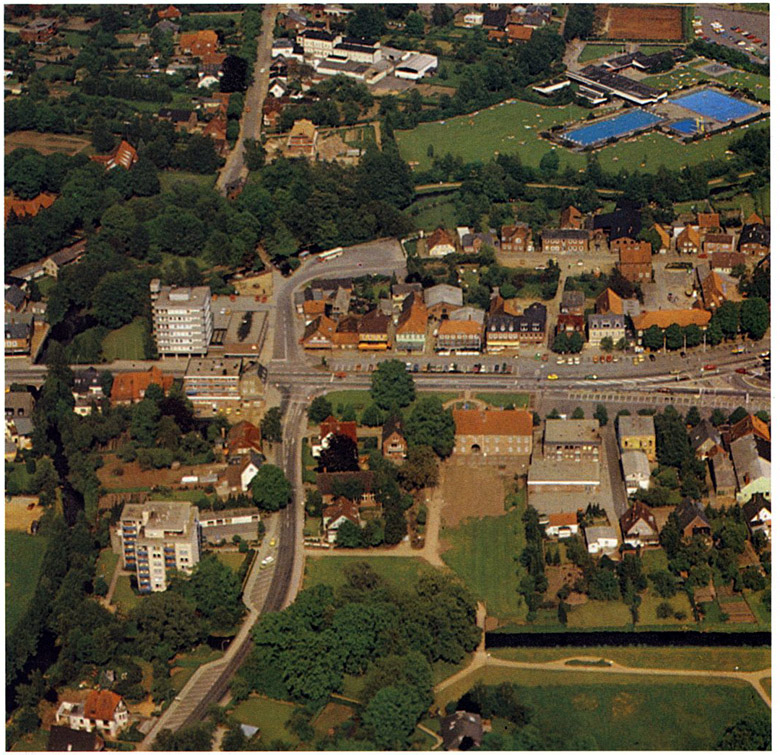
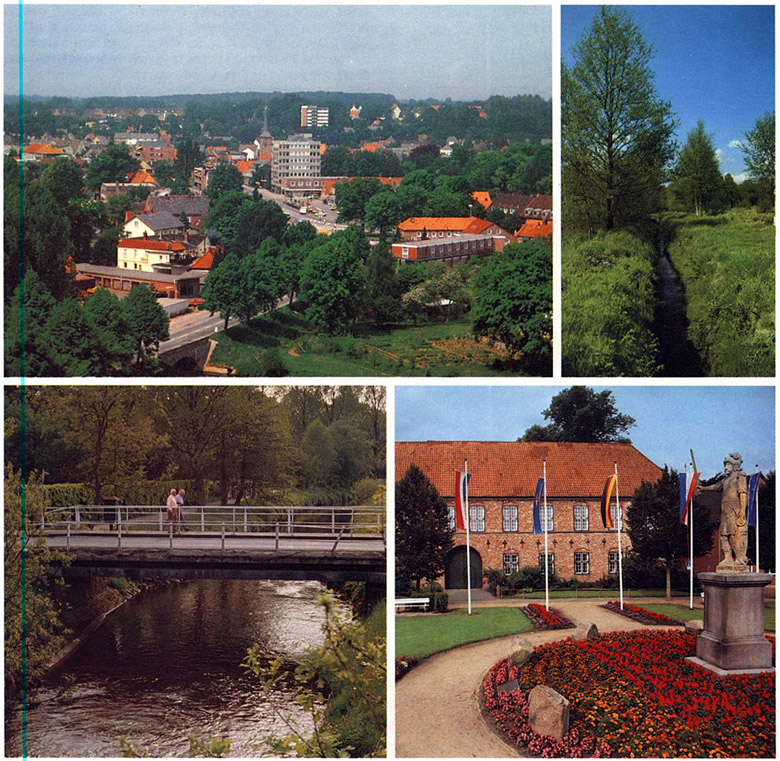


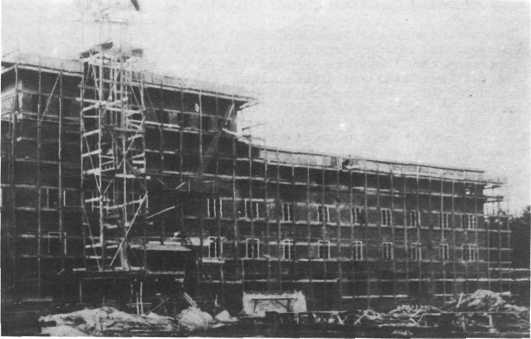




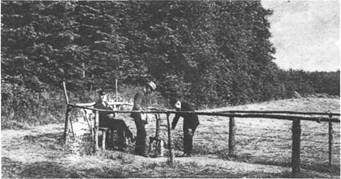









 Die Geschichtsforscherin verfaßte 1866 als Erstlingsarbeit ,,Wiebeke Kruse“. Aus dieser Arbeit ist ein tiefes Heimatgefühl ablesbar. Viele Jahre später schreibt sie als 76jährige an Pastor HÜMPEL: „Sie haben Recht, daß ich mein liebes Bramstedt sehr liebe“. 36 Jahre lang diente sie der prähistorischen Forschung. Ein für damalige Zeiten ungewöhnlicher Schritt erfolgte 1891. Minister v. GOSSLER berief eine Frau, Johanna MESTORF, zur Direktorin des Kieler Museums für vaterländische Altertümer. Damit nicht genug, wurde ihr zum 70. Geburtstag als ersten schleswig-holsteinischen Frau der Titel einer Professorin verliehen. Zum 80. Geburtsag schickte Kaiser WILHELM II. ihr sein Bild mit eigenhändiger Unterschrift – eine damals ungewöhnliche Ehrung für eine Frau. An Bramstedt erinnerte sich die Professorin oft. Sie setzte 1906 ein Legat für die Kirchengemeinde Bramstedt aus, um einmal im Jahr zwölf bedürftige Frauen in den Genuß einer „kräftigen Rindfleischsuppe mit Klößen kommen zu lassen“. Die Währungsschnitte haben 500 Goldmark des Legats inzwischen verschmelzen lassen. Johanna MESTORF starb 81jährig und wurde auf dem Friedhof zu Hamburg-Ohlsdorf begraben. Im Nachruf der Kieler Unviersität hieß es: „Aus dem Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit Schleswig-Holsteins drang durch sie manch heller Schein in die Gegenwart“.
Die Geschichtsforscherin verfaßte 1866 als Erstlingsarbeit ,,Wiebeke Kruse“. Aus dieser Arbeit ist ein tiefes Heimatgefühl ablesbar. Viele Jahre später schreibt sie als 76jährige an Pastor HÜMPEL: „Sie haben Recht, daß ich mein liebes Bramstedt sehr liebe“. 36 Jahre lang diente sie der prähistorischen Forschung. Ein für damalige Zeiten ungewöhnlicher Schritt erfolgte 1891. Minister v. GOSSLER berief eine Frau, Johanna MESTORF, zur Direktorin des Kieler Museums für vaterländische Altertümer. Damit nicht genug, wurde ihr zum 70. Geburtstag als ersten schleswig-holsteinischen Frau der Titel einer Professorin verliehen. Zum 80. Geburtsag schickte Kaiser WILHELM II. ihr sein Bild mit eigenhändiger Unterschrift – eine damals ungewöhnliche Ehrung für eine Frau. An Bramstedt erinnerte sich die Professorin oft. Sie setzte 1906 ein Legat für die Kirchengemeinde Bramstedt aus, um einmal im Jahr zwölf bedürftige Frauen in den Genuß einer „kräftigen Rindfleischsuppe mit Klößen kommen zu lassen“. Die Währungsschnitte haben 500 Goldmark des Legats inzwischen verschmelzen lassen. Johanna MESTORF starb 81jährig und wurde auf dem Friedhof zu Hamburg-Ohlsdorf begraben. Im Nachruf der Kieler Unviersität hieß es: „Aus dem Dunkel der vorgeschichtlichen Zeit Schleswig-Holsteins drang durch sie manch heller Schein in die Gegenwart“.

 EICHHÖRNCHEN nehmen im Bad Bramstedter Kurpark seit Jahrzehnten eine
EICHHÖRNCHEN nehmen im Bad Bramstedter Kurpark seit Jahrzehnten eine