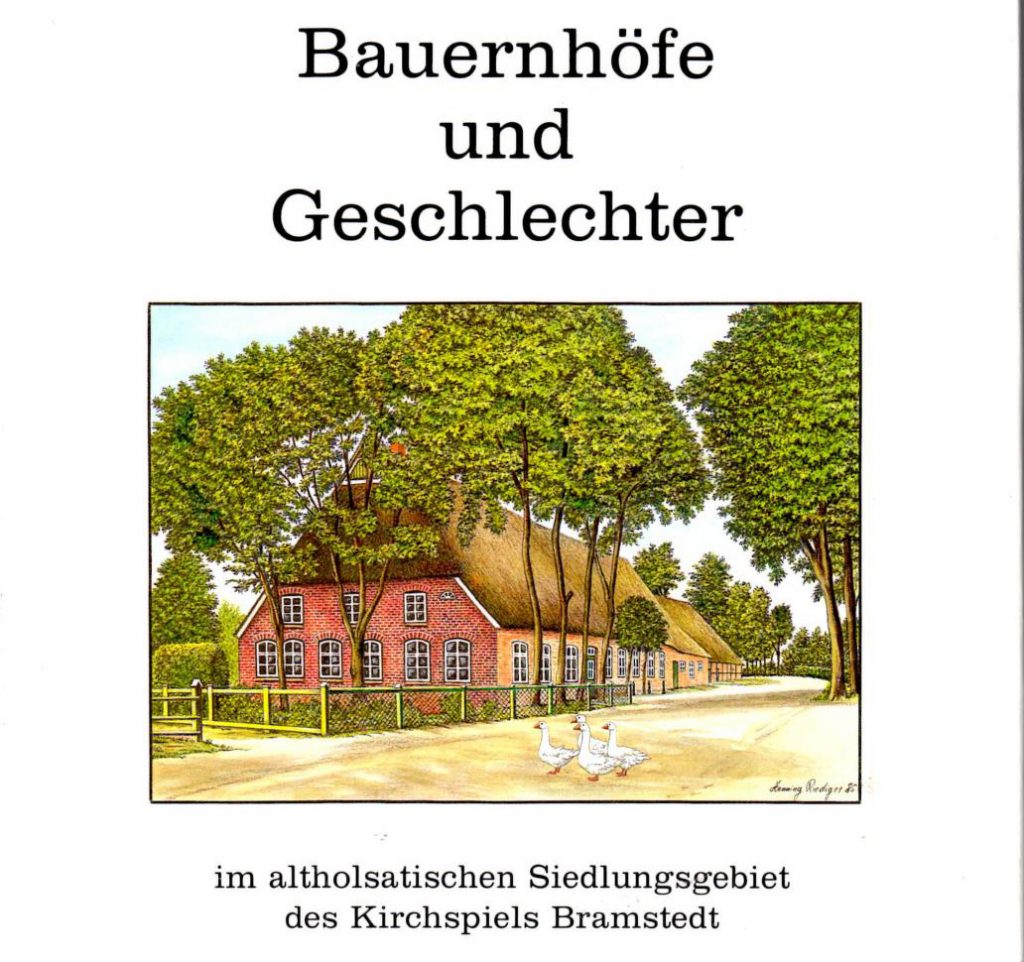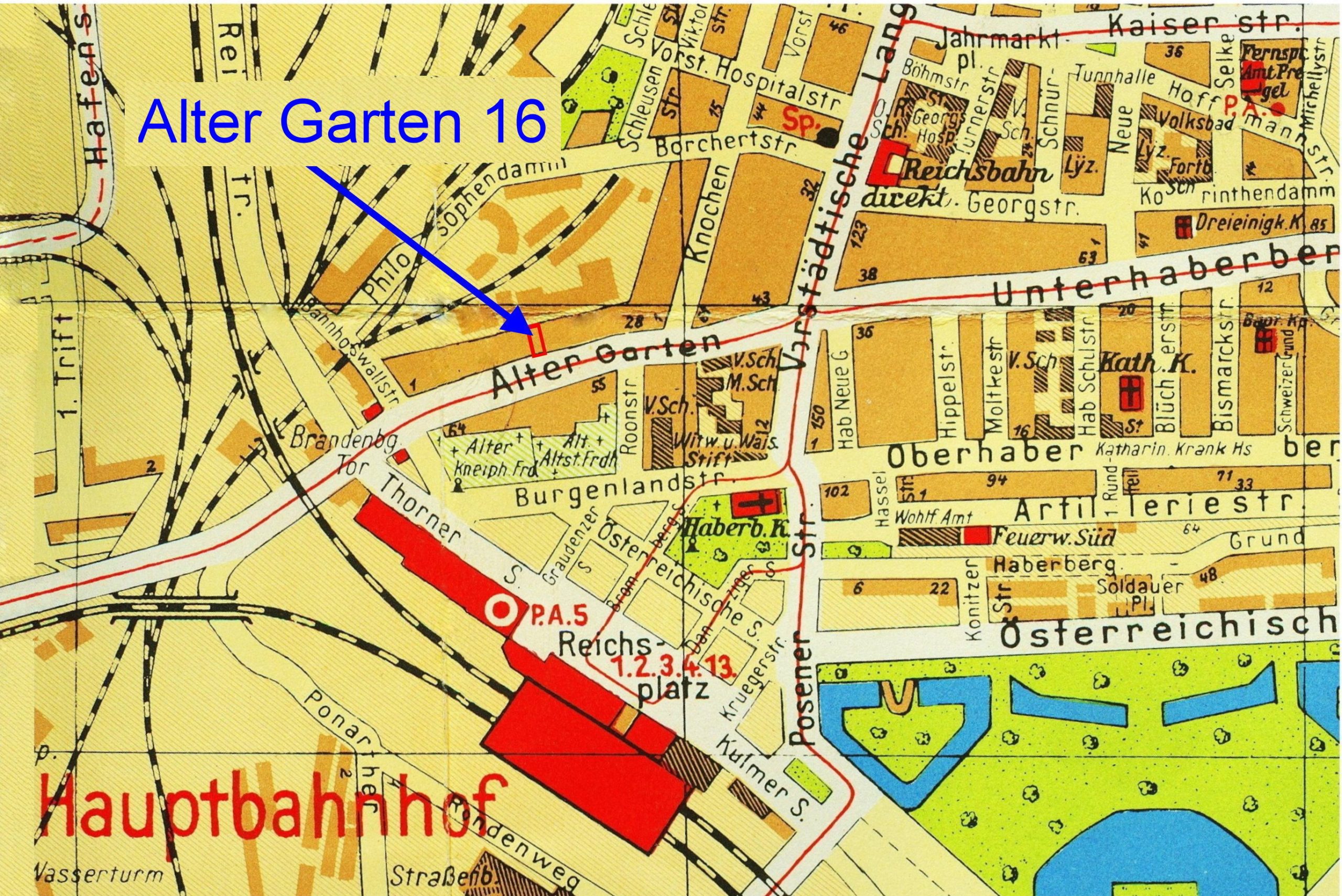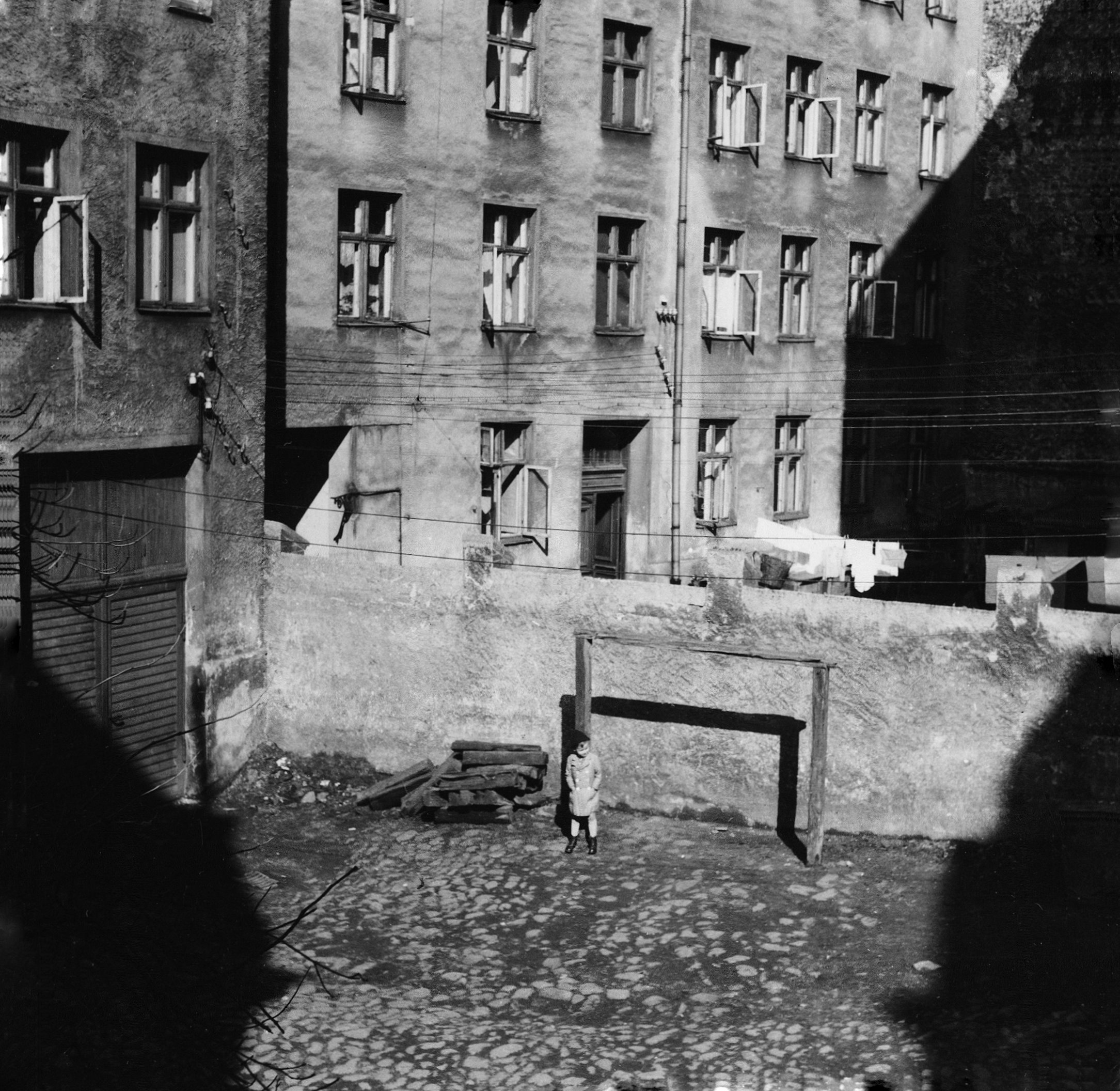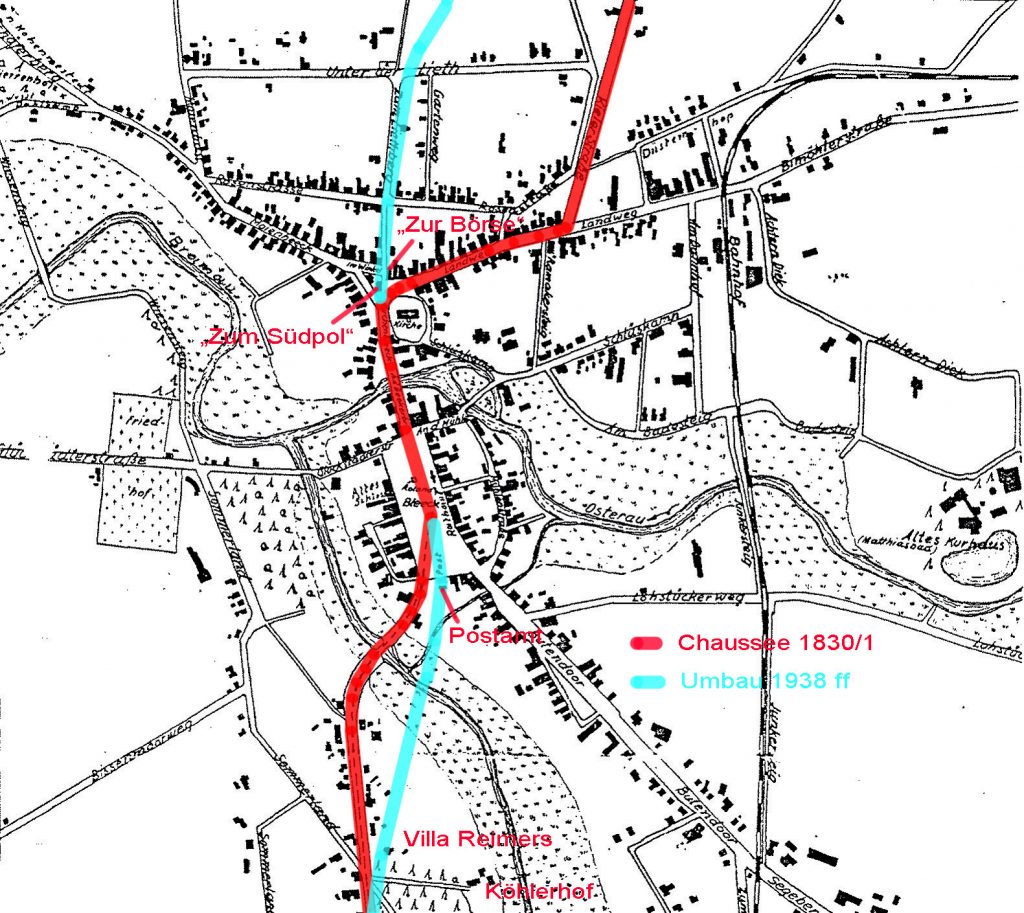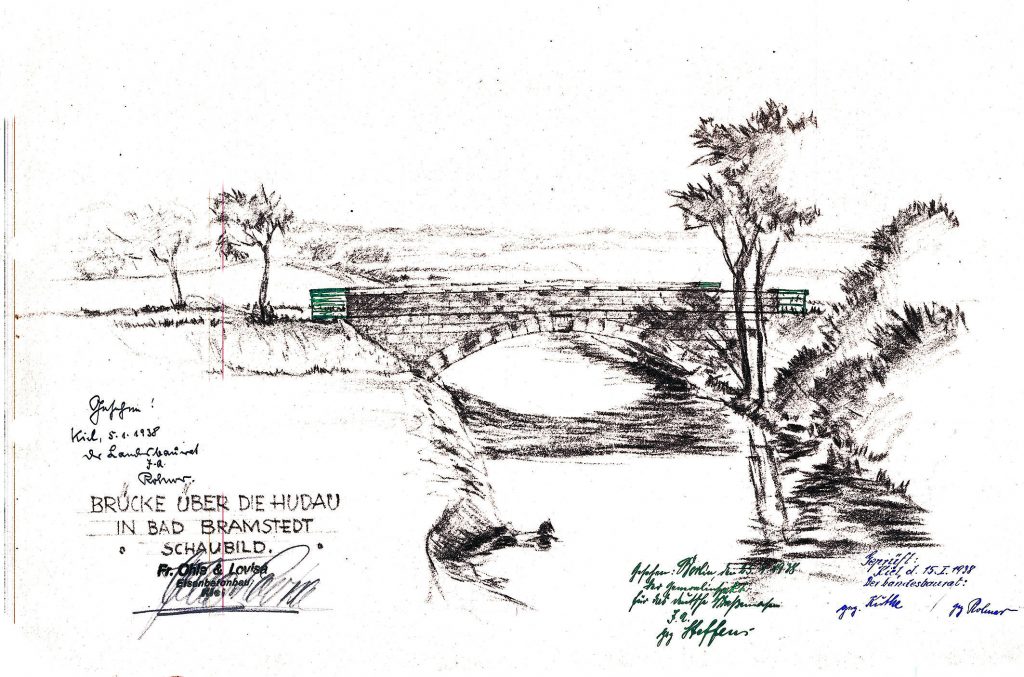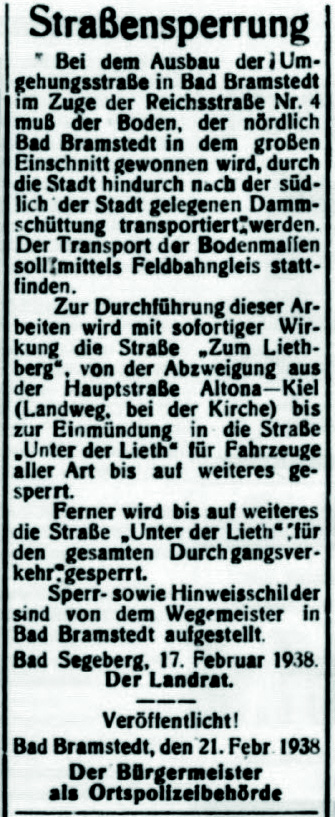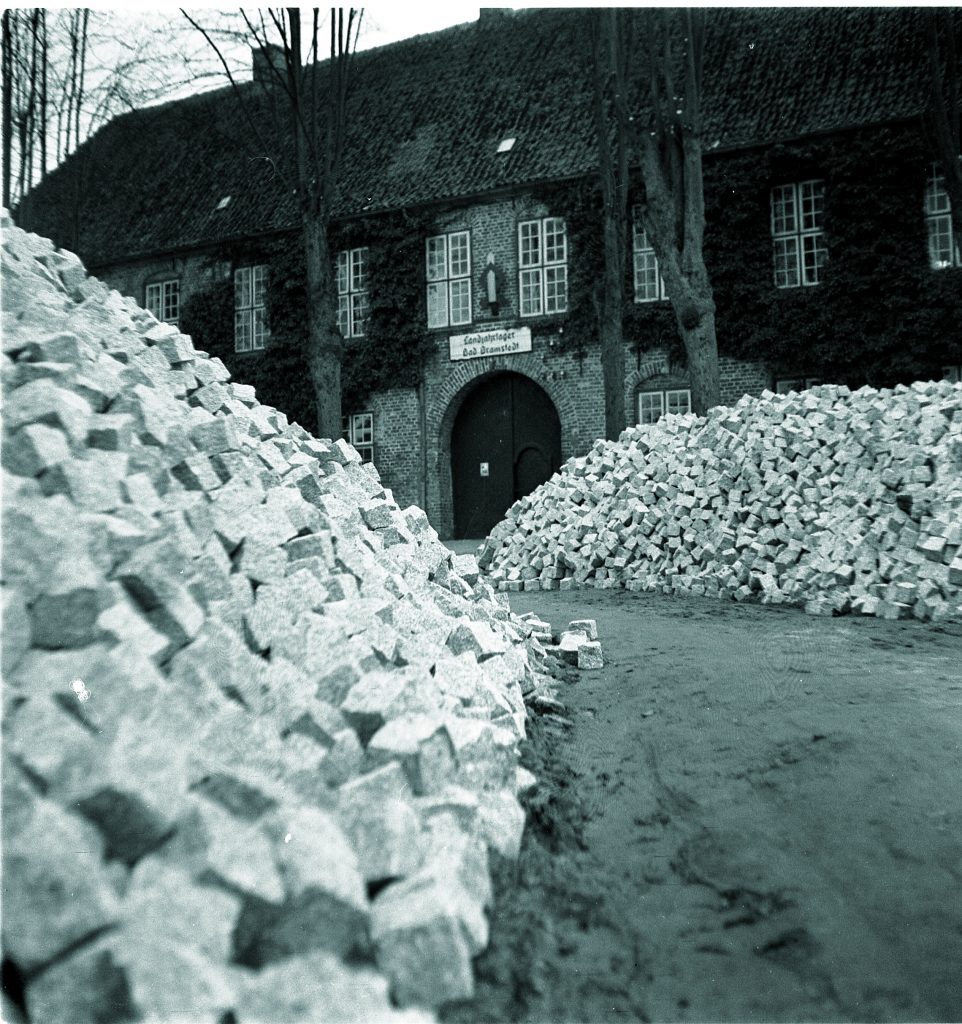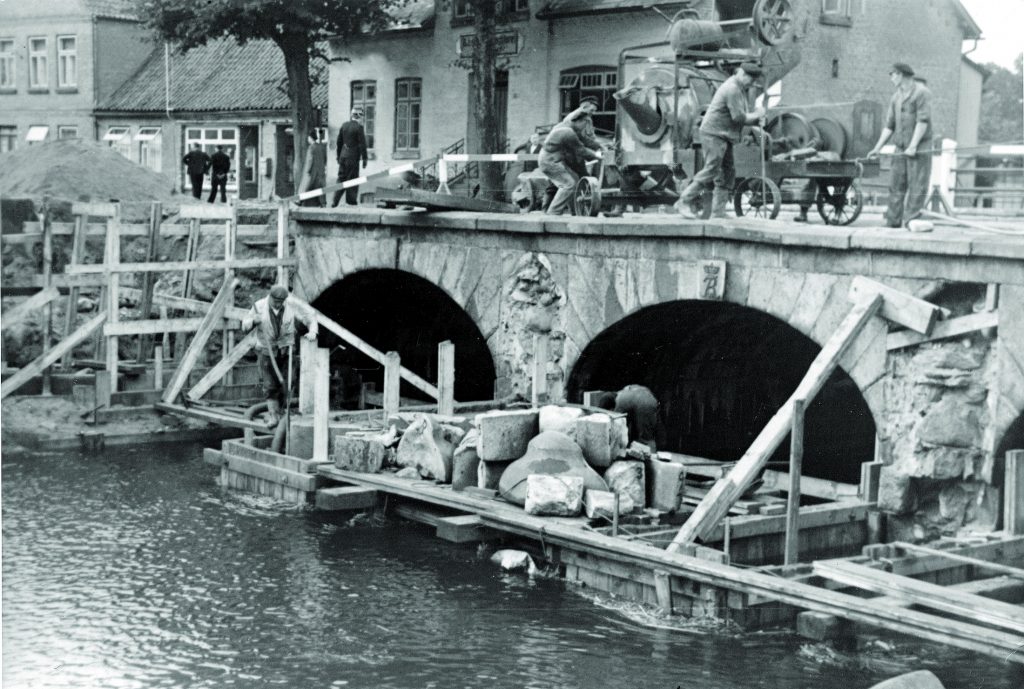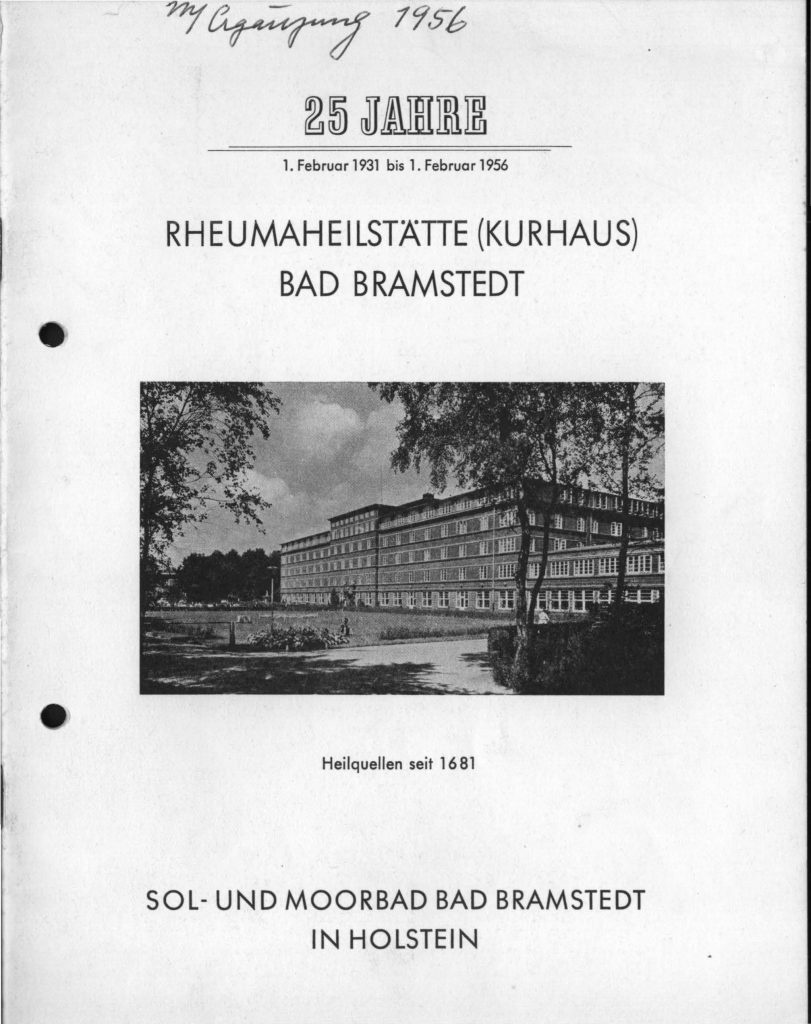Stadtachivar Manfred Jacobsen hat in den vielen Jahren seiner Tätigkeit für die Stadt Bad Bramstedt aus verschiedensten Urkunden und Quellen Personennamen in einer eigenen Tabelle zusammengetragen. Eine Liste, die „lebt“ und keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Sie ist eine sehr schöne Quelle für alle Heimat- und Familienforscher.
Mein Dank gilt Manfred Jacobsen für seine Arbeit und seine Erlaubnis, diese Tabelle hier veröffentlichen zu dürfen. (22.5.2022)
Kirchspielvögte des Kirchspiels Bramstedt
1476 Eggert Sassenhagen
1530-1543 Eggert Speeth
vor 1547- 15?? Jürgen Vogt, Sohn des Dirk Vogt (1518-1562)
15??-1625 Caspar Vogt, Sohn des Jürgen Vogt
1625-1650 Johann Vogt, Sohn des Vogt
1650-1652 Paul Blanck, Schwiegersohn des Johann Vogt
1652-1694 Christian Schlaff (vom König eingesetzt?)
1694-1714 Detlef Averhoff, Schwiegersohn des Christian Schlaff
1714-1720 Joachim Christian Wulf, auch Zolleinnehmer, 1720 im Arrest
1720-1731 Johann Wilhelm Jancken wird interimistischer Kirchspielvogt der Kirchspiele Bramstedt und Kaltenkirchen, 1738 Kirchspielvogt in Nortorf, 1743 Hufeneigentümer in Bramstedt
1734-1744 Joachim Christian Wulf
1745-1762 Johann Heinrich Basuhn, auch Zoll- und Licent-Einnehmer; schon 1720 dort
beschäftigt, sein Vater Peter Basuhn bis 1729 Kirchspielvogt Kaltenkirchen
1760 Holst ?
1764-1784 Johann Barthold Butenschön, auch Zollverwalter
1784 Asmus Jessen interimistischer Kirchspielvogt, Schreiber des Amtmanns Schumacher
1784-1809 Jürgen Asmus Wohldt, auch Zollverwalter (vorher Untergerichtsadvokat zu Tönning)
1809-1829 Leopold August Cirsovius, auch Zollverwalter
1829-1830 Nicolaus Johann Christoph Laudan, i. A. tätig, von 1821-1835 Kirchspielvogt in Kaltenkirchen
1830-1849 Johann Tycho Emil Hartz
1831-1833 Gülk, i.A. tätig
1849-1853 Hugo Seidel
1853-1858 Kammerassessor Nicolai Heinrich Göttsche, auch Hebungskontrolleur
1859 Adolph Stahl
1859-1867 Christian Hans Wilhelm von Linstow
Kirchspielvogteibezirk Bramstedt ab 1868
Kirchspielvogteidistrikte Bramstedt und Kaltenkirchen, Dorfschaften Hasenmoor, Fuhlenrüe, dem Hof Weide, den Dorfschaften Bredenbekshorst, Sievershütten, Stuvenborn, Nahe und Itzstedt, Flecken Bramstedt aus dem Kirchspielvogteibezirk ausgeschieden und mit eigener Polizeiverwaltung ausgestattet. Kirchspielvogt ohne richterliche Funktion, ohne freiwillige Gerichtsbarkeit und ohne Steuererhebung, aber in Personalunion auch Kassenkurator der Kgl. Steuerkasse. Ab September/Oktober 1889 Bürgermeister Freudenthal als Kassenkurator tätig.
1868-75 Reinhold Carl Conrad Julius von Sievers (vorher Kirchspielvogt und kgl.
Polizeianwalt in Kaltenkirchen)
1875-1889 Johann Heinrich Ludwig Flögel, Standesbeamter Landbezirk Bramstedt
1889 Aufhebung der Kirchspielvogteibezirke und Einführung der Amtsbezirke
Zollverwalter
bis 1830 der jeweilige Kirchspielvogt
1831-1835 Kammerjunker Franz Friedrich von Schlanbusch, Schwiegersohn des Postmeisters Johann Theodor Frauen
1835 Zollkontorist Heinrich Peter Dau
1835 Zollkontrolleur und Secondleutnant Carl August Friedrich von Lau
1836 vakant
1837-1867 Johann Georg Herzog, Zollassistent bzw. Zollverwalter, Kontrolleur mit Hebung
ab 1839 Bramstedt nur noch Dienststelle Neumünsters: Justizrat Peter Johann Wilhelm Kellermann, Zollverwalter und Amtsschreiber.
1841 Heinrich Ludwig Ebert, Unterzollbeamter in Neumünster in Bramstedt
1844-1845 Johann Friedrich O. Lorenzen, Zollassistent, Unterzollbeamter
1845 Kopist Johann Nagel
1845 Schreiber Carl Christian Theodor Lempelius
1855 Kirchspielvogt Nicolai Heinrich Göttsche als Hebungskontrolleur
1860 Zollbeamter Joh. Hinr. Knife
1872 Zollverwalter Falkenberg
Kirchspielvogteibedienstete
1835-1840 Kirchspielsvogtei- und Fleckensdiener Hans Steckmest
1840 Interims Fleckens- und Vogtei-Diener Tim Köhnke
1840 Fleckens- und Vogtei-Diener Schustermeister Jacob Rickert
1845 Copist Johann Nagel
1855-1860 Contorist Jochim Christens, Gehilfe
Kirchspielsgevollmächtigte
Sie wurden ab 1717 eingesetzt auf Vorschlag der Eingesessenen.
1739 Jasper Delfs aus aus Borstel
1739 Hans Karstens aus Quarnstedt
1831-1833 Andreas Wieckhorst aus Hagen
1832-1833 Hans Lüders aus Bimöhlen
1835 Johann Wieckhorst aus Hagen
1835-1841 Johann Köhnke aus Wiemersdorf
1841 Hr. Reimers aus Föhrden-Barl
1845 Gotfried Reincke aus Hagen
1845 Sick
1848 Tamm aus Wiemersdorf
1856 Gustav Hedde Caspar Sick aus Wiemersdorf
1873-1878 Sick
1873 Wickhorst
1884 Johs. Harbeck
Steuerempfänger/Rentemeister
1868-1884 Hufe
Dingvögte, Gerichtsangehörige
Es waren vier Dingvögte für das ganze Amt Segeberg zuständig, die ab 1660 ausschließlich aus dem Kirchspiel Bramstedt stammten.
vor 1600-1627 Hans Mertens Dingvogt, Hardebek
ab 1627 Hans Mohr Dingvogt, Schwager von Hans Mertens
1636 Titke Hardebeck (Hufe 1) Dingvogt, Wiemersdorf
1644-1691 Hufner Jürgen Gloi Dingvogt, Fuhlendorf, † 1691
1655-1667 Vollhufner Hans Mohr Dingvogt, Hardebek
1661 Dingvögte aus Hardebek, Wiemersdorf, Quarnstedt und Fuhlendorf
1662-167? Tiedje Hardebek aus Wiemersdorf
1667-1691 Claus Mohr Dingvogt, Sohn des Hans Mohr
1672-1705 Jürgen Hardebeck Dingvogt, Wiemersdorf
1677-1713 Hartig Boye Dingvogt, Fuhlendorf, † 1713
1713-1720 Hartig Boye Dingvogt, Fuhlendorf, Sohn des Hartig Boye, † 1725
1701-1720 Valentin Schultz Dingvogt, Itzehoe, Schwiegersohn des Claus Mohr, Hardebeck
Zwischen 1711 und 1743 wurde nur einmal Ding und Recht gehalten.
1715-1736 Paul Stegelmann Dingvogt, Wiemersdorf, † 1741
1726-1753 Vollhufner Peter Heins Dingvogt, Fuhlendorf, Schwiegersohn des Hartwig Boye
1743 Ersetzung der Kirchspielgerichte durch das Amtsgericht in Segeberg (Amtmann, Amtsverwalter und die drei Kirchspielvögte)
1743 Paul Stegelmann Dingvogt, Wiemersdorf
1743 Detlef Schulz Dingvogt, Hardebeck, Sohn des Valentin Schultz
1743-1758 Hans Reimers Dingvogt, Quarnstedt
1754-1758 Peter Heins Dingvogt, Fuhlendorf
1758 Jürgen Bolling Dingvogt, Hardebek
1758 Claus Stäcker Dingvogt, Wiemersdorf
1762-1782 Amtsgericht in Bramstedt abgehalten
bis 1785 Carsten Todt, Dingvogt aus Armstedt (danach sein Sohn gleichen Namens vorgeschlagen)
1785-1790 Hans Schümann Dingvogt, Wiemersdorf
1791 Jürgen Mohr Dingvogt, Wiemersdorf
1808-1809 Vollhufner Peter Hein Dingvogt, Fuhlendorf
1802-1814 Gerichtshalter Hennings, Gutsjustitiar
1816-1817 Gerichtsdiener Kuppinger
1867 Amtsgericht in Bramstedt eingesetzt, Bleeck 17
1867-1869 Amtsrichter G. H. Goos
1868 Amtsgerichtssekretär Jargstorff
1869 Amtsgerichtssekretär Haraun
1872-1878 Amtsrichter Pfaff
1876 Rezeptor des Amtsgerichts J. R. Struve gestorben
1878-1886 Amtsrichter Fr. Wennecker
1880-1886 Gerichtsschreiber Kohbrock
1884-1889 Gerichtsdiener, Gefangenenwärter Stammerjohann
1889-1891 Gerichtsassessor, Amtsrichter Mannhardt
1893-1895 Amtsrichter Ephraim Wollmann, 1899 Amtsgerichtsrat in Altona
1893 Gerichtssekretär Gelhausen
1899-1903 Amtsrichter vom Hof
1900-1901 Amtsrichter Lorentzen
1901-1902 Gerichtsschreiber Hansen
1903-1909 Amtsrichter Gravenhorst
1905-1907 Gerichtsschreiber Mewes
1908-1909 Sekretär Matthiesen
1907-1929 Gerichtsdiener, Gefangenenaufseher, Justizwachtmeister Strafanstaltsoberwacht-meister August Hermann Wenkelewski
1909-1920 Amtsgerichtsrat, Aufsichtsrichter Wegemann
1915-1923 Amtsrichter, Amtsgerichtsrat, aufsichtführender Richter Winter
1915-1936 Kanzleigehilfe, Gerichtsschreiber, Justizbüroassistent, Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Stammerjohann
1917 Gerichtsassessor Krieger
1918 Gerichtsvollzieher Schwarze
1918 Gerichtsschreiber Wrigg
1918-1920 Amtsgerichtssekretär, Gerichtsschreiber Germann
1918-192? Kanzleigehilfe, Justizsekretär (1928 a.D.) Wilhelm Ostermann
1919-1923 Amtsgerichtssekretär, Gerichtsschreiber, Justizobersekretär, Preußischer Justizfiskus Richard Karl Bergemann
1920-1942 Gerichtsschreiber, Justizobersekretär, Justizinspektor, Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Heinrich Stau
1921 Gerichtsschreiber Rettig
1921-1925 Amtsgerichtsrat Nielsen, auch Vorsitzender des Ortsausschusses für Jugendpflege (1924)
1921-1948 Kanzleiassistent, Kanzleisekretär, Justizsekretär, Justizobersekretär Ernst Dreyer
1923 Kanzleidiätar Sievers
1923-1925 Strafanstaltsoberwachtmeister Albrecht
1923-1929 Gerichtsassessor, Aktuar Johannsen
1923-1931 Amtsgerichtsrat, aufsichtsführender Richter Dr. Peter Thießen
1925-1927 Kanzleiangestellter Endemann
1926-1936 Amtsgerichtsrat, aufsichtführender Richter Hugo Lahann
1926 Justizhilfswachtmeister Degen
1927 Strafanstaltshilfswachtmeister Wilhelm Thegen
1927-1930 Justizanwärter, Justizdiätar Ludwig
1928 Gerichtsassessor Bols
1928 Justizangestellter Maack, Urkundsbeamter der Geschäftstelle
1928 Justizobersekretär Heinrich Helms
1928 Justizinspektor Arthur Kroll
1928 Gerichtsaktuar Otto Runge
1928 Gerichtsassessor Dr. Hansen
1928 Justizsupernumerar Nietmann
1928-1929 Geschäftsleitender Justizobersekretär Christiansen
1928-1931 Justizwachtmeister Karl Japp
1928-1936 Justizangestellter Ebeling, Urkundsbeamter der Geschäftstelle
1928-1945 Obergerichtsvollzieher Wilhelm Abel
1928-1949 Justizangestellter, Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Becker
1929 Justizangestellter Haack
1929 Justizobersekretär Dehne
1927-1931 Justizangestellter Schümann
1930 Umzug von Bleeck 17 nach Maienbeeck 1
1930 Gerichtsassessor Dr. Schmidt
1931-1935 Amtsgerichtsrat Gerhard Boysen
1934-1938 Justizsekretär Drews
1935-1936 Amtsgerichtsrat Felix von Johann
1936-1937 Amtsgerichtsrat Görcke
1937-1942 Amtsgerichtsrat Brack
1936-1940 Gerichtsassessor, Amtsgerichtsrat Langrehr
1938-1939 Justizinspektor, Rechtspfleger Hansen
1938 Justizangestellte Heinlein
1938-1939 Justizangestellter, Urkundsbeamter der Geschäftsstelle Knickrehm
1939 Assessor Dr. Büker
1941-1943 Justizangestellte Hamann
1938-1943 Justizinspektor Rühmann
1942-1944 Amtsgerichtsrat Vollstedt
1943 Verkauf des Amtsgerichtsgebäudes an das Deutsche Reich (Reichsjustizverwaltung)
1943-1944 Amtsgerichtsrat Dr. Kehl
1999 Schließung des Amtsgerichts
Polizei u. ä . (ab 1930 im Rathaus, Bleeck 17)
1829-1831 Polizeidiener Fuhrmann
1835 Feldwächter Marx Kröger
1855 Feldhüter Harm Ditrigs, Arbeitsmann
1855-1861 Polizeireiter J. H. C. Theodor Dohrmeier
1860-1868 Polizeidiener August Warnholtz, auch Gefangenenwärter
1867-1869 berittener Gendarm H. C. C. Beyer
1867-1868 Fußgendarm H. Winkler
1868-1869 Polizeianwalt Behniken (oder Dehniken)
1868-1889 Fleckensschreiber, Hebammenkurator, Fleckenskassierer, Rechnungsführer, Polizeischreiber, Polizeianwalt (Polizeiverwalter) und Standesbeamter (bis 1875) (Standesamtsbezirk Landbezirk Bramstedt) Emil Theodor Johannes Wolf
1874 Polizeidiener J. Truelsen
1875 Oberwächter und Polizeidiener Huss
1875-1887 Feldpolizeidiener, Feldhüter Willem Hinrich Hartmann
1878 berittener Gendarm Robert
1879-1891 Polizeidiener Baasch
1880 berittener Gendarm Bodag
1880-1881 Polizeidiener Delfs
1887 Feldhüter W. H. Hartmann
1887-1890 berittener Gendarm Albert Johann Fleck
1890 Inste und Weber Carsten Blöcker aus Föhrden-Barl als Amtsdiener des Amtes Weddelbrook gleichzeitig polizeilicher Exekutivbeamter
1893-1905 Polizeidiener Joseph Geronzin Thiesen († 1905)
1899 berittener Gendarm Möller I
1900 Feldhüter Göttsche (Kündigung)
1901 Feldhüter Carl Zornig
1904 Polizeisergeant Höher
1904 Polizeisergeant Bero
1904 Polizeisergeant Dettmer
1903-1909 Feldhüter und Polizeidiener J.- W. Hans Mohr, Kätner
1905-1911 Fleckens- und Polizeidiener, Polizeisergeant Wilhelm Scheel (Maurermeister aus Lentföhrden)
1908-1909 berittener Gendarmeriewachtmeister Benz
1909 Amtsdiener und polizeilicher Exekutivbeamter Naeve aus Hitzhusen
1909 Kätner und Schumacher Heinrich Fiehmann aus Hagen Amtsdiener und polizeilicher Exekutivbeamter
1911-1928 Feldhüter, Nachtwächter, Polizeisergeant, Polizeibetriebsassistent Heinrich Kahl
früherer Korbmacher, einige Jahre auch für das Entleeren der „Closeteimer“ des Amtsgerichts zuständig
1911-1926 Polizeibetriebsassistent, Polizeisergeant Feddern
1912 Feld- und Forstpolizeibeamter Köppler
1913-1928 berittener Gendarmeriewachtmeister Hermann Gustav Renz (9. Gendarmerie-Brigade, Kiel’er Offizier-Distrikt, Segeberg’er Beritt) (1928 a.D., 1947 †)
1925 Landjägermeister a. D. Bensemann
1925-1938 Hilfspolizeibeamter und Nachtwächter Fritz Niels, auch als Hausmeister für das Amtsgerichtsgebäude zuständig, wie Heinrich Kahl
1927-1928 Landjägermeister Wilhelm Bergemann
1927-1928 Oberlandjäger Ludwig Christiansen
1927-1928 Oberlandjäger Heinrich Zinke
1928 Feldhüter Johann Delfs
1926-1941 Polizeiverwaltungssekretär, Polizeiassistent, Polizeihauptwachtmeister Wilhelm Meinke
1930-1938 Polizeioberwachtmeister Hans Ahlers
1931-1943 Polizeimeister, Polizeihauptmeister Kruse
1933-1947 Polizeiobermeister, Polizeihauptmeister, Meister der Schutzpolizei Glass
1935-1937 Polizeioberwachtmeister Georg Ehmke, Polizeihauptwachtmeister
1935-1953 Meister der Schutzpolizei, Polizeimeister Heinrich Krohn
1936-1937 Polizeiwachtmeister Christiansen
1944 Gefängnisaufseher a.D. August Prinz (†)
Chausseewärter
1835 Johann Christian Quistorf
1845 Chausseeinspektor Friedrich Henning Bruhn
1855 Daniel Fedderling
1855-1860 Chausseeaufseher Hinrich Meyer
1860 Chausseeaufseher August Leemann
Musiker
1803 Mietsmann und Fleckensmusicus David Franck
1835 Inste Hans Hinst
1835 Inste Hinrich Grothoff
1845 Klempner Johann Frauen
1845 Sattler Friedrich Seller
1845 Maler Carl Boye
1855-1860 Weber Carl Böge
1855-1860 Hans Hintz
1860-1867 Jasper Kröger
1880 Friedrich Moltzen
Nachtwächter (ohne Nennunng in Bramstedt)
1835 Inste Thies Bartels
1835 Inste Friedrich Hohnschildt
1845 Schuster Dethlev Wischmann
1845 Johann Brockmann
1855 Hinrich Wrage
1860 Christian Wulf
1860 Christian Brockmann
1860 C. Stegemann
1875 H. Stegemann in Bramstedt, vermutlich Sohn des C. Stegemann
1875 H. Voss
1875-1888 Constantin Westpfahlen
1881-1925 Johann Harneit
1886 H. Wagner in Bramstedt
1890 Kätner Ludolf Weber in Weddelbrook
1891 Marx Röhr in Hitzhusen
1891 Pensionär Cl. Stoffensen in Hitzhusen
1892 Heinrich Lembcke in Weddelbrook
1892 Arbeiter Julius Voss in Föhrden-Barl
1892 Inste und Arbeiter Marcus Suhr in Föhrden-Barl
1892 Arbeiter Hans Lohse in Hagen
1892-1894 Arbeiter Hans Götze in Hitzhusen
1893 Niklas Mäckelmann in Fuhlendorf
1894 Inste und Arbeiter Johann Mäckelmann in Hitzhusen
1896 Inste und Arbeiter Detlev Schmidt in Föhrden-Barl
1897 J. Gülck in Hagen
1897 Kätner und Tischler Heinrich Köhnke in Hagen
1898 Kätner und Arbeiter Johannes Wieckhorst in Hagen
1899 Inste und Arbeiter Wilhelm Blunck in Föhrden-Barl
1900 Arbeiter Wilhelm Körner in Hagen
vor 1902 Steenbock
1902-1911 Kätner Johannes Doll
1910 Kätner Marcus Fölster in Föhrden-Barl (vorher jahrelang unbesetzt)
1912 Franz Fiereck
1915 Heinrich Kahl (siehe auch Polizei)
1925-1938 Hilfspolizeibeamter Fritz Niels
Fleckensvorsteher von Bramstedt
1627 Marx Fölster
1627-1631 Claus Hardebeck
1781 Hinrich Klug
1781 ⅓ Hufner Christian Friedrich Thomsen
1799 19/96 Hufner Marcus Nicolaus Lück
1799-1800 Christian Köhn
1799-1801 ⅓ Hufner Jürgen Zimmer
1814-1825 Gastwirt Hans Schröder
1817-1823 19/96 Hufner Hinrich Meyer
1823-1825 Hermann Wesselmann
1825-1831 ⅓ Hufner Peter Fölster
1826-1831 Friedrich Schmidt
1831-1837 ⅓ Hufner Jochim Hinrich Fuhlendorf
1832-1841 Jasper Wilckens, 19/96 Hufner und Viehhändler
1837-1843 ⅓ Hufner Jochim Friedrich Michael Lamack
1838-1842 ⅓ Hufner Jürgen Kröger
1842-1848 ⅓ Hufner Johann Schmidt
1842-1849 ⅙ Hufner Marx Fölster, Tischlermeister
1848-1854 Friedrich Gerhard Remien (Halbhufner und Gastwirt)
1849-1855 Hinrich Johann Bassmann (½ Hufner)
1854-1860 ⅓ Hufner Claus Detlef Langhinrichs
1855-1861 ⅓ Hufner Paul Nicolaus Schmidt
1860-1866 ⅓ Hufner Johann Lembke
1861-1867 ⅙ Hufner Jochen Stäcker
1866 ⅓ Hufner Johann Timmermann
1867-1869 ⅓ Hufner Johann Schümann, ⅓ Hufner F. Vossbeck
Ratmänner von Bramstedt
1530 Claus Steckmest, Hans Bulte, Laurenz Stüwing, Tim Schulte
1565 Klaus Hardebeck, Markus Steckmest, Hinrich Rolefinck, Christoffer Hamerich
1566 Dirk Rolefinck
1627-1631 Hans Bulte, Claus Hardebeck, Claus Steckmest, Marx Fölster
1631 Hinrich Rolefinck, Marquardt Steckmest, Christoffer Hamerich
1639 Hans Pohlmann
1649-1650 Gerd Westphalen
1650 Hans Finck
1654 Jasper Hennings
1661 Hans Fuhlendorf, Klaus Maes, Frenß Hardebeck, Albert Bartels
1664 Hinrich Bult, Hans Schack, Claus Steckmest
1673 Harm Götsche, Hans Hardebeck, Mattias Böttiger, Jasper Hennings
1676 Ties Langhinrichs, Jürgen Fuhlendorf, Jasper Wulf
1676-1682 Carsten Trede
1679-1682 Hinrich Bult, Johann Rölfinck, Hans Hartmann, Detlef Voß
1682 Jürgen Fuhlendorf, Hans Hardebeck, Jasper Fölster, Claus Voß (für Trede), Ties Langhinrichs
1690 Hartwig Fölster, Johann Pohlmann, Hans Hardebeck, Bernd Lechell
1690 Ties Langhinrichs, Claus Mass, Jasper Stüven, Marx Westphalen
1690-1693 Detlef Voß
1691-1693 Hans Steckmest
1693 Jürgen Fuhlendorf, Hans Fehrs
1694 Thomas Thomsen, Christian Hamerich, Johann Wettse, Hans Langhinrichs
1696-1798 Franz Fuhlendorf, Hinrich Körner, Arend Wulff, Hinrich Stelling
1698 Jürgen Fuhlendorf, Claus Steckmest, Jasper Fölster, Claus Maehs
1700 Tim Langhinrichs, Marx Westphalen, Bartold Dittmer, Hinrich Stäcker
1702 Claus Boy, Hans Stüven, Jochim Stüven, Marx Steckmest
1704 Peter Wichmann, Johann Langhinrichs, Johann Hartmann, Christian Albrecht Bartels
1706 Hans Mohr, Jürgen Runge, Andreas Harders, Andreas Wittorf
1708 Casper Harm Bostel, Jasper Stüven (Rademacher), Frenß Fulendörp, Dirk Mass
1708 Jasper Steffens
1710 Hans Wulf, Lorenz Behrens, Hans Fuhlendorf, Marx Finckenbrinck
1712 Marx Westphalen, Hans Götsche, Dirk Brömmer, Marx Lindemann
1713 Jürgen Runge
1714 Jochim Stüven, Christian Albrecht Bartels, Jasper Fock, Claus Preuss
1716-1718 Albrecht Wichmann, Marx Finkenbrinck, Marx Steckmest, Andres Wittorf
1717-1719 Hans Götsche, Claus Fehrs
1718-1720 Hans Mohr, Johann Hamerich
1719-1721 Claus Ratgen, Carsten Stammerjohan, Hans Götsche
1720-1722 Hans Fuhlendorf, Jochim Fehrs
1721 Johann Hartmann
1721-1723 Hartwig Stüven
1722-1724 Albrecht Wichmann, Hans Fölster, Hans Fuhlendorf
1723 Johann Hartmann, Claus Boy Hogedoor, Andreas Wittorf
1724-1726 Jürgen Lindemann, Casper Harm Borstel
1725-1727 Hans Götsche, Hans Mohr, Claus Boy, Johann Hartmann
1726-1728 Jens Brandt, Hans Boy
1727-1729 Claus Boy aufn Berg, Marx Steffen, Hans Götsche
1728-1730 Johann Asmus Thomsen, Jochim Göttsche, Hans Boy
1729-1731 Jasper Delfs, Hinrich Ohrdt
1730-1732 Claus Stäcker, Hartwig Stüven
1731 Hans Mohr
1731-1733 Andreas Wittorf, Dirk Brömmer
1732-1734 Detlef Lück, Hinrich Reimers
1733-1735 Hermann Hinrich Hartmann
1733-1735 Casper Fölster
1734-1736 Christian Hamerich, Jasper Stüven
1735-1737 Jürgen Fuhlendorf, Johann Jochim Hartmann
1736-1738 Henning Borgert, Michel Stüven
1737-1739 Johann Hartmann (Altenteiler), Hans Meyer
1738-1740 Christian Hasche, Claus Harders
1739 Johann Hartmann, Hans Meyer
1739-1741 Marx Schümann, Johann Pingel
1740-1742 Hinrich Behrens, Johann Langhinrichs
1741-1743 Hans Fehrs, Asmus Dickmann
1742-1744 Nikolaus Michael Frauen, Jochim Kröger
1743-1745 Hans Hartmann, Marx Boy, Marx Böge
1744-1746 Hans Fuhlendorf, Marx Westphalen
1745 Christian Friedrich Thomsen, Jochim Witt, Marx Böge
1746 Hans Langhinrichs, Marx Steckmest
1747 Hans Friedrich Götsche, Albert Löck (Lück)
1748 Albrecht Bartels, Marx Dammann
1749 Jürgen Beckmann, Hans Boy
1750 Jochim Schweim, Johann Steckmest
1751 Hinrich Fehrs, Christian Lange
1752 Hans Stäcker, Claus Stüven, Arend Wulf
1753-1754 Claus Fock, Claus Klank
1754 Claus Boye, Jürgen Fuhlendorf
1755 Hans Hinrich Bracker, Johann Hinrich Matthias Ziegenbein
1755-1757 Hermann Hinrich Hartmann
1756 Klaus Bade, Jochim Westphalen
1757 Carl Philipp Grimm
1758-1759 Peter Bollen, Christian Friedrich Zimmer
1759 Franz Hass, Nicolaus Meyer
1760 Hinrich Fuhlendorf, Hinrich Ramm
1761 Daniel Klutmann, Matthias Meyer
1762 Hinrich Hartmann, Marx Reimers
1763 Lorenz Köster, Hinrich Lahann
1764 Hinrich Behrens, Hinrich Westphalen
1765 Hans Hinrich Köster, Jasper Stüven
1766-1767 Jochim Hamerich, Casper Hardebeck
1767 Johann Jochim Hartmann, Jürgen Witt
1768 Jochim Meyer, Hans Todt
1768-1772 Hinrich Mohr, Jürgen Zimmer
1770-1772 Johann Lamack, Jochim Meyer
1771-1772 Marx Blunck, Wilhelm Nagel
1772 Claus Fehrs, Johann Westphalen
1773 Casper Langhinrichs, Hinrich Schümann
1773-1779 Jochim Lohse
1773-1786 Nicolaus Meyer
1774 Johann Matthias Geistmann
1775 Jochim Hinrich Hartmann
1776 Johann Daniel Klutmann, Peter Zimmer
1778 Johann Matthias Geistmann
1778-1788 Marx Blunck
1779 Hinrich Meyer
1780 Hinrich Langhans
1781 Christian Friedrich Thomsen
1782 Hinrich Klug
1783 Johann Pingel
1784-1786 Claus Steckmest
1785-1786 Hinrich Fuhlendorf
1786 Hans Hinrich Meyer
1787-1788 Hinrich Dehnkamp
1787-1789 Hans Hinrich Bracker
1788-1790 Johann Grimm, Asmus Jessen
1789-1790 Hinrich Ramm
1789-1791 Marx Pingel
1791 Hans Sülau
1791-1793 Hans Christian Bolling
1792-1793 Hinrich Lindemann, Johann Steckmest
1793-1797 Marcus Nicolaus Lück
1795-1796 Jürgen Michael Goldbeck, Johann Meyer
1795-1797 Hans Hinrich Ziegenbein
1796-1798 Hinrich Dütsch, Hans Schröder
1797-1799 Hans Hardebeck, Carl Rumohr
1798-1799 Marx Stäcker
1798-1800 Jasper Fischer
1799-1800 Christian Köhn
1799-1801 Hinrich Sievert, Jürgen Zimmer
1800 Hinrich Mohr
1801 Hans Götsche
1801-1804 Hans Steckmest im Bleeck
1803 Jochim Lahann
1803-1805 Johann Hinrich Reimers
1804 Jochim Hinrich Fuhlendorf
1804-1805 Hinrich Studt
1805 Johann Hinrich Lamack, Christopher Mohr
1808 Paul Schmidt
1810 Jürgen Biehl, Marx Fölster
1810-1811 Anton Schmidt
1810-1812 Hans Larsen
1810-1813 Hinrich Steckmest
1811 Claus Fock ausm Tor, Claus Möller
1811-1813 Hinrich Geistmann, Hinrich Meyer
1812-1814 Claus Horns, Claus Steckmest, Hinrich Meyer
1813-1815 Johann Hinrich Micheels, Hinrich Plambeck
1814 Hans Schröder
1814-1816 Friedrich Köhnke
1815-1817 Jacob Steenbock
1816-1818 Andreas Frauen
1817-1819 Johann Kröger
1818-1820 Claus Siems
1819-1821 Jochim Mohr sen.
1820-1822 Hans Hartmann
1821-1823 Hans Hinrich Bracker
1822-1824 Hans Ramm
1823-1825 Johann Casper Stäcker
1824-1826 Hans Bolling
1825-1827 Hans Schlüter
1826-1828 Marx Ramm
1827-1829 Jochim Mohr
1828-1830 Casper Todt
1829-1831 Hans Bülck
1830-1832 Franz Bremer
1831-1833 Friedrich Lamack
1832-1834 Jürgen Zimmer
1833-1835 Jochim Tietjens
1834-1836 Jürgen Kröger
1835-1837 Jochim Mohr
1836-1838 Christopher Lorenzen
1837-1838 Jochim Hinrich Lahann
1838-1840 Gerd Westphalen
1839 Hinrich Fuhlendorf
1840-1841 Johann Wulf Dehn
1840-1842 Johann Köhnke
1841-1843 Hinrich Dehnkamp
1842-1844 Hans Hinrich Geerdt
1844-1846 Hinrich Wiese
1843-1845 Hans Hinrich Bracker
1845-1847 Hans Reimers
1846-1848 Hans Gripp
1847-1849 Johann Hinrich Reimers
1848-1850 1/3 Hufner Hans Stüben
1850-1852 1/3 Hufner Hinr. Scharffenberg
1849-1851 Johann Diedrich Höppke
1851-1854 Detlev Wegener
1852-1853 1/3 Hufner Claus Biehl
1853-1855 H. Rathjen
1854-1856 1/3 Hufner Jasper Rawe
1855-1857 1/6 Hufner Jochim Hinrich Stäcker
1856-1858 Johann Hinr. Kruse
1857-1859 1/3 Hufner Johann Lembcke
1858-1860 1/3 Hufner Jürgen Mohr
1859-1861 1/3 Hufner Hans Friedr. Bülck
1860-1862 1/3 Hufner Jochen Lahann
1861-1863 1/3 Hufner Claus Siems
1862-1864 ⅓ Hufner Jochim Rohlfs
1863 ⅓ Hufner Fr. Lepper (?)
1863-1865 Claus Voß
1864 ⅓ Hufner Jürgen Zimmer
1865-1867 ⅓ Hufner Ludwig Kophahl
1870 Burmeister, Voßbek
Achtmänner
1810-1813 ⅓ Hufner Claus Mohr
1810-1813 ⅓ Hufner Hinrich Plambeck
1811 Hinrich Geistmann
1811 19/96 Hufner Hinrich Meyer
1811-1813 ½ Hufner Johann Hinrich Micheels
1811-1816 ⅓ Hufner Andreas Frauen
1811-1820 Gastwirt G. E. Axt
1812 Claus Horns
1812-1814 ⅓ Hufner Friedrich Köhnke
1813-1819 ⅓ Hufner Jochim Mohr, bei der Mühle
1815-1817 ⅙ Hufner Johann Kröger
1815-1821 ⅓ Hufner Hans Hinrich Bracker
1816-1820 ⅓ Hufner Hans Hartmann
1817-1825 ⅓ Hufner Hans Schlüter
1818-1820 Andreas Richter
1818-1824 ⅓ Hufner Hans Bolling
1820-1822 ⅓ Hufner Hans Ramm
1820-1826 ⅓ Hufner Hans Steckmest
1820-1827 ⅓ Hufner Jochim Mohr, bei der Kirche
1821-1826 ⅓ Hufner Marx Ramm
1822-1830 Franz Bremer
1823-1829 ⅓ Hufner Hans Bülck
1824-1828 Hutmacher Johann Hinrich Kröger
1826-1835 ⅓ Hufner Jochim Mohr, im Bleeck
1827-1837 ⅓ Hufner Jochim Hinrich Lahann
1828-1833 ⅓ Hufner Jochim Jargstorf
1828-1834 ⅓ Hufner Jürgen Kröger
1829-1831 ⅓ Hufner Friedrich Lamack
1831-1836 ½ Hufner Claus Schlüter
1832-1838 ⅓ Hufner Detlef Kröger
1833-1836 Schlachtermeister und 7/92 Hufnert Christopher Lorenzen
1833-1840 ⅓ Hufner Johann Wulf Dehn
1834-1838 ⅓ Hufner Andreas Pingel
1835-1839 ⅓ Hufner Hinrich Fuhlendorf
1836-1840 ⅓ Hufner Johann Köhnke
1836-1841 ⅓ Hufner Hinrich Dehnkamp
1838-1842 ⅓ Hufner Hans Hinrich Geerdt
1839-1844 ⅓ Hufner Johann Hinrich Pape
1840-1845 ⅓ Hufner Hans Reimers
1840-1846 ⅓ Hufner Hans Gripp
1841-1847 ⅓ Hufner Johann Hinrich Reimers
1843-1845 ⅓ Hufner Hinrich Harbeck
1844-1849 ⅓ Hufner Johann Diedrich Höppke
1845-1850 ⅓ Hufner Hinrich Scherffenberg
1847-1853 ½ Hufner Hans Rathjen
1848 ⅓ Hufner Hans Stüben
1848 ⅓ Hufner Jasper Raabe
1849-1855 ⅙ Hufner und Tischlermeister Jochim Hinrich Stäcker
1850 H. Steckmest (1850 †)
1850-1857 ⅓ Hufner Johann Lembcke
1850-1856 ⅓ Hufner Joh. Hinr. Kruse
1851 ⅓ Hufner Detlev Wegener
1851-1858 ⅓ Hufner Jürgen Mohr
1852 ⅓ Hufner Claus Biehl
1852-1859 ⅓ Hufner Hans Friedr. Bülck
1853-1858 7/72 Hufner Hans Lorenzen (1858 †)
1854 Jasper Rawe
1854-1856 ⅓ Hufner Hans Steckmest (1856 †)
1854-1861 ⅓ Hufner Claus Siems
1855-1860 ⅓ Hufner Jochim Lahann
1856-1861 ⅓ Hufner Jochim Rohlfs
1856 Johann Hinr. Kruse
1856-1863 Claus Voss
1857-1860 ⅓ Hufner Heinrich Bülau (1860 wegen Konkurs ausgeschieden)
1858-1864 ⅓ Hufner Jürgen Zimmer
1858-1866 ⅓ Hufner Christian Köhncke
1859-1865 ⅓ Hufner Ludwig Kophahl
1860-1863 ⅓ Hufner Hans (?) Braker (1860 †)
1860-1866 ⅓ Hufner Johann Schmidt
1861-1867 ⅓ Hufner Hinr. Krauel
1863 ⅓ Hufner Gosau
1864-1866 ⅓ Hufner Joh. Schümann
1865-1866 ⅓ Hufner Johann Lamaak
1866 Claus Schlüter
1866 Hans Dehn
1866 Hans Rathjen
1867 ⅓ Hufner Otto Fölster
Assistent
1772 Hans Langmack
1773 ⅓ Hufner Hans Hinrich Möller
1776 ⅓ Hufner Hans Stüven
1786-1787 ⅓ Hufner Hinrich Dehnkamp
Lagemann (15.-17. Lage)
1811-1812 Christian Peterich
1811-1814 ⅓ Hufner Hans Ramm, ⅓ Hufner Hans Hinrich Bracker
1812-1814 1/12 Hufner Jürgen Dütsch
1814-1817 Tim Kracht, Hinrich Geistmann, Hans Dehn
1817-1820 ⅓ Hufner Marx Fölster, Claus Delfs, ½ wüste Hufe, Kätner Casper Bracker
1820-1823 Steffen Lorenzen, ½ wüste Hufe, ⅓ Hufner Jochim Hinrich Lahann, Hr. Finnern
1823-1826 Fr. Holm, Freikätner Diedrich V. Dammann, 1/12 Hufner Hinrich Bassmann
1826-1829 ⅓ Hufner Hans Siems, Tischler und ⅓ Hufen-Setzwirt Hinrich Kröger, ⅓ Hufner Hinrich Fuhlendorf
1829-1832 ⅓ Hufner Andreas Pingel, ⅓ Hufner Detlef Kröger, ⅓ Johann Wulf Dehn
1832-1835 ⅓ Hufner Jochim Reimers, ⅓ Hufner Johann Köhnke, ⅓ Hufner Hinrich Dehnkamp
1835-1838 ⅙ Hufner und Schustermeister Jasper Schmidt,⅓ Hufner Hans Bülk, ⅓ Hufner Johann Hinrich Beeken
1838-1841 ⅓ Hufner Johann Hinrich Reimers, ⅓ Hufner Claus Rathjen, ⅓ Hufner Jochim Hinrich Hartmann
1841-1844 ⅙ Hufner Jochim Hinrich Stäcker, ⅓ Hufner Marx Rehder, ⅓ Hufner Johann Lembke
1844-1847 7/72 Hufner Hans Lorenzen, ⅓ Hufner Johann Hinrich Kruse, 1/12 Hufner Johann Hinrich Bassmann
1847-1850 Tim Köhncke, ⅓ Hufner Claus Hinrich Siems, 7/72 Hufner und Bäcker Joc. Friedrich Delfs
1850-1853 ⅓ Hufner Joch. Lahann
1850-1853 Kätner Joh. Böge
1850-1853 Schuster Casp. Hartmann
1853-1858 ⅓ Hufner Heinrich Krauel
1853-1858 1/18 Hufner F. Holm
1853-1858 27/44 Hufner August Wilckens
1858-1864 ⅓ Hufner Detlev Wegner
1858-1864 ⅓ Hufner Joh. Schmidt
1858-1864 ⅓ Hufner Hinr. Steckmest
1864 ⅓ Hufner Hans Stüben
1864 ⅓ Hufner Matthias ?
1864 ⅓ Hufner P. Gielow
Bonitierungsmann
1776-1797 Hinrich Mohr
1778-1809 ⅓ Hufner Johann Steckmest
1787-1807 ⅓ Hufner Hans Stüven
1794 ⅓ Hufner Johann Meyer
1800 Marx Stäcker
1802-1807 ⅓ Hufner Johann Gülck
1803-1809 ⅓ Hufner Jürgen Kröger
1811 Hinrich Mulck, Claus Thiess
Brandaufseher
1827-1828 ⅓ Hufner Johann Harder, ⅓ Hufner Johann Hinrich Pape
1828-1829 Freikätner und Schneidermeister Johann Garling, ⅓ Hufner Gerd Westphalen
1830-1831 ⅓ Hufner Casper Bestmann
1829-1830 Freikätner Diedrich V. Dammann, ⅓ Hufner Johann Köhnke
1830-1831 ⅓ Hufner und Gastwirt Johann Schmidt
1831-1832 Gutsfreikätner Hinr. Böye, ⅓ Hufner Hinrich Fuhlendorf
1832-1833 ⅙ Hufner und Schustermeister Jasper Schmidt, ⅓ Hufner Casper Todt
1833-1834 ½ Hufner Hinrich Schümann, Kätner und Sattler Jochim Steckmest
1834-1835 ⅓ Hufner Hans Hinrich Geerdt, Katensetzwirt und Schlosser Hans Jochim Studt
1835-1836 Kaufmann Jochim Hans Friedrich Heldberg, ⅓ Hufner Hinrich Wiese
1836-1837 Böttcher und Kätner Christian Kröger, ⅓ Hufner Claus Rathjen
1837-1838 ⅓ Hufner Georg Heinrich Bremer, Kätner Matthias Heesch
1838-1839 Tischler und ⅓ Hufe-Setzwirt Hinrich Kröger, Glaser Friedrich Meyer
1839-1840 ⅓ Hufner Johann Diedrich Höppke, Kätner und Schlachtermeister Hans Hinrich Rumohr
1840-1842 Gutskätner und Grobschmied Christian Lamack, Kätner und Fuhrmann Hinrich Reimers
1842-1844 Kätner und Zimmermeister Johann Hinrich Siegfried, ⅓ Hufner Jürgen Zimmer
1844-1846 ⅓ Hufner und Zimmermeister Johann Christoph Benthin, Kätner Jasper Rickert
1846-1848 ⅓ Hufner Paul Nicolaus Schmidt
1846-1848 Kätner und Grobschmied Friedrich Vossbeck
1848-1850 Kätner und Schustermeister Jochim Meyer
1848-1850 ⅓ Hufner Hinrich Steckmest
1850-1852 ⅓ Hufner Joh. Gosau
1850-1852 Nicol. Meyer
1852-1854 Schlachtermeister und 1/3 Hufner Jochim Hartmann
1852-1854 Kätner Johann Fölscher
1854 ⅓ Hufner Tim Köhncke
1854 Kätner Fritz Zeller
1859-1861 ⅓ Hufner Hinrich Kruse
1859-1861 Kätner und Bäcker Heinr. Kophahl
1861-1863 ⅓ Hufner Johann Schümann
1861 Schlosser ? Kroeger
1861-1863 Schneidermeister Fr. Garling (für Kroeger)
1863-1866 Kätner Cl. Göttsch
1863-1866 ⅓ Hufner Pape
1866 Jürgen Zimmer
1866 Thrams (?)
Hebammenkurator
1818-1822 Kätner Friedrich Meyer
1822-1841 ⅓ Hufner Friedrich Wulfhagen
1841-1844 1/6 Hufner und Schustermeister Jasper Schmidt
1844-1845 ⅓ Hufner Marx Rehder
1845-1848 Kätner und Kaufmann Heinrich Wulff
1848-1850 ⅓ Hufner und Gastwirt Franz Heinrich Jahnke
1850 Zimmermeister J. C. Benthien (1850 fortgezogen)
1851-1854 Schustermeister Jochim Huss
1854-1857 ½ Hufner und Gastwirt Remien
1857-1860 ⅓ Hufner und Glaser Wilhelm Pape
1860-1863 Kätner und Zimmermeister M. Burmeister
1863-1866 Kätner N. D. Wulff
1866 A. Lindemann
Armenvorsteher
1810 Hr. Saggau
1810-1812 Andreas Richter
1811 Christoph Dehn
1811-1813 Christian Lamack
1812-1814 ⅓ Hufner Siegfried Nebelung
1813-1815 Kätner Casper Bracker
1814-1818 ⅓ Hufner Friedrich Wulfhagen
1815-1817 ⅓ Hufner Hinrich Studt
1817-1819 ⅓ Hufner Jochim Mohr, im Bleeck
1818-1820 Tim Kracht
1819-1821 Kätner Hinrich Bassmann
1820-1822 Franz Bremer
1821-1823 1/12 Hufner Hermann Wesselmann
1822-1824 ⅓ Hufner Peter Fölster
1823-1825 Tietje Backhuus
1824-1826 Freikätner und Buchbinder Wilhelm von Einem
1825-1827 Paul Schmidt
1826-1828 Jochim Hinrich Fuhlendorf
1827-1829 Freikätner und Schustermeister Jacob Greve
1828-1830 ½ Hufner Hinrich Schümann
1829-1831 ⅙ Hufner Jasper Wilckens
1830-1832 ⅓ Hufner Johann Harder
1831-1833 Gutskätner Marx Warnholz
1832-1834 ⅓ Hufner Claus Siems
1833-1834 Bäckermeister und Kätner Heinrich Kophal
1834-1835 ⅓ Hufner Johann Diedrich Höppke
1834-1836 ⅓ Hufner Hinrich Micheels
1836-1838 ⅓ Hufner und Gastwirt Johann Schmidt
1837-1839 Kätner Claus Detlef Langhinrichs
1838-1840 Kaufmann Jochim Hans Friedrich Heldberg
1839-1841 ⅙ Hufner Johann Kröger
1840-1842 ⅙ Hufner und Tischlermeister Marx Fölster
1841-1843 Glaser Friedrich Meyer
1842-1844 Gutskätner und Handelsmann H. Bernhard
1843-1845 Kätner und Färbermeister Casper Schmidt
1844-1846 ⅓ Hufner Claus Rathjen
1845-1847 Bäckermeister und Kätner Heinrich Kophal
1846-1848 ⅓ Hufner Hans Hinrich Bracker
1847-1849 Freikätner und Schustermeister Jacob Greve
1849-1851 Müller Nicolaus Friedrich Paustian
1848-1850 Kätner und Handelsmann Hinrich Reimers
1850-1852 Kaufmann Heinz Wulf
1851 Bäckermeister Friedrich Delfs oder Schustermeister Hans Lorenzen
Fleckensverordnete von Bramstedt
1870 Wilckens, Baßmann, Lindemann, Peiserich, Thomsen und Langhinrichs
Fleckensbeamte/städtische Beamte von Bramstedt
1835-1840 Kirchspielsvogtei- und Fleckensdiener Hans Steckmest
1840-1856 Fleckensdiener Jacob Rickert
1856-1862 Fleckensdiener August Warnholz
1868-1889 J. E. Wolf Fleckensschreiber, Hebammenkurator, Fleckenskassierer, Rechnungsführer, Polizeischreiber, Polizeianwalt (Polizeiverwalter) und (bis 1875) Standesbeamter (Standesamtsbezirk Landbezirk Bramstedt)
-1890 Standesbeamter Bassmann (Standesamtsbezirk Bramstedt, aufgelöst 1890)
-1903 Fleckenskassierer Carl Seller
1904 Fleckenskassierer Uhrmacher Gustav Mohn
1904-1909 Waisenpflegerin Schwester Charlotte Marxen
1909 Waisenpflegerin Schwester Magda Radloff
1926 Obersekretär Helms
1928 Stadtkassenrendant Gustav Mohn
1927-1944 Oberstadtsekretär, Stadtinspektor Friedrich Parbst
1936-1938 Verwaltungsgehilfin Jeronimus
1938 Stadtkassierer Herbert Schramm
Bürgermeister von Bad Bramstedt
1448 erste Nennung eines Bürgermeisters in einer Urkunde
1530 Dirk Vaget
1533 keine Erwähnung eines Bürgermeisters im ersten erhaltenen Fleckensprivileg
1870-1879 Johann Schümann, Inhaber des Holsteinischen Hauses
1879-1909 Gottlieb Carl Christian Freudenthal, Standesbeamter
1909-1913 Karl Ernst Rhode, erster hauptamtlicher Bürgermeister, Standesbeamter
1914-1926 Reimer Jensen
1926-1932 Wilhelm Friedrich (Wilfried) Erlenhorst (1890-1949)
1932-1933 Hermann Maaß, noch 1933 kommissarisch
1934-1937 Friedrich Utermarck
1938-1945 Karl Dittmann
1945-1946 Alfred Warnemünde (FDP), ehrenamtlich
1946-1948 Carl Freudenthal (CDU), ehrenamtlich
1948-1950 Fritz Neumann, ehrenamtlich
1950-1964 Heinrich Gebhardt
1964-1976 Herbert Endrikat
1976-1982 Heinz Wedde
1982-2001 Udo Gandecke
2001 -2019 Hans-Jürgen Kütbach
ab 2019 Verena Jeske
Bürgervorsteher
1950-1951 Kurt Neumann (FDP)
1951-1952 Otto Möding (CDU)
1952-1955 Heinrich Papke (GDP)
1955-1958 Otto Kruse (CDU)
1958-1961 Helmut Schnack (CDU)
1961-1963 Otto Kruse (CDU)
1963-1966 Alfred Lieck (CDU)
1966-1971 Helmut Schnack (CDU)
1970 Wilhelm Gasde (am 14. Mai 1970 gewählt, Rücktritt am 6. Juni 1970, da als Stadtrat gewählt)
1971-1979 Günter Warnemünde (CDU)
1979-2003 Friedmund Wieland (CDU)
seit 2003 Annegret Mißfeldt (CDU)
Stadtdirektor
1945-1947 Wilhelm Meinke
1947-1950 Hermann von Lübcken
Armenverband
1864 Armenpfleger Bülk
1871 Kassierer der Armenkasse Hinrich Steckmest
Von der Kirchspielvogtei bis zum Amt
Bauernvögte bis 1869, Ortsvorsteher/Gemeindevorsteher bis 1933, ab 1933 Bürgermeister
Armstedt
1615-1627 Jasper Lindemann, Hufe I
1637-1659 Franz Hardebeck, Hufe II
1722-1740 Vollhufner Marx Dammann, Hufe 2, klösterlich
1754-1784 Vollhufner Carsten Todt
1760-1767 Vollhufner Marx Dammann, Hufe II, klösterlich
1784-1793 Vollhufner Carsten Todt (Sohn)
1793-1807 Vollhufner Hans Schümann
1794 Marx Fischer, klösterlich
1797 Hans Harbeck
1814 Johann Wilkens
1829-1835 Hufner Hans Schümann, königlich
1829-1842 Hinrich Siemen, klösterlich
1839 Hans Schümann
1845 Hufner Hinrich Schümann
1845-1870 Vollhufner Andreas Siemen. klösterlich
1867 H. Mehrens
1871 Carsten Todt
1875 Runge
1877-1878 M. Homfeldt
1897 M. Rave
1906-1912 Schümann
1915/6-1933 Hinrich Johannes Saggau
1946-1947 Johannes Möckelmann
1949 Gustav Holtorf
1953 Otto Schümann
1959-1982 Hans Breiholz
1982-2003 Uwe Timmermann
2003-2013 Manfred Lüders
ab 2013 Maren Horstmann
Bimöhlen
1637-1638 Hartig Runge
vor 1680 Vollhufner Hinrich Runge
1680 Vollhufner Hinrich Runge
1720 Joachim Runge, geringer Krüger
1797-1835 Hufner Hinrich Schäfer
1845-1867 Hufner Hans Schäfer, Sohn des Hinrich Schäfer
1876 J. H. Marsen
1877-1878 Schönfeldt
1878-1879 Wilhelm Davids, stellvertretender Ortsvorsteher
1882-1888 Wilhelm Davids
1900-1915 Johann August Jaspers
1915-1920 Wilhelm Wiese
1920-1921 Johann Christian Jonas
1921-1945 Gustav Christiansen
1945-1946 Paul Humfeldt
1946-1947 Otto Oppermann
1947-1948 Matthias Hüttemann (geschäftsführend)
- Hans Reimers
1955 Adolf Runge
1955-1959 Hans Humfeldt
1959-1979 Ernst Schütt
1979-1980 Steffen Möller
1980-1990 Fritz Leitzke
1990-1998 Fritz Rohblick
1998-2003 Rosemarie Jahn
2003-2013 Harmut Opitz
ab 2013 Michael Schirrmacher
Borstel
1605-1629 Hufner Hinrich Runge
1637-1644 Vollhufner Hinrich Runge
1663 Vollhufner Hinrich Bollien, Hufe I
1727 Vollhufner Jürgen Bollien
1767 Vollhufner Hinrich Bollien (Bolling)
1770-1777 Vollhufner Hinrich Bünz
1777-1824 Vollhufner Clas Bünz, Sohn des Hinrich Bünz
1824-1842 Vollhufner Claus Bünz, Sohn des Clas Bünz
1842 Hufner Jasper Delfs
1842-1853 Hufner Jacob Kröger
1853-1861 Hufner Hans Stake
1861-1868 Hufner J. H. Hinrichsen
1868-1875 Hufner Claus Rathjen
1875-1893 Hufner Hans Steffens
1875-1881 Jürgen Ehlers, Stellvertreter
1881-1887 ⅓ Hufner Gottfried Harm, Stellvertreter
1887-1895 Hufner Hermann Rathjen, Stellvertreter
1893-1904 Hufner Hermann Rathjen
1896 Hufner August Krohn, Stellvertreter
1906-1938 Kohn, Claus Jürgen August bzw. dessen Sohn Willi
1939-1944 Kl. Rathjen
1946-1947 Ufer
1949-1953 Otto Schult
1959-1970 Helmut Banck
1971-1987 Werner Kohn
1987-2003 Rudolf Stockhusen
2003-2013 Eckhard Kohn
ab 2013 Ulrich Badde
Föhrden-Barl
1637 Hinrich Castens, Föhrden
1770-1781 Hufner Jürgen Kruse
1797-1827 Hinrich Kruse, Barl
1835-1846 Hufner Paul Rühmann, Barl
1837 Hufner Jochim Krohn, Föhrden
1846-1849 Hinrich Steffens, Föhrden
1849-1859 Hufner Jochim Krohn
1859-1862 Hufner Hans Rühmann
1862-1864 Hufner Johannes Fock
1865-1869 Jacob Koopmann
1869-1875 Hufner Hans Rühmann
1869-1875 Hufner C. Reimers, Stellvertreter
1875-1881 Hufner Hinrich Steffens
1875-1881 Hufner J. Koopmann, Stellvertreter
1881-1887 Hufner Marcus Runge
1881-1887 Hufner Hans Rühmann, Stellvertreter
1887-1892 Eingesessener Johannes Runge
1887-1892 Hufner Hinrich Steffens, Stellvertreter
1893-1898 Hufner Hinrich Steffens
1893 Kätner und Schankwirt Peter Steenbock, Stellvertreter
1898-1910 Markus Studt
1911-1919 Jochim Kelting
1919-1921 Karl Feil
1921 Runge, Stellvertreter
1921-1922 Markus Studt
1922-1935 Wilhelm Runge
1935-1943 Albert Feil
1943-1945 Gustav Blunck
1945-1946 Heinrich Harbeck
1946-1948 Heinrich Rühmann
1948-1951 Max Fölster
1951-1962 Johannes Lohse
1962-1967 Max Fölster
1967-1978 Ernst Kock
1978-1994 Uwe Hinrichs
1994-2008 Jürgen Feil
ab 2008 Hans Jochen Hasselmann
Fuhlendorf
- 1615 Vollhufner Hans Ferst
1629-1637 Vollhufner Marx Böge
1654 Vollhufner Marx Boye
1682 Vollhufner Marx Boye
1742 Karsten Reimers, Hufe II
1749 Hinrich Runge
1812-1829 Jasper Runge
1835-1845 Hufner Hinrich Runge
1846 Hartig Runge, Hufe II
1852 Hufner Jochim Lembke
1862 Hufner Hans Reimer
1867-1875 P. Humfeldt
1875-1881 Jasper Runge
1881-1887 Peter Schümann
1887-1893 Hinrich Reimers
1893-1899 Klaus Runge
1899-1911 Hinrich Reimers
1911-1914 Markus Schümann
1914-1919 Johannes Runge
1919-1936 Markus Schümann
1936-1951 kein Bürgermeister
1951-1958 Gustav Runge
1958-1992 Hans Griep
1992-2018 Werner Lembcke
ab 2018
Großenaspe
1630 Timm Klahn
1709-1726 Hans Voß
1726-1747 Marx Hennings, Schwiegersohn des Hans Voß
1747-1765 Zacharias Hennings, Marx Hennings Sohn
1765-1773 Hinrich Holtorf
1775-1808 Marx Hennings
1808-1817 Diedrich Wilhelm Mohr, Schwiegersohn des Marx Hennings
1817-1834 Hinrich Hinselmann
1834 Jochim Todt
1834-1836 Marx Stocks
1836-1863 C. Dürr
1863-1868 Zacharias Todt
1868-1884 Hinrich Stölting
1884-1900 Joachim Wittorf
1900-1933 Hans Mehrens
1933-1939 Johannes Holtorf
1939-1944 Carl Delfs
1944-1945 Otto Stölting
1945-1946 Hinrich Heinicke
1946-1951 Hans Griep
1951-1974 Otto Stölting
1974-2003 Hans Asbahr
2003-2008 Willi Wisser
ab 2008 Torsten Klinger
Großenaspe, Ortsteil Brokenlande
1768-1770 Hans Rumohr
1770-1800 Jürgen von Sien
1800-1826 Hans Detlef von Sein, dessen Sohn
1826-1860 Claus Mordhorst, Schwiegersohn des Hans Detlf von Sien
1860-1867 Marx Christian Mordhorst, dessen Sohn
1878 H. Speck
1900-1919 Fritz Mester
1920-1923 Otto Schümann
1923-1929 Johannes Witt
1929-1936 Heinrich Schröder, Heinrich Heinitz, Claus Ibs, Hans Carstens, Gerhard Heller
Hagen
1630-1641 Tewes Lindemann
1648 Marx Boye
1673 Claus Fischer
1730 Paul Wickhorst
1750 Johann Thees (Thies)
1785-1800 Johann Thees, jun. (Thies)
1812 Johann Wickhorst
1827 Andreas Wieckhorst
1827-1861 Hufner Claus Möller
1861-1875 Hufner Andreas Wieckhorst
1875-1893 Johannes Ohrt
1875-1892 Johannes Fock, Stellvertreter
1894-1900 Chr. Friedrich Barth
1900 Johannes Ohrt, Stellvertreter
1901-1913 Johannes Ohrt
1913-1933 Hans Rathjen
1916-1917 Johannes Ohrt
1933-1938 Willi Schurbohm (NSDAP), Standesbeamter des Standesamtsbezirk Weddelbrook (auch noch 1945)
1938-1945 August Bracker Willi Schurbohm ?
1945-1946 Anton Rathjen (CDU, kommissarisch)
1946-1949 Karl Barth (CDU)
1949-1951 Fritz Willgerod (SPD)
1951-1970 Detlev Behrens (BHE)
1970-1985 Klaus Hauschildt (CDU)
1985-1986 Gerhard Lange (CDU)
1986-1998 Martin Schott (CDU)
1998-2018 Holger Klose
ab 2018
Hardebek
1784 Vollhufner Hinrich Fölster
1785 Vollhufner Hinrich Harbeck
1785 Vollhufner Hinrich Harbeck, Sohn des Hinrich Harbeck
1806 Jürgen Fehrs
1835 Hufner Claus Harbeck
1845 Hufner Friedrich Baumann
1867 Inspektor Winkelmann
1878 H. Winckelmann
1922-1935 Hermann Itzen
1935-1938 Karl Lindemann
1938-1951 kein Bürgermeister
1951-1982 Karl Bruhse
1982-1998 Kurt Lehmann
1998-2008 Helmut Krüger
2008-2018 Monika Jung
ab 2018
Hasenkrug
1637 Marx Boye
1774 Vollhufner Jacob Fehrs, Sohn des Vollhufners und Bauernvogts Jacob Fehrs
1801 Hans Harders
1803-1845 1½ Hufner Jürgen Fehrs
1849-1870 Vollhufner Marx Fehrs
1875-1877 J. Fehrs
1899-1906 H. Freese
1938-1951 kein Bürgermeister
1953 Richard Gripp
1955-1964 Marcus Johannes Freese
1964-1979 Oskar Ehrenstein
1982-1986 Hans Isenberg
1986-1990 Hans Brandt
1990-2003 Max Wilhelm Freese
ab 2003 Bernd Aszmoneit
Heidmoor
1951-1955 Walter Seelbach
1955-1966 Ferdinand Bajorat
1966-1990 Edo Menken
ab 1990 Karl Menken
Hitzhusen
1637 Tim Boye
1781-1783 Vollhufner Hans Witt
1800 Carsten Reimers
1801 Vollhufner Hans Lindemann
1814 Otto Todt
1834 Hans Lindemann
1837 Vollhufner Hinrich Lindeman
1854 Harder
1874-1903 Hufner Claus Harms
1874-1880 ¼ Hufner H. Hauschildt, Stellvertreter
1882-1894 Hufner P. Wickhorst, Stellvertreter
1894 ¼ Hufner Claus Hauschildt, Stellvertreter
1908-1927 J. Paap
1927-1933 HinrichMöller
1934-1944 Heinrich Lindemann
1945-1948 Ernst Schümann
1948-1974 Gottlieb Freudenthal
1975-2008 Horst-Günther Hunger
ab 2008 Claudia Peschel
Mönkloh
1630 Vollhufner Hans Ties
1660 Vollhufner Hinrich Ties
1875-1879 H. Seegen
bis 1876 A. Mühlau zu Hasselbusch, Stellvertreter
1876-1877 A. Mühlau zu Hasselbusch
1876 Hufner Hinrich Thies, Stellvertreter
1877-1896 Hufner Hinrich Thies
1880-1886 Hufner A. Käufer, Stellvertreter
1893-1896 Hufner Jürgen Runge, Stellvertreter (vorher unbesetzt)
1896-1902 Kätner Hans Hahn, Stellvertreter
1896-1919 Hufner Jürgen Runge
1902-1907 Hufner Wilhelm Köhnhak, Stellvertreter
1907-1913 Halbhufner J. Henning, Stellvertreter
1913-1931 Rentengutsbesitzer Wilhelm Köhnhak, Stellvertreter
1917-1919 Heinrich Runge, Stellvertreter
1919-1933 Georg Henning, Rentengutsbesitzer
1931-1934 Heinrich Thies, Stellvertreter
1931-1934 Gutsvorsteher Gutsbezirk Hasselbusch Brügmann
1933-1936 Heinrich Runge
1936-1951 kein Bürgermeister
1951-1970 Heinrich Runge
1974-2005 Fritz Abel
2005-2018 Susanne Malzahn
ab 2018
Weddelbrook
1669 Vollhufner Jasper Ferst
1763-1770 Hans Boye
1774 Hans Krohn
1780 Hans Boye
1792-1803 Hinrich Boye
1816-1830 Hufner Jürgen Köhncke
1829 Marx Wolters
1843 Mühlenhofbauer Hans Christoph Schenck
1853 Hinrich Karstens
1856 Peter Paap
1859-1869 Hinrich Plambeck
1869-1872 Hinrich Plambeck
1872-1898 ½ Hufner Claus Mohr (senior), Standesbeamter ab 1.1.1890 (auch noch 1900)
1874-1880 ½ Hufner J. Gloy, Stellvertreter
1880-1886 ½ Hufner Johann Plambeck, Stellvertreter
1892 Hufner Hinrich Karstens, Stellvertreter
1898-1904 Hinrich Karstens
1904-1924 Claus Mohr (junior), Standesbeamter
1924-1929 Rentengutsbesitzer Hermann Plambeck
1929-1930 Wilhelm Ott (senior), Stellvertreter
1930-1945 Willy Kay
1945-1948 Karl Steinweh
1948-1970 Matthias Hennschen
1970-1978 Heinrich Bodien
1978-1990 Ernst Timmermann
1990-2017 Peter Boyens
ab 2017 Stefan Gärtner
Weide
1867 Ortsvorsteher M. Timmermann in Hasenmoor als Güterpflerger der Konkursmasse
1890 E. Harmsen
1910 A. Kahl
Wiemersdorf
1637-1674 Hufner Tietke Hardebek
1674-1706 Hufner Thomas Hardebek
1706-1847 Hufner Tietke Hardebek
1747-1784 Hufner Hinrich Hardebek
1785-1787 Hufner Hinrich Hardebek, Sohn des Hinrich Hardebek
1787-1815 Hufner Jasper Göttsche
1815-1833 Hufner Timm Lindemann
1833-1839 Hufner Hans Göttsch
1839-1844 Hufner Marx Nicolaus Jörck
1845 Hufner Hinrich Harder
1845-1848 Hufner Heinrich Clasen
1848-1869 Hufner Jacob Delfs
1869-1875 Hufner Gustav Sick
1875-1892 Hufner Christian Hartwig Tamm, Standesbeamter
1893-1911 Hufner Jasper Schümann, Standesbeamter
1906 Ziegeleibesitzer Gustav Blunck, Stellvertreter, stellvertretender Standesbeamter
1909-1914 Pingel, Stellvertreter, Standesbeamter
1911-1923 Hufner Johannes Peter Röper; Standesbeamter
1923-1929 Hufner Peter Hinrich Pingel
1929-1932 Hufner Hermann Ohlhoff
1933-1945 Bauer Hans Schümann
1945-1946 Müller Eilert Wykhoff
1946-1948 Hermann Bußmann
1949-1950 Kaufmann Heinrich Harbeck
1951-1962 Bauer Gustav Schlesselmann
1962-1978 Bauer Hermann Mackenstedt
1978-1986 Bauer Otto Jörck
1986-1994 Bauer Günther Lüth
1994-1998 Monika von Jouanne
1998-2017 Gerhard Jörck
ab 2017 Gerd Sick
Amtsbezirk Weddelbrook
1889-1901 Hufner Hinrich Steffens in Föhrden
1902-1908 Harms, Claus, Hufner zu Hitzhusen
1908-1935 Heinrich Ohrt
1935-1938 August Bracker (Hans?)
1938-1945 Willi Schurbohm
ab 1940 Stellvertreter Willy Kay führt die Geschäfte
1945-1946 August Bracker
1946-1948 Karl Steinweh
Amtsbezirk Wiemersdorf
1889-1915 Joh. Aug. Jaspers in Bimöhlen
1911- 1923 Hufner Johannes Peter Röper
1929 Jörck
1929-1933 Reimers aus Fuhlendorf
1933-1944 Schümann aus Wiemersdorf
Amt Großenaspe
1948-1951 Hans Griep
1951-1970 Otto Stölting
Amt Bad Bramstedt-Land
1948-1962 Karl Steinweh aus Weddelbrook
1962-1974 Gottlieb Freudenthal aus Hitzhusen
1974-1992 Hans Griep aus Fuhlendorf
1992-2003 Hans Asbahr aus Großenaspe
2003-2018 Holger Klose aus Hagen
seit 2018 Torsten Klinger aus Großenaspe
- 07. 1948 Auflösung der Dienststellen der Amtsvorsteher Großenaspe, Weddelbrook und Wiemersdorf.
- 12. 1948 Großenaspe und Heidmühlen bilden das Amt Großenaspe
- 04. 1970 Auflösung des Amtes Großenaspe und Eingliederung der Gemeinde Großenaspe
Amtmänner des Amtes Segeberg
um 1411 Ritter Sievert Dosenrode
1418 Hinrich Brockdorf, Besitzer von Salzau
1454-1456 Detlef Grönewold
1462-1464 Detlef von Bockwold zu Sierhagen
um 1470 Jürgen Krummendiek zu Heiligenstädten
nach 1470 Peter von Ahlefeld
1473-1479 Jürgen Krummendiek
um 1479/80 Otto von Ahlefeldt
1483 Heneke Walstorp
1492-1500 Hans von Ahlefeld
1500-1512 Hans Rantzau zu Neuhaus
1512-1521 Wulf Pogwisch d.Ä. von Grünholz
1521-1523 Jürgen von der Wisch zu Nienhof/Georg von der Wisch
1523-1526 Otto Ritzerow d.J. zu Hasselburg
1526-1530 Iven Reventlow
1531-1534 Wulf Pogwisch d.J. zu Buckhagen
1534-1536 Gosche Rantzau zu Nienhof
1536-1541 Bendict Pogwisch
1541-1543 Clemens von der Wisch, Klosterpropst Uetersen (um 1546 †)
15434-1546 Otto Sehestedt zu Kohöved
1546-1553 Breide Rantzau
1553-1555 Claus von Wensin
1555-1597 Heinrich Rantzau, Statthalter in Holstein
1598-1603 Dietrich Brüggemann
1603-1629 Marquard Pentz zu Neuendorf und Warlitz
1629-1665 Caspar von Buchwaldt, Landrat, zu Pronstorf und Bernstorf Erbherr und Ritter
1666-1684 unbesetzt wegen Verpfändung
1684-1700 Andreas Paul Freiherr von Liliencron, zusätzlich Amtmann von Trittau und Kanzler in Glückstadt
1700-1709 Johann Hugo von Lente von Freseneburg (Warlitz)
1720-1738 Anton Günter Hanneken
1739-1744 Geheimer Rat Hans von Rantzau, ab 1738 Amtssitz in Bramstedt, aber Amtsge-schäfte in Segeberg, nach Verordnung von 1743
1744-1756 Christian Günther Graf zu Stolberg-Stolberg
1756-1758 HofmarschallWolf Veit Christoph von Reitzenstein
1758-1759 Christian Gustav Graf Wedell-Wedellsborg
1759-1771 Konferenzrat Johann Friedrich von Arnold
1772-1773 Justizrat Tyge Jesper Rothe
1773-1790 Konferenzrat Arnold Schumacher, Justizrat, 1782 endgültige Verlegung des Amtshauses nach Segeberg
1790-1798 Kammerherr Nicolaus Otto Anton Freiherr von Pechlin
1799-1800 Kammerherr Baron Christian Friedrich von Brockdorff
1800-1801 Kammerherr Nicolaus Otto Anton Freiherr von Pechlin
1801-1818 Ernst August von Döring
1818-1853 Kammerjunker Carl Wilhelm Ludwig von Rosen
1853-1859 Cai Wilhelm von Rumohr
1859-1860 Eduard Müller
1860 Hans Friedrich Jacobsen (komm.)
1860-1862 Adam Friedrich Adamson Graf von Moltke
1863-1866 Heinrich August Springer
1866-1868 Cai Lorenz Freiherr von Brockdorf
Amtsverwalter, Vizeamtmann
bis 1598 Dietrich Brüggemann
1685-1689 Joachim Reich
1689-1711 Reimar Peter von Rheder, Justizrat
1703-1723 Amtsschreiber Johann Snell (Schnell
1711-1720 Anton Günter Hanneken
1722-1732 Johann Rudolph Nottelmann
1737-1758 Paul Christian Stemann
1758-1781 Friedrich Hinrich Stemann (1782 dessen Haus in Segeberg zum Amtshaus bestimmt)
1781-1784 Carl Christian Clausewitz
1785-1801 Jens Severin Aereboe
1801-1834 Hinrich Matthiessen
1834-1849 Ude Loewenherz Sommer
1849-1852 Paul Friedrich Werner Hugo Kraus
1855-1852 Hans Rehder
Landräte
1868-1870 Cai Lorenz Freiherr von Brockdorff
1870-1877 Heinrich Carl Anton Ernst Freiherr von Gayl
1877-1891 Peter-Friedrich Freiherr von Willemoes-Suhm
1891-1901 Carl Graf von Platen zu Hallermund
1901 Hans Caspar v. Boddien (komm.)
1901-1928 Dr. Gustav Ludwig Otto von Ilsemann
1928-1932 Otto Gisbert Adolf Gustav Kurt Graf zu Rantzau
1932 Eggert Reeder
1932-1945 Dr. Waldemar von Mohl
1945-1946 Christian Laurup Jensen
1946-1950 Dr. Dr. Paul Pagel
1946-1950 Oberkreisdirektor Dr. Herbert Jendis
1950-1959 Dr. Walter Alnor
1959-1965 Joachim Dorenburg
1965-1990 Anton Graf Schwerin von Krosigk
1990-2008 Georg Gorrissen
2008-2014 Jutta Hartwieg
ab 2014 Jan Peter Schröder
ZSHG 7 (1877), S.117 ff., siehe auch Riecken, Segeberger Jb. 29 (1983), S.57ff.
Katasteramt (Maienbeeck 10, ab 1910)
1907 Einrichtung des Katasteramtes
1919-1938 Katastergehilfin, technische Angestellte Margarethe Ick
1921-1938 Katasterobersekretär, geschäftsleitender Bürobeamter Ernst Rohlf
1926-1927 Katasterdirektor Karl Otto Bretag
1927 Katastersekretär Schöne
1927-1928 Katasterdirektor Hans Klautke (1928 †)
1928-1937 Katasterdirektor Vermessungsrat R. Koppen
1929 Katasterinspektor Petersen
1938 Büroangestellter Müller
1938 Büroangestellter Ramm
1938 Büroangestellter Timmermann
1938 Katasterlehrling Friemann
1938 Aufhebung des Katasteramtes und Zusammenlegung mit Bad Segeberg
Besitzer des Gutes Bramstedt (siehe auch www.alt-bramstedt.de)
1500/12-1538 Dirk Vogt (Vaget)
1538-1540 Elisabeth Vogtt, geborene Koep, Witwe Dirk Vogts
1540-1571/2 Caspar Fuchs, durch Heirat mit Elisabeth Vaget
Sekretär der dänischen Könige Friedrich I. und Christian III.
1571/2-1575 Elisabeth Fuchs, Tochter des Caspar Fuchs
1575-1604 Gerhard Steding durch Heirat mit Elisabeth Fuchs
1604-1611 Elisabeth Steding, Witwe Gerhard Stedings
1611-1631 Arnd Steding, Sohn Gerhard und Elisabeth Stedings, durch Kauf
1631-1633 König Christian IV., durch Kauf
1633-1648 Wibke Kruse, Verwalter: ihr Bruder Jürgen Kruse bis 1638
1649-1673 Claus von Ahlefeldt zu Klein-Nordsee durch Heirat mit Elisabeth Sophie Gyldenløve, der Tochter Wibke Kruses
General der Infanterie, Assessor im Kriegskollegium, Gouverneur in der Festung Nieburg, Amtmann von Nieburg, auf Nord Schieren See und Bramstedt Ritter
1649-1665 Gutsverwalter Christoffer Röpstorf
1665 Gutsverwalter Johannes Vinninghusen, Schwiegersohn des C. Röpstorf
1670 Gutsverwalter Claus von Oertzen
1674-1683 Oberst Claus von Oertzen durch Heirat mit Christine Sophie Amalie von Ahlefeldt, verheiratet 1669-1683
1683-1697/8 Christine Sophie Amalie von Ahlefeldt, 1684 Heirat mit Johann Gottfried Baron von Kielmannsegg
1693-1695 Verkauf an Johann Gottfried Baron von Kielmannsegg, Kauf nicht vollzogen oder wieder annuliert
1696 Kauf durch den Geheimen Rat und Vizekanzler der Glückstädter Regierung Johann Hugo v. Lente (nicht vollzogen)
1697/8-1731 Oberstleutnant und Hessen-Kasselscher Oberberghauptmann Johann Ernst Baron von Grote, † 1731 (niedersächsischer Adel) (oder 1725)
1731-1751 Baronesse Anna von Grote
1751 Preußischer Geheimer Kriegsrat Oberstleutnant Baron Friedrich Wilhelm W. von Printz
1751-1756 Graf Christian Günther zu Stolberg-Stolberg
1756-1774 Regierungsadvokat Markus Nicolaus Holst
1758 großer Brand in Bramstedt, u.a. Wirtschaftsgebäude des Gutes niedergebrannt, ab 1763 Pachtmüller von Weddelbrook mit dem Recht, zwei Kirchenstühle in der Bramstedter Kirche (unten) zu besetzen (Herrschaftliche Mannes- und Frauens
Gestühl, Bedienten-Stühle), 1765 Gutsverwalter Steffens
1774-1796 Justizrat Ferdinand Otto Vollrath Lawätz (siehe Segeberger Jb.29 (1983), S. 60)
1796-1840 Professor Friedrich Ludwig Wilhelm Meyer, 1802-1814 Gutsjustitiar Hennings, 1815 Gutsjustitiar Röttger, 1832 Gutsverwalter Reimers, 1833-1838 adeliger Gerichtsvogt Johann Wilckens (auch Gastwirt und Kätner)
- Erben des Professors F.L.W. Meyer
1842 Drittelhufner und Ziegeleibesitzer Carl Ernst Christian Puls, Weiterverkauf an v. Lütken
1842-1846 Landdrost von Lütken, Geheimer Kabinettsrat in Hannover und Landdrost in Osnabrück
1842 Gutsverwalter Friedrich Christian August Hornkohl
1846 Eduard Graf von Kielmannsegg
1846-1863 Königlich Hannöverscher Legationsrat und Kammerherr Ludwig/Louis Graf von Kielmannsegge, Erbherr auf Cappenberg, Gültzow, Bramstedt pp.)
1852 Gutsinspektor Plate, 1853/54-1867 Gutsgerichtsvogt H. Ott, 1855 Gutsinspektor Stavinsky, 1858 Gutsinspektor Joh. Roggenban (oder Roggenbaum)
1863-1902 Mühlenbesitzer Nikolaus Friedrich Paustian (1874 Auflösung des Gutsbezirks, damit verblieb nur das direkte Gebiet um das Bramstedter Schloss bei Paustian)
1902 Bergwerksdirektor Schrader (Makler Junge und Springer aus Itzehoe) (Schloss)
1903-1925 Georg Meyer (Schloss)
1925-1964 Gärtnermeister Kurt Meyer (Schloss)
ab 1964 Stadt Bad Bramstedt (Schloss)
Christian Günther Graf zu Stolberg-Stolberg
Das Geschlecht der Grafen Stolberg gehörte zu den altsächsischen Geschlechtern, die reichsunmittelbar waren, und zählt seit dem Reichsdeputationshauptschluss von 1803 zu den sogenannten Standesherren …
Für Holstein von Interesse ist Christian Günther Graf zu Stolberg-Stolberg, der Oberhofmeister der Königinwitwe von Dänemark. Seine Söhne Christian Graf zu Stolberg-Stolberg und Friedrich Leopold Graf zu Stolberg-Stolberg sind für das literarische und geistige Leben Schleswig-Holsteins von größter Bedeutung gewesen.
(Henning von Rumohr, Zur Struktur des schleswig-holsteinischen Adels, in: Staatsdienst und Menschlichkeit. Studien zur Adelskultur des späten 18. Jahrhunderts in Schleswig-Holstein und Dänemark, Hrsg. von Christian Degn und Dieter Lohmeier, Neumünster 1980, S.55)
- 07.1714 † 22.06.1765
oo 1745 Christiane Charlotte Friedericke Castell-Remlingen (1722-1773)
Kinder: Christian Graf zu Stolberg-Stolberg (1748-1821)
Mitglied des Hain-Bundes (mit Goethe), unbedeutender Schriftsteller, Amtmann des Amtes Tremsbüttel, 1789 aufgenommen in die schleswig-holsteinische Ritterschaft
Friedrich Leopold Graf zu Stolberg-Stolberg (1750-1819)
Mitglied des Hain-Bundes, Schriftsteller, Übersetzer, Diplomat, Verwaltungsbeamter, enger Kontakt zu Klopstock und Matthias Claudius, aufgenommen in die schleswig-holsteinische Ritterschaft, geboren in Bramstedt im Amtshaus (heute Rathaus)
Auguste Gräfin zu Stolberg-Stolberg (1753-1835)
Briefwechsel mit Goethe („Gustchen“), geboren in Bramstedt im Schloß
9 weitere Kinder
Vetter: Christian Ernst Graf zu Stolberg-Wernigerode
Vetter und Ratgeber des dänischen Königs Christian VI. (1730-1746) Hauptwortführer des Pietismus in Norddeutschland
Christian Günther Stolberg ging wahrscheinlich auf Veranlassung seines Vetters nach Dänemark. Dort sollte er die Verbreitung des Pietismus fördern. Er war von 1738-1744 Kapitän der Leibgarde zu Fuß des dänischen Königs Christians VI. Im Jahre 1744 ernannte ihn der König zum Amtmann von Segeberg. Graf Stolberg erlangte die Erlaubnis, den Amtssitz nach Bramstedt zu legen. Da ihm das Amtshaus (heute Rathaus) zu klein für familiäre, dienstliche und kulturelle Zwecke erschien, kaufte er 1751 das Gut Bramstedt. Das eigentliche Schloss ließ er abreißen (wegen Baufälligkeit?) und das bisherige Torhaus aus der Zeit Christians IV. als repräsentatives Wohnhaus umbauen. Ab 1752/53 nutzte er dieses Gebäude für dienstliche (Tätigkeit als Amtmann und Gutsherr) und private (wohnen, kulturelle Veranstaltungen) Zwecke. Vor allem im dafür besonders geeigneten großen Saal (Akustik!) fanden sicherlich (keine Beweise) sowohl Lesungen als auch musikalische Darbietungen statt. Gäste im „Schloß“ sind aber – mit einer Ausnahme – nicht namhaft zu machen.
Die Ausnahme betrifft den Pietisten Anton Heinrich Walbaum, der auf seiner 3. Reise durch Schleswig-Holstein (1751/52) auch in Bramstedt Station machte. Dabei ging es um die Verbreitung des Pietismus in Schleswig-Holstein und Dänemark. Auf dieser dritten Reise besuchte Walbaum, ein Schüler des bedeutenden Pietisten August Hermann Francke, auch Georg Wilhelm Soehlenthal, den Administratoren der Grafschaft Rantzau (seit 1738), der einen Kreis „Erweckter“, d.h. Pietisten, leitete. Zu diesem Kreis gehörte auch Graf Stolberg. So ist zu vermuten, daß auch in Bramstedt pietistische Versammlungen abgehalten wurden.
Ab 1756 lebte Christian Günther Stolberg als Oberhofmeister der Königinwitwe Sophia Magdalena in Kopenhagen. In seinem dortigen Haus verkehrte dann die gesamte Kopenhagener Prominenz, zu der seit 1751 auch Klopstock gehörte.
Für Bramstedt war Graf Stolberg noch durch zwei weitere Handlungen von Bedeutung. Zum einen begann er in der kurzen Zeit, in der er das Gut Bramstedt besaß, mit der Freilassung der Leibeigenen (gegen Geld). Zum anderen veranlaßte er die Bramstedter Fleckensversammlung, sich die erste schriftliche Fleckensordnung zu geben.
Postmeister in Bramstedt
1764/72-1801 Hans Hinrich Frauen, Postmeister
1801-1842 Johann Theodor Frauen, Postmeister (jüngster Sohn von H. H. Frauen)
1803 Postmeister Jochim Hinrich Fuhlendorf
1835 Inste und Postillion Timm Timmermann
1835 Kätner und Postfahrer Harm Diedrichsen
1835 Kontorist Conrad König
1835 Postillion Jürgen Kröger
1835 Postillion Marx Friesselmann
1835 Wagenmeister Christian Westphal
1835 Postillion Timm Köhnke
1835 Hufner und Postfahrer Hans Bülk
1842-1850 Hans Vieth, Postmeister, Schwiegersohn des Vorgängers
1849 Postmeister Diedrichsen
1850 Postmeister Rendtorf
1850-1864 Johannes Friedrich von Nissen, Posthalter und Postexpediteur
1855 Gehilfe Johann Didrichsen
1860 Postbote G. F. Bastian
1864-1867 Trebien, Postexpediteur
1867-1878 Johann Heinrich Stolten, Postexpediteur, 1876 Postverwalter
1867-1880 Briefträger Christian Böge
1878-1883 Kroeger, Postverwalter
1880 Briefträger Christian Delfs
1880 Landbriefträger Sievert Sörens
1884-1892 Schnack, Postverwalter
1892-1924 Boy Boysen Weirup, Postverwalter
1897-1919 Briefträger, Landbriefträger
1901 Postbote Diedrich Patzel
1924-1941 Postverwalter, Postmeister Friedrich Ihloff
1928 Oberpostsekretär Andreas Müller
1928 Oberpostsekretär Hermann Blievernicht
1941-1956 Wilhelm Johnsen, Postverwalter, ab 01.10.1951 Postmeister
Pastoren u.ä. von Bramstedt
Um 1400 Pastor Nikolaus Möller
1522-1534 Johannes von der Lippe
1534-1569 Pastor Hermann Burtfeld (Burgfeld), vorher Diakon in Bramstedt
? Diakon Friedrich N. (zur Zeit H. Burtfelds)
? Diakon Johann Wasmohr (zur Zeit H. Burtfelds)
? Diakon Isaac von der Burg (zur Zeit H. Burtfelds)
1570-1579 Pastor Isaac von der Burg
1568-1575 1. Küster und Organist Caspar Röhlfink
1580-1585 Pastor M. Casparius Ludolphi
1594-1622 Pastor Johannes Hamerich
1623-1659 Pastor Heinrich Galenbeck
? Organist Christian Hamerich
1668 Organist und Küster Hermannus Einhausen
1660-1687 Pastor Detlev Galenbeck
ab 1672 Organist Simon Tühck
1687-1702 Pastor Conrad Heinrich Galenbeck (seit 1684 als Pastor Adjunkty)
? Organist Arnoldus Böhm
? Organist Christian Gottlieb Büttner
1702-1707 Pastor Daniel Hartnack
1707-1724 Pastor Johannes Petrus von Kriegsbaum
1720 Küster Büttner
1725-1729 Pastor Johannes Joachim Peper (amtsenthoben)
1731-1733 Pastor Magnus Crusius
1731-1781 Organist und Küster Wilhelm Struve
1733-1747 Pastor Johann Georg Meßarosch (amtsenthoben)
1747-1752 Katechet Tobias Mentzel
1748-1773 Pastor Dethlef Chemnitz
1773-1793 Pastor Johann Just von Einem (17..-1792?)
1781-1789 Organist Wilhelm Christian Warnholz, Enkel Wilhelm Struves
1789-1797 Organist Daniel Rick (auf Fehmarn)
1794-1811 Pastor Christian Heinrich Stössiger
1797-1829 Organist Johann Christopher Hermann Carstens (Borsfleth)
1812-1825 Pastor Marcus Karck (31.01.1766-19.07.1825)
1825-1827 Vakanz
1827-1835 Pastor Johann Gerhard Feddersen Kall (01.02.1777-22.02.1835)
1829-1855 Organist, Küster und Lehrer Georg Heinrich Prüssing, Schwiegersohn des Propsten Nissen (Segeberg) (Prinzing) (Burg auf Fehmarn)
1835 Totengräber Hinrich Stüben
1836-1858 Pastor Otto Christian Gerber (08.12.1787-09.03.1958)
1855-1888 Organist Christian Sibbert Feddersen Quitzau
1859-1872 Pastor Georg Heinrich Kroymann
1873-1892 Pastor Detlef Friedrich Rolfs
1880 Totengräber Christian Bracker
1888-1924 Organist August Kühl
1892-1898 Pastor Emil Heinrich Gustav Brucks
1899-1900 Pastor Georg Heinrich Friedrich Erdmann Möhlenbrinck
1900 Pastor com. Dr. Brede
1901-1918 Pastor Johann Ernst Ludwig Hümpel, Lizentiat, Dr.phil.
1906 Kirchendiener H. Bielenberg
1918-1923 Pastor Felix Jakob Hermann Paulsen
1924-1937 Pastor Friedrich Paul West
1924-1939 Organist Johannes Daniel
1937 Pastor Lucht (vermutlich: Kurt Ulrich Theodor)
1937-1951 Pastor Martin Christiansen
1951-1979 Pastor Carl-Heinrich Wilhelm Pfeiffer
1957-1960 Pastor Erhard Evers
1960-1961 Pastor Helmut Jegodzinski
1964-? Pastor Gerhard Ernst Meyer
1976-1981 Pastor Wolfgang Seehaber
1979- Pastor Joachim Steingräber
1982-2019? Pastor Bernd Hofmann
1982-1984 Pastorin Ulrike Wagner
1984-1986 Pastorin Arp-Kaschel
1985-2018? Pastor Rainer Rahlmeier
(fortzusetzen)
Inschrift der Betglocke (1942 abmontiert): Herr Anthon Gunther Hannecken, Kgl. Conferenze Raht und Ambtmann; Herr Ludewig Ottens, Präpositus in Segeberg; Herr Jochim Christian Wulff, Commissarius u. Kirchspielvogt; Laurenz Stahlborn me fadit Lubeca Anno 1732 Soli deo Gloria./ Dr. Magnus Crusius, Pastor Ecclaesiae Bramstettensis, Johann Hamerich, Marx Westphal, Jasper Stuhmer, Carsten Horns Kirchgesworen./ salvator. munni. salvano. mpcabi confess.-evangin. comitang. eyha. sacra. ecu. Caria secunda XXV iun. II IX dominus mihi adintor.
Müller und Mühlenbesitzer in Bramstedt (Kanzleimühle)
bis 1633 königliche Mühle in Bramstedt, Pacht an die Glückstädter Kanzlei
1633-1648 Wibke Kruse, Eigentümerin
1648 Elisabeth Sophie Gyldenløve, Eigentümerin
1649-1674 Klaus von Ahlefeldt (durch Heirat), Eigentümer
1674-1729 Christine Sophie von Ahlefeld (Tochter Elisabeth Sophies), Eigentümerin
Oberst Claus von Oertzen (durch Heirat), Johann Gottfried Baron von Kielmannsegg (durch Heirat), russischer Generalmajor Johann Karl Freiherr von Dieden (durch Heirat) (er stammt nicht aus dem Hause Dieden zu Fürstenstein, sondern aus Belgien)
-1699 Peter Wichmann
1699-1721 Peter Wichmann (Sohn), Mühlenpächter
1729- Charlotte Friederike von Oertzen, verheiratet mit dem Grafen Thomas Theodor von Schmiedegg, Eigentümer
1732 Jochim Witte, Mühlempächter
1740-1746 Peter Haack, Mühlenpächter
1746-1773 Siegfried Hans Christoph Wichmann, Mühlenpächter
1773-1811 Siegfried Christoph Wichmann, Mühlenpächter
1811-1826 Siegfried Christian Peter Wichmann, Mühlenpächter
1826 Johann Nicolaus Christoph Wichmann, Mühlenpächter
1826-1828 Metta Wichmann, geborene Plüschau, Mühlenpächterin
1828-1846 Gottlieb Diederich Niemann (durch Heirat mit Metta Wichmann), Mühlensetzwirt
1846-1883 Nikolaus Friedrich Paustian, erst Mühlenpächter (durch Heirat mit Meta Elisabeth Wichmann), später Eigentümer und Betreiber
1883-1925 Otto Georg Wilhelm Paustian, Eigentümer und Betreiber
1932-19 Fritz Johann Adolf Paustian, Eigentümer
1935-1950 Wilhelm Schlüter, Mühlenpächter
Scharfrichter und Abdecker in Bramstedt
bis 1721 Abdecker Hinrich Wenzel
1721 Scharfrichter Jürgen Schreiber, Kaufbrief Schuld- und Pfandprotokolle
Johann Andreas Brand, um 1725-29 Chirurg u. Abdeckereipächter in Bramstedt, um 1731 Chirurg in Pratjau, um 1734 dgl. in Beidenfleth, um 1736 dgl. in Nortorf, um 1742 Halbmeister in Wilster, um 1743-47 Scharfrichtereipächter in Flensburg; ¥ Anna Dorothea N., † Beidenfleth 1734.
Kinder: 1. Anna Christina, getauft Bramstedt 03.12.1725
- Johann Wilhelm, getauft Bramstedt Palmarum 1727
- Christian Andreas, * Pratjau, getauft Selent 12.10.1729
- Joachim Hinrich, * Pratjau, getauft Selent 22.04.1731
Carsten Renzhausen (Rentzhausen, Ranßhusen), seit 1650 Scharfrichter in Oldesloe, seit 1655 auch dgl. u. Abdeckereibesitzer in Stadt u. Amt Segeberg, seit 1670 auch Scharfrichter der Städte u. Kirchspiele Lütjenburg, Heiligenhafen, Bramstedt, Kaltenkirchen u. Bornhöved, † Oldesloe 1688, ¥ I NN. – ¥ II Husum Montag p.Tr. 1669 Catharina Möller (aus 2856), getauft Husum 25.10.1648.
Kinder: 1. Maria, ¥ Segeberg 22.05.1688 mit Martin Möller, seit 1689 Scharfrichter in Segeberg
- Adrian, 1685-1710 Scharfrichter in Segeberg
- – 10.
Christian Martin Meißner, Scharfrichter in Bramstedt.
Kinder: 1. Johann Martin, begraben Bramstedt 22.12.1748
- Johann Martin Christian Erdmann, getauft Bramstedt 12.12.1751, begraben ebd.
08.06.1753
Johann Martin Beinert, Abdecker in Bramstedt, * um 1721, † Bramstedt 08.08.1791, ¥ Magdalena Margaretha Vache, * um 1733, † Bramstedt 14.08.1789.
Kinder: 1. – 9.
Hinrich Arend Franck, um 1772/75 Abdecker in Lübeck, um 1796 Halbmeister in Bramstedt, ¥ Catharina Eleonora Wick (Wische, Wissken).
Kinder: 1. Hanna Sophia, ¥ Bramstedt 22.02.1796 Joachim Friedrich Möller (Nr.6197), Halbmeisterknecht in ?
- – 4.
Matthias Andreas Querngester, um 1710/26 Scharfrichter od. Abdecker in Bramstedt, ¥ Segeberg 23.11.1700 Maria Elisabeth Kock, aus Segeberg.
Kinder: 1. Detlef, Abdecker in Bornhöved, wohnte zeitw. Im Bothkamper Holz, * um 1700/01, †
Bornhöved 16.04 1769, ¥ Bornhöved 09.07.1730 Anna Dorothea Niclas (aus 6216), *
um 1700, † Bothkamper Holz 04.02.1760.
- Maria Elsabe, * um 1703, ¥ David Walther Scharfrichterknecht in Krempe (* Bramstedt
um 1698), † Schlesen 29.05.1783
Christoph Ruh, Halbmeister in Bramstedt.
Kinder: 1. Anna Magdalena, getauft Bramstedt 08.07.1692
- Hans Barthold, getauft Bramstedt 16.08.1694
1803 Abdecker Hans Jürgen Starck
1820-1841 Kätner und Abdecker Hans Hinrich Poggensee
1835 Kätner und Halbmeister Hans Adolph Poggensee
Ärzte
1613 Barbier und Wundarzt Hans Moelke
1636 Barbier und Wundarzt Dietrich Moelke (Sohn)
1720 Chirurg Albrecht Wichmann, auch Branntweinbrenner und Maltzer
1725-1729 Chirurg und Abdeckereipächter Johann Andreas Brand
1761 Amts Chirurgus Christ. Peter Spickholtz
1776 Chirurg Henning Müller
1810 Chirurg Capito
1827-1835 Arzt und Wundarzt Dr. Jacob Heinrich Meßtorf
1835 Chirurggehilfe und Barbier Just. Heinrich Rückert
1845 Chirurg und Barbier Carl Heinrich Rückert
1845 Carl Theodor Rudolph Kruse
1845-1867 Dr. Gottwerth Christian Schamvogel
1855 Chirurg und Barbier Inste August Rückert
1855-1884 Dr. Broder Dietrich Sattler (1867 ⅓ Hufner)
1870-1890 Dr. Postel
1904-1915 Dr. med Paul Wulf
1905-1913 Dr. med. Ernst Reimers
1913-1936 Dr. med. Waldemar Schulz
1919-1928 Dr. med. Christian Kühl
1935-1962 Dr. med. Hans Mohr
1938 Dr. med. Anders
1941 Dr. med. Hans Grund
1944 Facharzt Dr. Borbe
noch nicht fortgesetzt
Tierärzte
1835-1860 Inste Peter Jörgensen
1858 ⅓ Hufner und Schmiedemeister Joachim Jargstorff
1867 Duncker
1870-1907 Dr. Westphal
1910-1938 Dr. Gerhardt Heinrich Stedtfeld, 1938 tödlich verünglückt, vorher Verweigerung des Reisepasses wegen laufendem Strafverfahren
1928-1933 Dr. Heinrich Wilhelmi
noch nicht fortgesetzt
Zahnärzte
1941 Dr. Eduard Hornung
1942 Dentist Karl Schloika
unvollständig und noch nicht fortgesetzt
Apotheker
1761 Nebelung
1811-1828 Martin Lambert Peter Noodt
1828-1845 Kätner Friedrich Wolfrath Lindemann
1845-1853 Johann August Herminghausen
1845 Apothekergehilfe Ferdinand Döwer
1853-1870 Johann August Friedrich Lindemann
1860 Apothekergehilfe Ludolph Lorenzen
1870-1873 Heinrich Christof Nagel
1873-1908 Friedrich August Hermann Wuth
1908-1920 Julius Triepel
1920-1958 Fritz Neumann
1937 Ernst Petersen
noch nicht fortgesetzt
Hebammen
1803 Distriktshebamme Anna Klahn
1835 Anna Engel Kröger, Abschiedsfrau
1860 M. M. Sörens
1879-1889 Ida Nonnsen, geborene Johannsen
1881-1882 Maria Sörens, geborene Schmidt
1885-1921 Magdalena Siemsen, geborene Widderich
um 1900 Maria Margaretha Auguste Brandt, geborene Delfs, in Großenaspe
1909-1914 Johanna Pahl, geborene Cobabus
1912 Dorothea Kukuk, geborene Pingel
1924-1925 Marie Wrage, geborene Engel
noch nicht fortgesetzt
Schule Bramstedt
1633 Organist Christian Hamerich
1644-1668 Organist und Küster Hermann Einhausen
ab 1672 Organist Simon Tühck
1692 Organist Arnoldus Böhm
? Organist Christian Gottlieb Büttner
1731-1781 Organist und Küster Wilhelm Struve
1781-1789 Organist Wilhelm Christian Warnholz (Enkel Wilhelm Struves)
1789-1797 Organist Daniel Rick (auf Fehmarn)
1797-1829 Organist Johann Christopher Hermann Carstens (Borsfleth)
1829-1855 Organist Georg Heinrich Prüssing (Burg auf Fehmarn)
1829 August Gartmann
1830-1837 Gehilfe Hinrich Göttsche
1834-1843 Siegfried Bock
1834-1840 Hans Vieth
1836-1858 Pastor Otto Christian Gerber
1838 Schulvorsteher ⅓ Hufner und Färbermeister Hinrich Pape
1838-1840 Schulvorsteher Kätner und Glasermeister Friedrich Meyer
1840 Neubau Schule Maienbeeck
1841-1843 Kay Diederich Hansen
1841-1855 Hauptlehrer Knaben Johann Christoph Hamburg
1843-1846 Elementarlehrer Carl Porath
1845 selbständiger Elementarlehrer Carsten Jacob Clausen
1845 Schulpräparant Claus Hinrich Untiedt
1846-1848 selbständiger Elementarlehrer Fedder Jensen, 1848 versetzt nach Wiemersdorf
1848 Bernhard Christian Marius Schlotterbeck
1848-1849 Jens thomas Jensen
1850-1866 Friedrich Gottlieb Schnack
1855 Lehrergehilfe Claus Wagner
1855-1888 Organist Christian Sibbert Feddersen Quitzau
1860 Joh. H. Wohlbehagel
1860-1864 H.C. Leptien
1860-1868 Emil Theodor Johannes Wolf
1864 Evers
1869 F. Dietz
1870-1872 Joachim Hasch
1875-1890 J. Reimers
1876-1877 Joh. Jensen
1876-1878 Marx Schlüter
1877-1883 Carl Brorsen
1878-1885 Jochim Knust, Lehrer an der Mädchenmittelklasse
1887-1889 Marie Rönnau
1887-1926 Peter Jakob Hehnke
1888-1924 Organist, Lehrer, Konrektor August Kühl, ab 1924 im Ruhestand
1889-1891 Alma Renfranz
1889-1891 Julius Hell
1890-1900 Knaack
1891-1893 Frl. Renjes
1891-1923 Hans Heinrich Horst
1893-1895 Frl. Thomsen
1895-1901 Frl. Stockfleth
1895-1924 Hauptlehrer, Rektor Rohwedder
1899-1900 Julius Bode
1901-1903 Ehlers
1902-1903 Frl. Kleemann
1902-1906 Karl Möller
1904-1906 Johann Hinrich Höpcke
1903-1904 Frl. Hennings
1904 Frl. Heitmann
1904-1907 Frl. Lüders
1906-1908 Wilhelm Wehn
1906-1908 Alma Hehnke, geb. Renfranz
1906-1933 C. Trip, ab 1927 Konrektor, spätestens 1948 i.R.
1907-1909 Elise Knop
1908-1947 Ludwig Saggau
1908-1913 Otto Schwarz
1909-1938 Marie Ecklon
1912-1925 Frl. L. Sievert
1913-1939 Otto Schnepel sen., 1939 versetzt nach Reinbek
1914 Schuldiener Kahl
1923 Johs. Michaelsen
1923-1937 Johs. Stüben, † 1937
1924-1942 Lehrer, Rektor Wili Oldenburg
1924-1939 Organist Johannes Daniel
1925-1931 Lissi Gehrke
1927-1929 Peter Lorenzen
1927-1939 Schuldiener Wulf
1929-1930 Johann Hinrich Plett
1929-1935 Ilse Freudenthal
1929-1944 Schuldienerin Wulf
1930 Heinrich Wrage
1931-1933 Hans Stegemann
1933-1936 Karl Tonn
1935 Cathie Adler
1935 Frl. Rosenthal
1935 Frl. Sydow
1935-1936 Ilse Freudenthal
1936-1937 Frl. Wichura
1936-1938 Emil Gosch
1937 Frau Kock
1937 Anni Lauenstein
1937-1939 Heinrich Köpke
1937-1939 Erna Quistorf
1937-1938 Lisbeth Harbeck
1938 Gertrud Müthel
1938 Hilde Briegleb
1938-1939 Herbert Dorbandt
1939-1945 Maria Rumöller
1939-1940 Christa Petersen
1939-1940 Frau Oldenburg
1940 Wilhelm Schwank, Lehrer aus Fuhlendorf
1940 Hünemörder aus Wiemersdorf
1941 Frl. Danmeier
1942-1957 Rektor Hintmann
1942-1943 Edith Pietsch
1943 Willi Oldenburg
1943-1944 Friederike Baumert
1943-1945 Frau Friedrich
1943-1950 Frl. Hansen
1944 Frl. Schütt
1944 Käthe Wohlers
1944-1945 Otto Schnepel
1946 Traute Meinhardt, geb. Stockmann
1946-1962 Herbert Brauer
1946-1947 Alfred Boeck
1947 Gerhard Müller I
1947-1948 Gehl
1947-1949 Gustav Steen
1947-1955 Maria Rumöller
1948 Otto Schnepel
1948 Heinrich Papke
1948-1965 Heinrich Köpke
1949 Ilse Boesler
1949 Kurt Meyer
1949 Hans Otto Jarren
1950-1951 Gotthold Lantzsch
1950-1957 Friedrich Christiansen
1950-1969 Hans Finck
1951 Werner Sandow
1951 Gertrud Kock
1951-1952 Frl. Koppenhagen
1952 Helmut Kurschat
1952-1953 Gertrud Homann
1952-1954 Gerda Ibe, geb. Kabel
1952-1955 Günther Kropp
1952-1958 Fritz Asmus
1953 Gerhard Müller II
1953-1955 Hans Flügel
1953-1960 Marten Paulsen
1954-1961 Erwin Otto
1955 Klaus Knappe
1955-1959 Käthe Radeloff
1955-1965 Alfred Lieck
1956 Elli Romberg
1957 Karl Klöckner
1957 Rektor Arnold Schümann
1958 Alma Luise Beyer
1958 Edeltraut Pukall
1958 Dr. Erna Wisniewski
1958-1959 Hedwig Sellschop
Berufsschule
1926-1928 Leiter August Kühl
1932-1938 Leiter Otto Schnepel sen.
Privatschule gegründet 1908
1908 Frieda Krüger
1908-1911 Schulleiter Pastor Dr. Ernst Hümpel
1908 Lehrerin Pfähler
1908 August Kühl
1911-1921 Rektor Gehrs
1921-1923 Rektor Schneider
1923-1932 Rektor Studienasssessor Richard Horstmann
1932-1936 Rektor Oberstudienrat a. D. Prof. Ernst Hansen
1936-1948 Rektor Oberstudienrat a. D. Dr. Dietrich Heine
noch nicht fortgesetzt
weitere Privatlehrer
1845 Kandidat der Theologie und Privatlehrer Heinrich August Schröder
1838-1855 Christian Wörmbke
Schule Armstedt
1638 N. Zacharias
vor 1693/4 Johann Wilken
1739-ca. 1768 Asmus Fischer
1769-1787 Ties Fock
1787-1827 Weber Marx Warnholz
1826-1827 Thies Warnholz
1827-1863 Distriktsschullehrer Marcus Bolling
1835 Gehilfe Johann Meyer
1863-1869 Detlev Andreas Hansen
1869-1889 Johann Hinrich Fölster
1889-1895 Hinrich Sievers
1895-1904 Ma(r)x Karl Eduar Ewers
1904-1905 Rottgardt
1905-1910 Biel
1910 Reimers
1910-1911 Klaus Richard Toll
1911-1925 Karl Pecht
1925-1936 Wilhelm Otto Rudolf Michel
1936-1937 Dubbe
1937-1946 Jürgens
Lehrer Bimöhlen
1679 Dethlev Lücken
- Hälfte 17. Jahrhundet Gloye
1749-1751 Hans Wittorf
1811 Maurer Marx Horns
1837-1861 Hans Gerth (ca. 40 Jahre lang)
1861-1862 Saggau
1861-1862 Maasen
1862-1888 Humfeldt
1888-1890 Gosch
1890-1895 Nissen
1895-1896 Hagen (als Vertretung)
1896-1899 Andreas Pätau aus Wiemersdorf
Sommer 1899 Voß aus Uetersen (als Vertretung)
1899-1933 Hauptlehrer Joh. Wegner
1914 Hinrichsen
1920-1922 Hinrichsen
1922-1926 Pott
1933-1939 Hermann Riedemann, 1939-1944 im Krieg
1933-1934 Junglehrer Timmermann aus Nützen (als Vertretung)
1939-1942 Joh. Wegner (als Vertetung)
1942-1944 Kuhrau aus Großenaspe
1944 Johannes Daniel aus Bad Bramstedt
ab 1944 Hermann Riedemann
1944-1945 Schulhelferin Behnke aus Bad Bramstedt
1945 Schulhelferin Joost aus Neumünster
Schule Borstel
1751 Jasper Delfs
1835 Friedrich Hinrich Christian Petersen
1837 Brackls
1845 Hans Busch, Schullehrer an einer Nebenschule
Schule Brokenlande (ab 1838)
1838 Prüss
1875 Fischer
1875-1879 Detleffsen
1879-1888 Westphalen
1888-1891 Winzer
1892-1895 Tamm
1895-1898 Handorff
1898-1902 Hingst
1902-1903 Schütt
1903-1904 Michelsen
1905-1907 Solvie
1907-1908 Möller
1908-1910 Jepsen
1910-1911 Brünings
1911-1920 Theut
1920-1921 Suhr
1921-1929 Lewerenz
1929-1935 Johannes Petersen
1935-1938 August Petersen
1938-1948 Jürgensen
Schule Föhrden-Barl
1800-1807 Jochim Harders, † 1807
1811-1857 Hans Harders, Sohn des Jochim Harders
1845 Substitut Heinrich Asmussen
1857-1861 Reimers
1861-1865 Sievers
1865-1902 Sachau
1888 W. Haak
1902-1903 M. Hamann
1903-1905 Eduard Pottharst, † 1905
1905 W. Benthien, Hitzhusen (als Vertreter)
1905-1907 Schulamtskandidat Bahr (als Vertretung)
1907-1945 Wilhelm Mohr
1920-1932 Handarbeitslehrerin Mohr
1932 Handarbeitslehrerin Marie Plambeck
Schule Fuhlendorf
1655-1656 Christoffer Hower (Hoyer
1726-1729 Peter Hein
1751 Jochim Schuldt
1785-1789 Setzwirt Clas Fölster
1811-1819 Tim Mehrens
1832-1840 Peter Gloye
1844-1845 Hinrich Rickert
1848-1852 Joachim Lüthge
1855-1885 Thomas Jensen
1894-1905 Christian Iwers
1910-1952 Wilhelm Schwank
- 1915 Fräulein Weber
1952-1955 Ernst August Hennecke
1955-1970 Hans Hammerich
Schule Großenaspe
1737-1755 Küster Jasper Weber
1772-1796 Küster Hans Butenschön aus Aspe
1796-1797 Interimsküster Johann Hinrich Butenschön
1797-1802 Küster Hansen
1803-1805 Organist und Küster Kroneweiler
1805-1806 Organist und Küster Hadenfeldt
1806-1807 Organist und Küster Friedrich Christian Stolle († 1807)
1808-1809 Organist und Küster Friedrich Siemens
1810-1813 Organist und Küster Jochim Heeschen († 1813)
1813 Seminarist Peter Rohard aus Hohenwestedt
1813-1830 Organist und Küster A. H. Eggerling († 1830)
1816-1817 Unterlehrer Kraft
1824 Unterlehrer Mester aus Brügge
1824 Unterlehrer Pohlmann
1825 Unterlehrer Harbeck
1830 Unterlehrer Beckmann
1830 Unterlehrer Rix (interim)
1831-1870 Organist und Küster Hans Wischmann
1870-1874 Organist und Küster Hauptlehrer Wilhelm Kähler († 1874)
1870-1881 Mittelklassenlehrer Runge
1873-1876 Handarbeitslehrerin Julie Wischmann, Tochter des Lehrers Wischmann
1874-1900 Organist und Küster (bis1894) Hauptlehrer Boysen
1877-1879 Handarbeitslehrerin Witwe Auchler
1880-1885 Handarbeitslehrerinnen Charlotte Lahrs, Sophie Hamann
1881-1884 Mittelklasselehrer Johann Christian Ohl
1885-1915 Mittelklasselehrer Christian Valentin
1885-1896 Frau Valentin
1896 Emilie Haacks
1901-1914 Organist Hauptlehrer Burmeister
1914-1915 Sprenger (interim)
19151-1935 Organist und Hauptlehrer Friedrich Ferdinand Clausen
1915 Pastor Bünz als Vertretungslehrer für Religion, Geschichte und Turnen
1915 Frau Hennings
1935-1944 Hauptlehrer Johannes Harms
1940-1945 Hauptlehrer (ab 1944) Johannes Hansen
Fortbildungsschule/Ländliche Berufsschule Großenaspe
1912/13 Gründung der Fortbildungsschule
1912-1914 Burmeister
1938 Gründung der Berufsschule
1944 Schließung der Berufsschule
Schule Hagen
Um 1675 Hans Ordt
1742 Caspar Behnke
1750-1751 Dirk Kölln
1780 Hans Horns
1790-1811 Hans Ahrens
1803-1843 Peter Harder
1844-1853 Nikolaus Christiansen
1853-1875 H. A. Fick, † 1875
1872-1875 Turnlehrer Schmidt
1874-1875 Präparand Klähne als Gehilfe und Vertreter (1875)
1875-1903 Delfs
1875-1903 Handarbeitslehrerin Delfs
1903-1929 Schulamtskandidat Albert Dahl
1930 Wolf, Fritz Barth, Wulf, Bondzus (als Vertreter)
1930-1946 August Frick (ab 1944 Soldat)
- Lehrerin E. Sommer (als Vertretung)
Hardebeck – Hasenkrug
1744 Hinrich Bencken, Hasenkrug, Sohn des Lahrers Paul Behnke in Wiemersdorf
vor 1777 Reimer Rosmann (Ruschmann)
bis 1796 Hans Sibbert
1809-1811 Weber Jochim Gripp, Hasenkrug
1811-1837 Hans Fölster, Hardebeck, † 1837
1837-1852 Friedrich Ferdinand Busch, Hardebeck
1882 Johannes Hansen, Hardebeck
Schule Hitzhusen
1683 Hinrich Glöjen
1781-1791 Hinrich Schmuck, † 1791
1797-1837 Paul Delfs
1840 Joh. Christ. Matth. Paulsen
1845 Herm. August Fick
1852 G. A. Fick
1969-1876 Hans Delfs
1905 W. Benthien
Lehrer Weddelbrook
1702 Claus Bestmann
1711 Johann Möller
1744 Jasper Selk
1758 Schneider Hinrich Dammann
1768-1800 Claus Köhnke
1803-1810 Johann Friedrich Steffens
1811-1835 Otto Hauschildt
1835 Franz Lohse
1837-1845 Meyer
1846 Lüt
1847-1852 Hans Gottfried Busch
1852-1857 Wilhelm Rabe
1857-1865 Magnus Redlefsen Reimer
1868-1870 Hilbert
1870-1879 Clemens
1879-1881 Poppe
1882-1884 Broers
1884-1886 Benthin
1886-1890 Wichel
1891-1913 Johannes Hargens
1894-1898 Lüthje
1898-1901 Koch
1901-1905 Karl Eduard Egge
1905 Johann Hinrich
1907-1908 Fey
1909-1914 Lehrerin Hahn
1913-1916 H. Hastedt
1914-1934 Hermann Hargens (1914-1919 Soldat)
1916-1917 Carl Matthiessen
1917-1928 Klaus Petersen
1928-1945 Wilhelm Kruse
1934-1939 Christa Petersen
Lehrer Wiemersdorf
1645 Hinrich Kloken
1682 Hans Lindemann
1702-1751 Paul Benck
1761 Hans Wittorf
1799-1811 Setzwirt und Vollhufner Johann Harbeck
1817-1847 Joachim Wittmaak
1832-1838 Peter Glöye
1847-1848 Schulpräparant Knees (interim)
1852 C. W. Schmalmack
1848-1866 Jens Theodor Fedder Jensen
1866 Johann Hinrich Fock
1879-1910 Friedrich Böttger, auch Standesbeamter
1910-1914 Friedrich Karl Erdmann Pielenz (1916 verschollen, 1918 für tot erklärt)
1910-1945 Hünemörder
1917 Wegner aus Bimöhlen
1920-1940 Hans Heitmann
1940 Schwank (mit den Fuhlendorfer Schülern gekommen)
1945-1946 Herr Scholz
1946-1953 Hans Heitmann
1947 Alexander Boeck
1948-1952 Friedrich Asmus
1949-1951 Herr Meyer
1951-1952 Frau Maeting
1952 Herr Groß
1952-1955 Frau von Miekwitz
1952-1957 Gerhard Lange
1953 Herr Jacobsen
1957 Gerhard Reißmann
1957-1961 Frau Matthies
1961 Frau Lübbe, verheiratete Baufeld