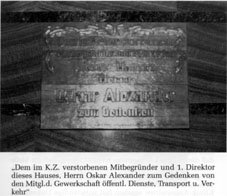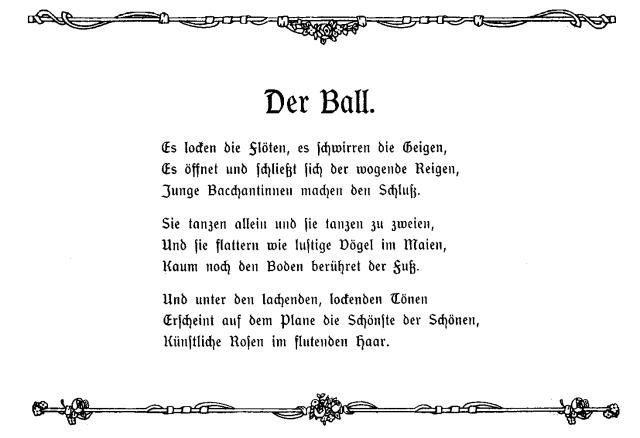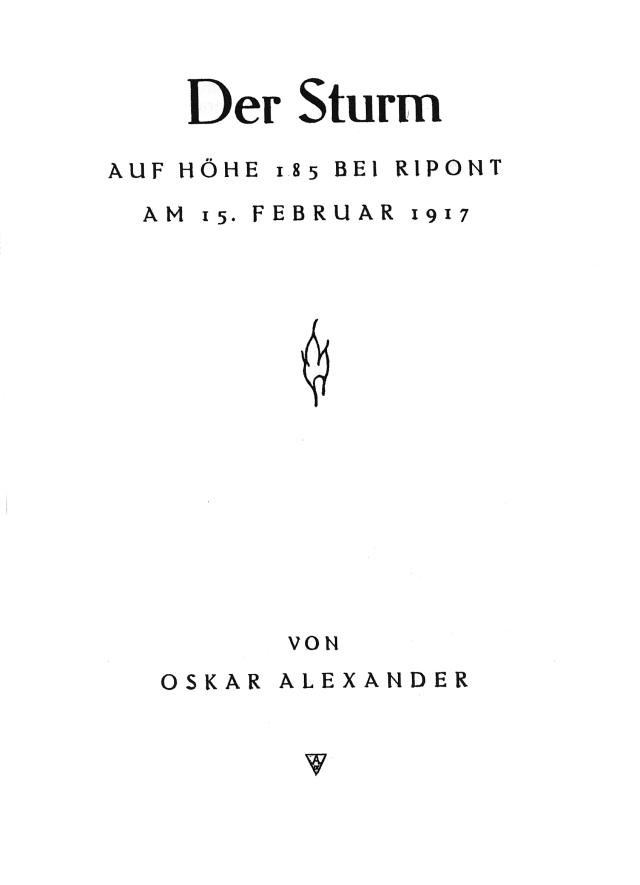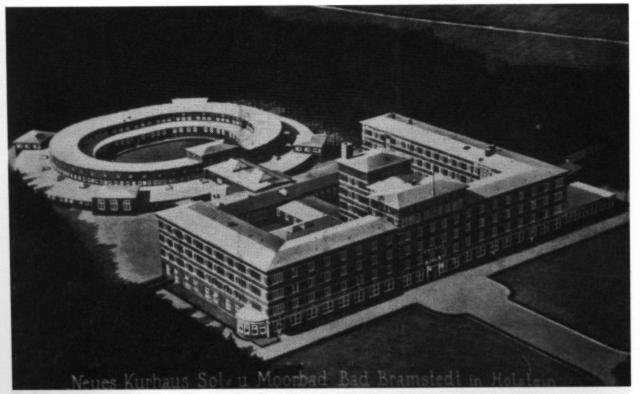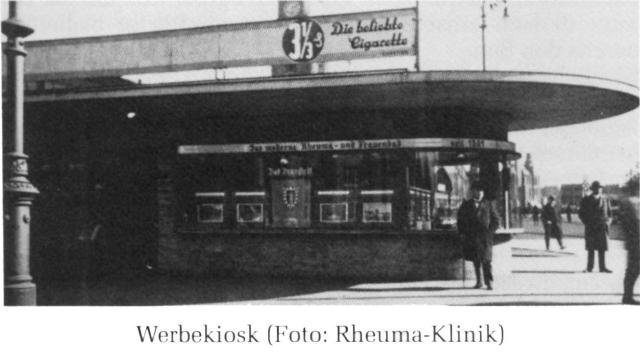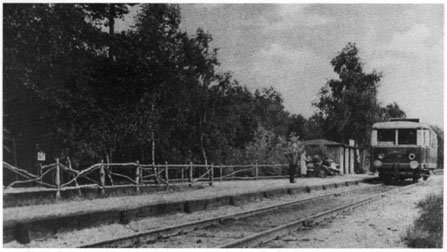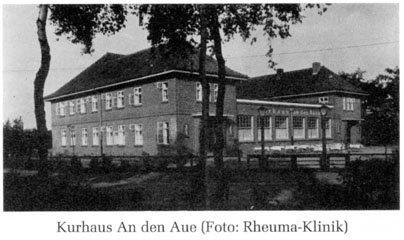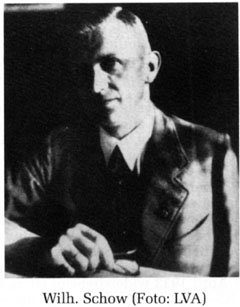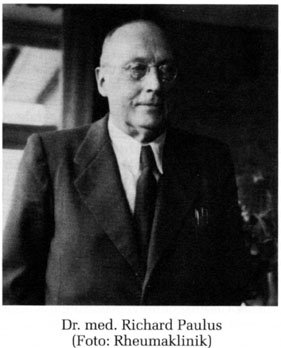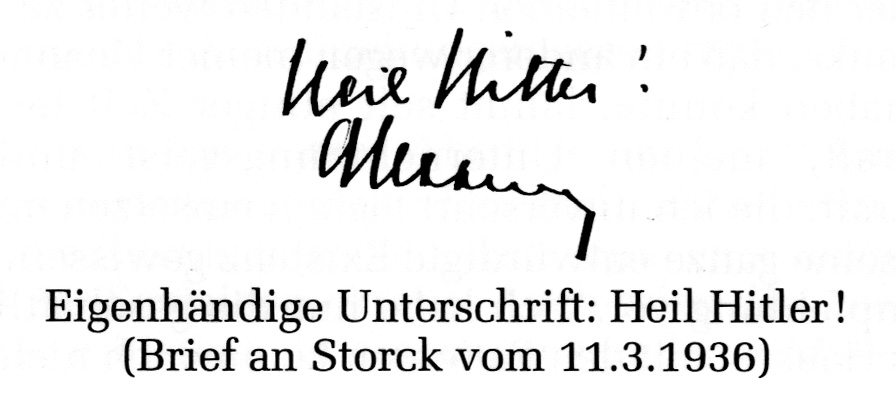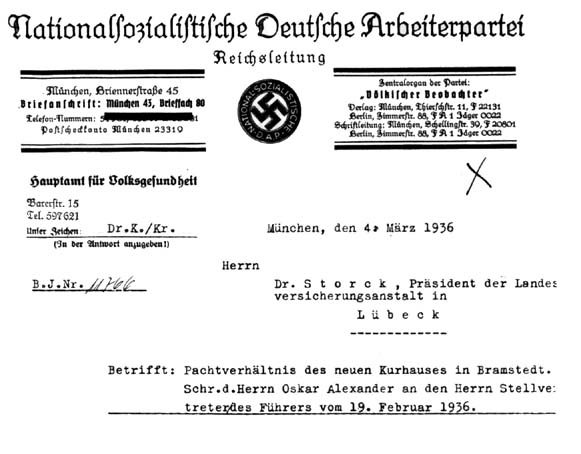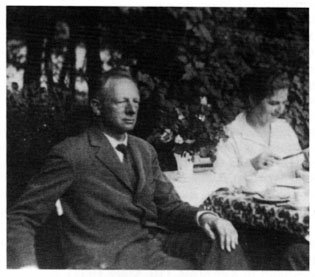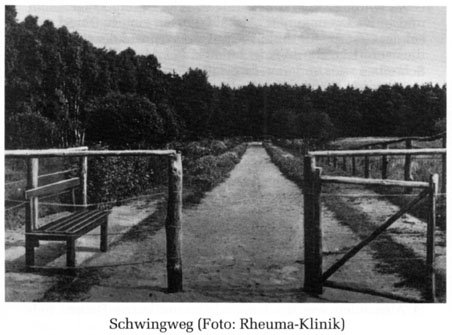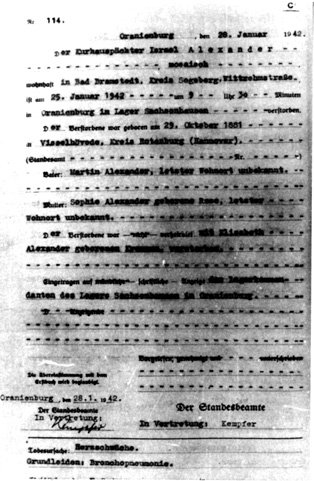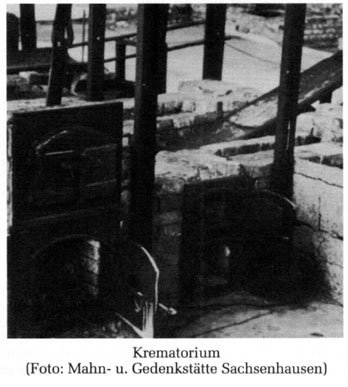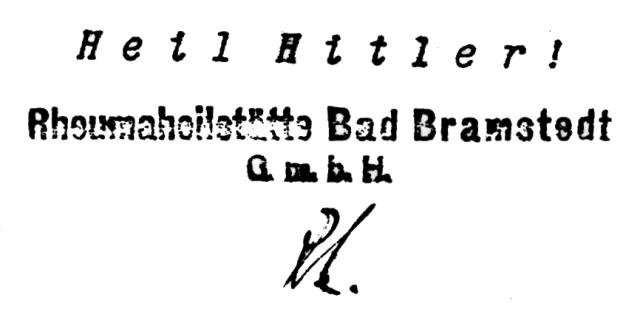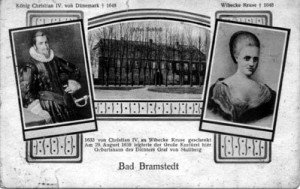Text des Buches aus dem Nachdruck der Druckerei Paustian aus den 1960er Jahren übernommen
Wiebeke Kruse
eine holsteinische Bauerntochter
Ein Blatt aus der Zeit König Christians IV
von Johanna Mestorf
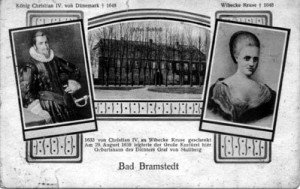
(Anmerkung 1999: Personenbild W. Kruse ist nicht authentisch)
I.
Am Ufer der Bramau, eine Meile westlich vom Marktflecken Bramstedt, liegt das unbedeutende Dörfchen Föhrden; unbedeutend nicht nur hinsichtlich seiner Größe, sondern in jeder Beziehung. Keine Geschichten von dort gelieferten Schlachten zur Zeit der Waldemare, Gerharde oder Adolphe vererben sich auf den Lippen der Burschen von Geschlecht zu Geschlecht; keine Localsagen von versunkenen Schlössern, wo grausame Ritter und Grafen hausten, oder von umgehenden klagenden Burgfräulein, machen die Wangen der Mägde erblassen, wenn sie Abends am Spinnrade um den warmen Ofen beisammen sitzen. Selbst die allgütige Mutter Natur, die so manches holsteinische Dörfchen mit anmuthiger Schönheit begabte, scheint beim Ausstreuen ihrer Gaben, als die Hand diesen Ort berührte, die Finger etwas fester geschlossen zu haben. Wo aber wäre unter dem weiten Himmelszelte ein Fleckchen Erde, das aller Reize baar wäre? Hat doch selbst die braune, öde Haide ihre Poesie. So bietet auch das Dorf Föhrden mit seinen stattlichen Gehöften, seinen saftigen Wiesen, den in der klaren Au sich spiegelnden Baumgruppen manchen Punct, der in der Erinnerung eines empfänglichen Beschauers einen behaglichen Eindruck zurückläßt. So ist es jetzt, so war es vor zweihundert Jahren, dem Zeitpunkte, in welchem die in nachstehenden Blättern aufgezeichneten Ereignisse Statt hatten.
Ein warmer, klarer Junitag beleuchtete mit seinen scheidenden Strahlen ein Stück sonntägliches Stilllebens. Die Männer saßen vor den Häusern auf der Bank oder wandelten gruppenweise durch das Dorf und besprachen was die Kirchgänger neues aus Bramstedt heimgebracht hatten. Die Frauen führten die besuchenden Nachbarinnen in den Kohlhof, beschenkten sie mit Sträußchen von Rauten und Federnelken, versprachen Stecklinge oder Sämereien von neuen Blumen und Gemüsearten oder plauderten über Butter und Eierpreise, während man weiter abwärts das laute Schäkern und Plaudern der Jugend vernahm, die sich mit harmlosem Spiel vergnügte.
Oben im Dorfe saß unter den schattigen Bäumen seines Hofes der Vollhufner Hans Kruse in traulichem Gespräche mit seinem Nachbar Clas Soodt. Die großen silbernen Knöpfe in dem blauen Wammse und an den weiten Kniehosen zeugten von der Wohlhabenheit des Mannes, und die breitschulterige, kräftige Gestalt, das blühende, ehrliche Gesicht, das unter dem runden Filzhute hervorschaute, die kurze Pfeife mit dem Kraute, welches in weniger denn einem Jahrhundert sich so übers Land verbreitet hatte, daß es in keinem Hause fehlen durfte, gaben den Typus eines begüterten holsteinischen Geestbauern, der zufrieden mit sich und der Welt, seine Tage in Ruhe dahinlebt.
Der neben ihm sitzende Freund schien ungleich lebhafterer Natur. Die Augen blitzten unter den buschigen Brauen, und lebhafte Geberden begleiteten seine Rede.
„Wahrschau meine Worte, Hans,“ sprach er eifrig, „wenn der Wallenstein wirklich ein Sterngucker ist – und der Schulmeister schwört darauf, daß er die Geschicke der Menschen am Himmel lesen kann – da wird der Kaiser keinen geschickteren Feldherrn wählen können, denn wenn er das Pfaffenthum nicht mit Gottes Beistand wieder einführen kann, so thut er es mit Hülfe des lebendigen Gottseibeiuns! Die Lutherischen setzen alles daran die reine Lehre zu schirmen; blutige Zeiten werden Noth und Elend aller Art über uns bringen. Wer bürgt uns dafür, daß sie nicht gar unsere Söhne wegschleppen, unsere Höfe plündern und abbrennen und in des Herrn Namen das Land verwüsten als ob ein Fluch darauf läge und….“
„Gemach, gemach, Clas,“ unterbrach Hans den Freund, ,„warum gleich den Schwarzen an die Wand malen! Der Kaiser rührt sich noch gar nicht, und wenn hinter dem Kriege auch wirklich der Plan steckte, die Lutherischen zu vernichten, so können wir, so lange sie unten im Lande das Volk noch satt machen können, hier oben ganz ruhig sein. Der vertriebene Böhmenkönig soll zwar den König Christian in Segeberg hart um Hülfe angegangen sein, aber der wird sich dreimal besinnen, bevor er Land und Leute in Gefahr bringt.“
„Wenn er aber, wie der Schulmeister sagt, dem Bunde der Niedersächsischen beigetreten ist….,“ wandte Glas Soodt ein.
„Ei, nun, wenn es wirklich so schlimm wäre, so wird Gott der Herr doch immer seine gnädige Hand über uns halten. Kein Edelmann kann unsere Söhne unter die Fahne rufen, und wollen sie freiwillig die Picke tragen, so wird ihnen selbst im dichtesten Kugelregen kein Haar gekrümmt, wenn es nicht des Herrn Wille ist.“
„Was ist das?“ fragte Clas Soodt, die Ohren spitzend, als sich in der Nähe ein lautes anhaltendes Peitschenknallen vernehmen ließ.
„Das ist die närrische Wiebeke, die wieder ihre Possen treibt,“ erklärte Hans Kruse, indem ein Lächeln seine Lippen kräuste.
„Einen solchen Lärm kann das Mädchen allein unmöglich machen. Dabei sind mehrere,“ rief Clas Soodt aufstehend.
„Sie ist es auch nicht,“ entgegnete der Vater, „sie mustert nur ihre Recruten. Du weißt ja, daß das Peitschenknallen ihr die liebste Musik ist. Seitdem die Kühe ausgetrieben werden, merkt sie jeden Tag darauf, wer von den Jungen am besten knallt; Sonntags müssen sie noch einmal Probe ablegen und wer dann seine Sache am besten macht, dem giebt sie das Vesperbrot, das sie zu dem Zwecke dem eigenen Munde abspart.“
„Sie hat von klein auf ihre absonderlichen Einfälle gehabt,“ meinte Clas Soodt kopfschüttelnd, und beide Männer gingen, dem Treiben des Mädchens zuzusehen.
Von den vier Kindern: zwei Söhnen und zwei Töchtern, die um Hans Kruse aufwuchsen, stand die Wiebeke seinem Herzen am nächsten. Nicht minder war sie der Liebling von Nachbar Soodt, welcher sein Pathenkind mit zweifachem Interesse aufwachsen sah, indem er den stillen Wunsch hegte, sie eines Tages an der Hand seines ältesten Sohnes auf seinem Hofe als junge Frau einziehen zu sehen. Hans Kruse hatte die Gedanken des Freundes längst errathen, doch war niemals ein Wort darüber unter den Männern gewechselt worden.
Seitwärts vom Hause lag der Brunnen neben einem dicht belaubten, weitästigen Apfelbaume, welcher nach damaligem Brauche bei der Geburt des jetzigen Hofbesitzers gepflanzt war. Unter diesem Baume, von den tiefhängenden Zweigen anmuthig umrahmt, saß auf einem umgestürzten Waschkübel ein junges Mädchen, ein Bild der Gesundheit und ländlicher Frische. Helle Rosen blühten auf den runden festen Wangen, und so ernst die klugen braunen Augen in diesem Augenblicke dreinzuschauen versuchten, gelang es ihnen doch schlecht, den dahinter lachenden Schalk zu verschleiern. Vor ihr standen vier bis sechs kleine Buben aus dem Dorfe und schwenkten die Peitschen in die Luft, daß einem die Ohren gellten, bis die junge Kunstrichterin das Zeichen zum Aufhören gab.
„Komm her, Peter Böge, heute hast Du das Butterbrod verdient,“ sprach sie, einen kleinen etwa zehnjährigen Buben herbeiwinkend und ihm die mit geräucherter Wurst belegte Brodschnitte reichend. Als sie indessen die lüsternen Blicke der anderen Knaben auf die leckere Zukost bemerkte, fügte sie gutmüthig hinzu: „Ihr anderen müßt Euch festere Schnüre an die Peitsche drehen, – den Hanf dazu könnt Ihr von mir holen. Da werdet Ihr Eure Sache bald ebenso geschickt machen, wie Peter Böge, und nächsten Sonntag werde ich das Brod wohl unter Euch theilen müssen.“
„Da will ich mir doch ausbitten, daß Ihr den Heidenlärm anderswo hintragt, als auf meine Hofstelle,“ ließ sich hier des Vollhufners Stimme dicht hinter dem Baume vernehmen. „Ist das ’ne Sitte, so den heiligen Sonntagsfrieden zu stören!“
Die beiden Männer waren ungesehen näher gekommen. Wiebeke’s Wangen färbten sich bei den barschen Worten des Vaters noch höher. Sie erhob sich rasch und grüßte nicht ohne Verlegenheit den Gevatter.
„Ist das ein Sonntagsvergnügen für ein sittiges Mädchen,“ brummte der Vater weiter, „sitzt sie hier und vertreibt die Zeit mit Knabenspielen, statt mit den anderen Mädchen ins Holz zu gehen und Maiblumen zu pflücken! Mädchen, Mädchen, wenn der liebe Gott Dich plötzlich abriefe, da könnten wir es erleben, daß statt der Mädchen mit den Blumensträußen Dir die Buben das Geleite gäben, und statt des Kranzes einen Peitschenstiel auf Deinen Sarg legten!“
„Man soll mit dem Tode nicht spaßen,“ erwiderte der Nachbar. „Vor dem Todtenkranze kommt doch hoffentlich erst die Brautkrone, und wenn ich Deinen Ehrentag erlebe, Wiebe, da soll Dich, wenn Du aus der Kirche heimkommst, ein solches Peitschengeknalle empfangen, daß die Fenster klirren.“
„Das ist ein Wort, Clas-Ohm,“ antwortete Wiebeke lachend, nachdem ein verstohlener Blick auf den Vater sie darüber beruhigt hatte, daß sein Zorn diesmal nicht tiefer, als auf der Zunge steckte, „dafür tanze ich den ersten Tanz mit Euch.“
Die Knaben waren indessen davongeschlichen, bis auf den Preisgekrönten, der sich ins Gras warf, um das Sonntagsbrod ungestört zu verzehren.
Die erhobene Stimme des Hufners hatte die Hausmutter mit den besuchenden Frauen an die Schwelle der Seitenthür gelockt, wo sie das Ende des Gespräches mit angehört hatten.
„Von Wiebe’s Ehrentag haben wir nicht viel Freude zu erwarten“, sagte die Mutter. „Wenn die ihren alten Wittwer heirathet, wird keiner auf ihrer Hochzeit tanzen wollen.“
„Sie hat ihn noch nicht, und die jungen Leute werden wohl aufpassen, wenn’s Zeit ist,“ entgegnete Clas Soodt unwirsch.
„Warum sollte denn Wiebekeeinen Wittwer heirathen?“ fragte die Schulmeisterfrau, die erst seit kurzem im Dorfe wohnte und deshalb noch nicht in alle Familiengeschichten eingeweiht war.
„Das ist ihr von einer Tatersche prophezeit worden, ehe sie noch getauft war“, seufzte Frau Kruse.
„Vor der Taufe? Wie konnte das angehen?“ fragte die Schulmeisterfrau erstaunt.
„Hab‘ ich Dir die Geschichte noch nicht erzählt? Ja – das war seltsam genug. Die Kleine war am Donnerstage geboren und mußte einen Sonntag über liegen, bevor wir mit ihr zur Kirche fahren konnten. Wir thaten natürlich was wir vermochten, um das Kind vor allem Bösen, was in der Luft fährt, zu schirmen. Der Bauer hatte gleich eine Furche um das Haus gepflügt, über die nichts Böses herüber kann; wir hatten Stahl im Bette stecken und ein Kreuz an die Wiege gemalt. Keiner kam herein um das Kind zu sehen, der nicht vor der Thür die Schürze ausschüttelte und erst zum Ofen ging, ehe er an die Wiege trat, und Nacht für Nacht brannten wir Licht und wachten. Am letzten Sonnabend mußten alle zum Heuen nach der Wiese; Anna Stina saß bei mir, da hörten wir mit einem Male eine Kuh, die wir von der Weide in’s Haus genommen hatten, so laut brüllen, daß Anna Stina erschrocken hinauslief. Ich hatte gerade ein bischen geschlafen und war erst durch den Lärm aufgewacht. Anna Stina war keine drei Minuten fort, als die Thür aufging und eine Tatersche hereinkam, mit einem so gelben Gesichte und so pechschwarzen Augen, wie man sie je gesehen hat. Ich schrie vor Angst laut auf.
,Fürchtet Euch nicht, Frauchen,‘ sprach sie gutmüthig. ,Bin ich nicht ein Mensch von Fleisch und Blut wie Ihr selbst, und Mutter von einer Reihe solcher Würmchen, wie Ihr da eins liegen habt! Ich werde Euch ja kein Leid zufügen und bin blos hereingekommen um ein Stückchen Speck zu erbitten, damit ich es mir nicht ohne Euren Verlaub zu nehmen brauche.‘
„Sie sah wirklich ganz sanft und menschlich aus, als sie so sprach; aber als sie an die Wiege trat, rief sie, die Hände zusammenschlagend:,Gottes Wunder, da liegt ja ein gezeichnetes Kind! Das trägt ja einen Stern auf dem Kopfe!‘
„Einen Stern? wiederholte ich. Was bedeutet der? Sie hatte einige schmutzige Kartenblätter aus der Tasche gezogen, warf drei derselben auf die Wiegendecke und sagte nachdenklich:,Es ist ein Mädchen – – sie wird einen alten Wittwer heirathen und durch ihn zu Gelde kommen; aber weite, lange Wege muß sie gehen, bis es so weit kommt.‘
„Schweigt, um Jesu willen schweigt, bat ich. Thut mir dem armen Wurm nichts an! Da kam Anna Stina herein, und die wäre vor Schreck beinahe in die Knie gesunken, als sie das Weib erblickte. – Gieb der Frau ein Stück Speck und ein halbes Dutzend Eier, sagte ich, sie will ihren Kindern gern einen Pfannkuchen backen; etwas Mehl muß sie auch wohl haben.
„Anna Stina ging schweigend mit der Fremden hinaus, die mir noch an der Schwelle ein treuherziges,Gott segne Euch!‘ zurief. Als sie über den Hof ging, warf Anna Stina ihr aber heimlich eine glühende Kohle nach, kleidete das Kind um, räucherte die Stube und die Wiegendecke mit Wachholder, und wir verabredeten, daß wir keinem von dem, was vorgefallen war, erzählen wollten, bevor das Kind getauft sei.“
„Ihr könnt von Glück sagen, daß das gut gegangen ist“, meinte die Schulmeisterfrau, die theilnahmvoll zugehört hatte. „Das Tatervolk bringt selten Heil ins Haus.“
„Es ist nicht so schlimm, wie man glaubt“, versicherte Frau Kruse. „So sehr mich das Weib damals erschreckte, habe ich mich doch später viel weniger vor den Leuten gefürchtet als vorher. Sie haben mir auch niemals Leides angethan“.
Keiner hatte bemerkt, wie gespannt Wiebeke mit halb ‚ geöffnetem Munde und starrem Blicke der Erzählung zuhörte; keiner ahnte, was in dem Mädchen vorging, als sie sich sachte fortschlich bis in den entlegensten Winkel des Gartens, wo sie eines Begebnisses gedachte, das sie seit einem Jahre als Geheimniß für sich bewahrte. Sie war zur Erntezeit mit aufs Feld hinausgeschickt worden und hatte eines Tages, erhitzt und von der Arbeit ermüdet, ein schattiges Ruheplätzchen aufgesucht, wo üppige Brommbeerranken sie an den Rock zerrten und sie gleichsam aufforderten, sich an ihren schwarzglänzenden, saftigen Beeren zu laben. Hingestreckt auf die grüne Matte, hatte sie bereits eine Weile geruht und von den süßen Beeren genascht, als sie es hinter sich in dem Gebüsche rascheln hörte und plötzlich ein fremdes Weib vor sich stehen sah, das jenem umherirrenden Stamme angehörte, welchen die holsteinischen Landleute „Tater“ zu nennen pflegen.
„Wem gehört dies Feld?“ fragte sie.
„Dem Vollhufner Hans Kruse.“
„Bist Du von seinen Leuten?“
„Ich bin seine Tochter.“
„Gelt, da habe ich Dich vielleicht schon früher einmal gesehen,“ sprach das Weib, die schwarzen Augen forschend auf das Mädchen heftend. „’ne schmucke Jungfrau bist Du geworden, obgleich Du nicht mehr den goldenen Stern auf dem Kopfe trägst wie damals; den hat der Priester Dir mit dem Taufwasser abgewaschen: bist ja ein Christenkind. Jetzt reiche mir Deine Hand, damit ich sehe ob ich Dir damals richtig prophezeit habe.“
Wiebeke war durch die Erscheinung überrascht und folgte der Aufforderung nicht ohne ein leises Beben.
„Sieh da, ein eigenes Haus und ein stattliches, großes obendrein!“ rief die Fremde, die Linien in der kleinen derben Hand aufmerksam prüfend. „Einen alten Mann wirst Du heirathen; aber Kind….. was für Wege, helle und dunkle, mußt Du wandeln bis es so weit kommt!“ Dann ließ sie hastig die Hand fahren und sah dem jungen Mädchen ernst ins Gesicht. „Ich will Dir nicht mehr offenbaren“, sprach sie, „nur Eines will ich Dir noch sagen: Schaffe Dir einen festen Sinn; denn zu solchen Wegen, wie sie Dir vorgezeichnet sind, gehört viel Klugheit und große Vorsicht. Die beste Genossin der Klugheit aber ist die Wahrheit. Sprich deshalb, und wenn es Dir noch so schwer wird, immer nur die Wahrheit, und sei fest und treu, wo Du Treue schuldig bist. Sprich nicht von mir, aber gedenke meiner Worte. Vielleicht begegnen wir uns noch einmal wieder im Leben.“
Mit diesen Worten war sie fortgegangen. Wiebeke versuchte nicht sie zurückzuhalten. Sie aß keine Beeren mehr, fühlte keine Ermüdung mehr. Wie im Traume befangen saß sie, bis das Wetzen der Sensen sie in die Gegenwart zurück und wieder an die Arbeit rief. Sie hatte keinem von dieser Begegnung erzählt und da sie eine gesunde Natur, einen kernfrischen Sinn hatte, so dachte sie auch wenig über die seltsame Prophezeiung nach. Nun aber hatte die Erzählung der Mutter die schlummernden Erinnerungen wieder geweckt und Wort für Wort tönte aus der Rede der Zigeunerin in ihr wieder. Weite Wege sollte sie gehen? Wie sollte das geschehen! Sie hatte freilich oftmals von der Mutter gehört, daß man erst anderen dienen müsse, bevor man selbst Knechte und Mägde beaufsichtigen und leiten könne, aber wenn der Vater sie auch bei einem Freunde als Magd verdänge, so würde das doch nicht weitwegs sein. So viel und so lange sie grübelte, wurde es doch nicht klar in ihr, und als endlich die rufende Stimme der Mutter ihre Gedanken abbrach, da seufzte sie wie erleichtert auf und eilte ins Haus. An der Gartenpforte brach sie noch rasch einen blühenden Fliederzweig, den sie dem auf der Diele stehenden Vater lachend an den Hut steckte, und nach wenigen Augenblicken war der Tisch zur Abendmahlzeit geordnet. Die hölzernen Teller und Löffel, das feine Roggenbrod, die frische gelbe Butter und die große dampfende Schüssel mit Milchgrütze, die sie mit sicherer Hand auftrug, deckten den Tisch, um welchen die Hausgenossen sich versammelten und nach kurzem Abendgebete das Mahl begannen. Wiebeke’s Gesicht trug keine Spur von den ernsten Gedanken, die noch vor wenigen Minuten ihr Auge umschleiert hatten, und als die Geschwister und Nachbarkinder sie nach dem Essen zum munteren Spiele einluden, bis der Vater ans Schlafengehen mahnte und die Nacht das ganze Dorf in Schlaf versenkte.
II.
„He, Doctor, wohin so eilig? Kommt nur erst einen Augenblick mit in die Apotheke, damit wir erfahren was der Postmeister heute neues aus der Tasche schüttelt. Er maß den Blek mit so langen Schritten, als hätte er Eile, der Bürde los zu werden.“
Es war der Kirchspielvogt von Bramstedt, welcher dem mit flüchtigem Gruße vorübereilenden Fleckensarzte diese Worte zurief.
„Hab‘ jetzt keine Zeit, doch komme ich vielleicht später noch“, antwortete der Doctor im Weitergehen.
„Da laß ich gleich einen „Halben“ für Euch einschenken!“ rief der Kirchspielvogt dem geschäftigen Arzte nach, und trat dann in die Apotheke, wo damals die „Honoratioren“ des Ortes sich jeden Morgen zu versammeln pflegten, um bei einem Magenschnäppschen, dessen Zubereitung ein Geheimniß des Apothekers war, die Landes und Ortsneuigkeiten zu verhandeln. Der kleine Cirkel war im vorigen Jahre in der Person des Postmeisters durch ein neues Element aufgefrischt worden. König Christian IV. hatte nämlich, hauptsächlich im Interesse der Handeltreibenden, im Jahre 1624 eine Postverbindung zwischen Kopenhagen und Hamburg eingerichtet, und da inzwischen der in Bramstedt stationirte Zollcontroleur mit Tode abgegangen war, so wurde der Nachfolger mit der vereinigten Verwaltung des Zoll- und Postamtes betraut. Der Mann hatte lange als Schreiber im Zollamte in Kopenhagen gearbeitet und war nicht allein unerschöpflich an Anecdoten aus der Hauptstadt und dem Privatleben des Königs, er war auch stets derjenige, welcher durch die Boten, die damals die Post und die coursirenden wahren und falschen Gerüchte von Ort zu Ort beförderten, zuerst erfuhr, was es Neues im Lande gebe, was er dann seinen Freunden gewissenhaft mittheilte.
Wir finden ihn auch jetzt neben dem Herrn Pfarrer an einem Tische sitzen, auf welchem der große Tabackkasten, das Kohlenbecken, die Schwefelspäne, die Flasche mit der bitteren Herzstärkung und ein Brett mit Gläsern andeuteten, daß die Herren als tägliche Gäste erwartet wurden.
„So, Postmeister, jetzt fangt noch einmal von vorn wieder an“, rief der eintretende Kirchspielvogt dem Freunde zu, der in der That bereits in vollem Zuge war. „Was giebt’s denn heute? Wirbt der Wallenstein wirklich? Hat Tilly noch keine Prügel bekommen, und sind die hohen Herrschaften in Segeberg bereits versammelt? Wenn wir Euch nicht hätten, da säßen wir hier, wie die Katze im Sacke, und wüßten nichts von dem, was in der Welt passirt.“
„Ihr scherzet, Herr,“ entgegnete der Postmeister lächelnd. „Wenn hier im Orte jemand von dem Stand der Dinge unterrichtet ist, so dürfte es doch vor allem der Magistrat sein, bei welchem die Depeschen und amtlichen Befehle direct einlaufen, während ich nur erfahre, was die vorüberfliegenden Boten aufgeschnappt haben. Daß der Wallenstein wirbt, ist nur allzu wahr, und daß Tilly näher und näher rückt, wissen die Herren so gut, wie ich. In Neumünster erwartet man den König heute von Rendsburg, und in Segeberg war schon gestern kein Unterkommen mehr zu finden, wie mir mein Nachbar Fuhlendorf heute früh erzählte. Man erwartet dort die Herzoge von Braunschweig und Mecklenburg nebst vielen hohen Gesandtschaften und scheint wirklich Se. Majestät mit dem Kreisoberstenamte betrauen zu wollen…“
„Wenn Se. Majestät es annimmt‘, unterbrach der Kirchspielvogt.
„Warum sollte Se. Majestät die Würdenicht annehmen?“ fragte der Pfarrer, der bisher schweigend zugehört. „Als Herzog von Holstein hat er das Recht dazu, und als gottesfürchtiger, frommer und persönlich tapferer Fürst ist er d r Mann, die reine Lehre zu schirmen und den Vertheidigungsmaßregeln den nöthigen Nachdruck zu verleihen.‘
,,Und wenn wir durch diese Maßregeln das Kriegsungeheuer ins eigene Land locken?“ warf der Apotheker dazwischen.
„Ist es denn nicht besser eine kurze Zeit mit den Glaubensbrüdern zu leiden, als daß es der katholischen Kirche gelingt, den Protestantismus zu erdrücken? Ist es nicht besser, unser zeitlich Gut zu verlieren, als das ewige Heil einzubüßen?“
„Sehr wahr, Herr Pastor,“ entgegnete der Apotheker. „Aber wenn nun die Liguisten kämen und Eure Vorräthe an Speck und Mehl und Eiern und Milch aufzehrten, so daß die Frau Pastorin nichts mehr auf den Tisch bringen könnte; wenn sie den Heuboden leer machten, so daß ihr den Pferden das Maul zubinden und Eure Amtswege zu Fuß antreten müßtet, was würdet Ihr dazu sagen?“
Der Pfarrer netzte die Lippen mit dem bitteren Liqueur und blieb die Antwort schuldig.
„Der Herzog von Lüneburg hat wenig Ehre davon, daß er sein Amt niederlegte in einem Augenblicke, wo die Wohlfahrt der niedersächsischen Länder gewissermaßen von dem energischen Auftreten ihres Kreisobersten abhing“, nahm der Postmeister das Wort; denn seitdem der König von Böhmen in der Fürstenversammlung zu Segeberg die protestantischen Höfe anflehte ihm zur Wiedererlangung seiner Länder zu verhelfen, erheischt die Ehre des Kreises die Glaubensbrüder zu unterstützen und für die Gleichberechtigung der Religionsparteien in die Schranken zu treten.“
„Darin liegt noch immer kein Grund für König Christian sich der Sache so heiß anzunehmen und seine Unterthanen in Gefahr zu geben,“ eiferte der Apotheker. „Laßt England und Schweden auch etwas thun. Die Königin von Böhmen ist eine englische Königstochter, und Gustav Adolph steht ihr seit seiner Vermählung mit Maria Eleonora von Brandenburg in verwandschaftlicher Beziehung eben so nahe, wie der König von Dänemark.“
„Sie werden sie auch nicht im Stich lassen“, versetzte der Postmeister. „Will England wegen der Heirathunterhandlungen zwischen dem Kronprinzen und der spanischen Infantin nicht gegen die Katholiken zu Felde ziehen, so wird es Geld schicken, und Gustav Adolph hat seine Hülfe nicht verweigert. Uns kann es ja übrigens nur erwünscht sein, wenn unsere Herzogthümer durch den eigenen Landesherrn geschirmt werden.“
„Was wollt Ihr streiten um Dinge, die doch ohne Euer Gutachten abgeschlossen werden“, rief der Kirchspielvogt. „Krieg und Friede liegen in Gottes Hand. Da weiß ich besseres zu erzählen.“
„Und das wäre?“ fragte der Pfarrer.
„Ein geringes Scherflein zu den Neuigkeiten des Tages, wenn ich mich auch nicht mit dem Postmeister messen kann. Im Gebiete der Möglichkeit, ja der Wahrscheinlichkeit liegt das Ereigniß, daß Se. Majestät unseren Flecken heute noch mit seiner hohen Gegenwart beehrt.“
„Nicht möglich!“ rief es wie aus einem Munde.
„Ich wage nichts zu behaupten“, fuhr der Kirchspielvogt fort. „Doch ist es Tatsache“ – hier streifte ein schelmischer Seitenblick den Postmeister –, „daß Se. Majestät sich gestern zu Itzehoe aufhielt und daß hier am Orte Vorspann und diverse Wagen requirirt sind. Daß man auf dem Schlosse Besuch erwartet, schließe ich daraus, daß das Mörserklimpern und das Kreischen der Bratspieße bis über die Hudau schallt, was ich mit eigenen Ohren vernommen habe.“
„Wahres mag daran sein,“ meinte der Apotheker, den Kopf wiegend. „Nun wird mir auch klar warum die gnädige Frau, die sonst alle Specereien von Hamburg kommen läßt, gestern Abend spät eine ansehnliche Requisition an Zucker, Rosinen, Mandeln und feinen Gewürzen bei meiner Wenigkeit machte.“
„Da hören wir’s; wer wagt jetzt noch zu zweifeln?“ lachte der Kirchspielvogt.
„Aber sollen wir denn keine Vorkehrungen treffen, um…“
„Ich erinnere nochmals daran, daß mir keine officielle Anzeige gemacht worden ist und daß Se. Majestät, in Betracht der ernsten Zeiten, wie ein schlichter Reisender durchs Land zieht und sich überall jede Empfangsfeierlichkeit verbittet,“ erklärte der Kirchspielvogt.
„Aber man müßte doch,…. man könnte doch etwa…,“ fing der Postmeister wieder an.
„Was müßte man? Die Straßen sind gekehrt, gesetzliche Ordnung herrscht bis in den kleinsten Winkel, die Einwohner gehen ihrer Arbeit nach – kurz, der Ort ist in einem Zustande, in dem der Landesherr ihn zu jeder Zeit überraschen mag,“ sprach die Ortsbehörde, nicht ohne Selbstbewußtsein.
„Soll ich meinen König wirklich noch einmal von Angesicht zu Angesicht sehen! sprach der Postmeister bewegt. – – Ein schöner stattlicher Herr ist Christian IV., und so leutselig, daß manche seiner Ober- und Unterbeamten sich ein Beispiel daran nehmen könnten. – – Und mit dieser wichtigen Neuigkeit hält der Mann hier eine ganze halbe Stunde lang hinter dem Berge: ich frage, ist das freundschaftlich, meine Herren?“
Der Kirchspielvogt lachte. „Ich muß fort“, sprach er mit einem Blicke auf die Uhr. „Der Doctor läßt mich wieder mit dem „Halben“ sitzen. Nun, auf die Gesundheit unseres gnädigsten Königs,“ sprach er, das Gläschen an die Lippen führend, und verließ, den Freunden die Hand schüttelnd und die Bezahlung für die genossene Herzstärkung unter den Fuß des Glases schiebend, die Versammlung.
Diejenigen unserer Leser, welche mit den Gebräuchen vergangener Jahrhunderte weniger bekannt sind, dürfen nicht meinen, daß die Apotheke früher einer Wirtsstube gleich stand; aber eben weil in manchen kleineren Städten und Marktflecken ein Local fehlte, wo die Herren sich versammeln und Rede und Antwort tauschen konnten, fanden sie sich an manchen Orten bei dem Apotheker zusammen, welcher den Freunden artig mit Taback und Liqueur aufwartete; eine Aufmerksamkeit, die sich täglich wiederholte und deshalb nicht ohne Vergütung angenommen werden konnte, weshalb die Herren stillschweigend einige Schillinge für genossene Erquickung hinlegten, die nach ihrer Entfernung ebenso stillschweigend von dem Hausherrn eingestrichen wurden. Der Apotheker handelte damals nicht ausschließlich mit Medicamenten, sondern auch mit Colonialwaren und allen feinen Ingredienzien, womit die Hausfrauen das Backwerk und die Brühen reichlich zu würzen pflegten.
Fast um dieselbe Stunde, als die Herren sich nacheinander aus der Apotheke entfernten, bewegte sich auf der Straße, die von Hitzhusen nach Bramstedt führt, ein stattlicher Reiterzug vorwärts.. Die klare Maisonne spiegelte sich in den blanken Waffen, und die hellen Augen, die munteren Gesichter zeigten, daß ein mehrstündiger Ritt in den frischen Morgen den Rittern und Reisigen wohlgethan hatte. An der Spitze des Zuges ritt ein schöner stattlicher Herr, der seine Blicke bald auf die Wiesengründe und Aecker zur Rechten richtete, bald auf den im ersten Blätterschmucke prangenden Buchen ruhen ließ, welche zur Linken den Weg umsäumten. Dieses Gehölz, welches früher den Weg von Hitzhusen nach Bramstedt seiner ganzen Länge nach einfaßte, war Jahrhunderte lang der Stolz und die Zierde der Gegend, die Lust und Freude der Bewohner, bis es vor etwa zwanzig Jahren von schonungsloser Hand der Gewinnsucht eines fern lebenden Besitzers geopfert ward.
Der vornehme Reiter, der mit Wohlbehagen den Duft des jungen Birkenlaubes einzuathmen schien und dessen Auge mit fast andächtigem Blicke an den hohen, glattstämmigen Bäumen hing, war König Christian von Dänemark; ein schöner Herr, wie der Postmeister mit Recht sagte, damals noch im kräftigen Mannesalter. Läge das Leben dieses Fürsten weiter in der Geschichte zurück, so würde man wahrscheinlich erzählen, daß bei seiner Geburt gütige Nornen erschienen seien, die ihn mit allen Vorzügen des Leibes und der Seele begabt hätten. Jetzt berichtet die Geschichte, daß sich unter seinen Pathengeschenken ein vergoldetes Silbergefäß befand, auf dem man eine lateinische Inschrift las, die ihm das Glück Christian’s I., die Leutseligkeit Friedrich’s L, die Gottesfurcht Christian’s III. und die Großmuth Friedrich’s II. anwünschte, und daß dieser fromme Wunsch sich an ihm wirklich erfüllt habe. Seinen practischen, haushälterischen Sinn aber hatte Christian IV. von seiner Mutter geerbt, und noch jetzt zeugen die eigenhändigen Aufzeichnungen in seinen Almanachen davon, daß ihm nichts zu kleinlich schien, um seiner Beachtung werth zusein. Er baute Schiffe, Schlösser und Städte; zu den Kriegsschiffen verfertigte er nicht selten mit eigener Hand das Modell, für die Schlösser kaufte er selbst die zur Ausschmückung erforderlichen Gegenstände, und bei den Städten, die er gründete, ordnete er die Einzelheiten der Anlage, leitete er persönlich den Bau der Festungswerke. – Nicht minder als die Wohlfahrt seiner eigenen Unterthanen, ging ihm die Noth der deutschen Protestanten zu Herzen. Er hatte bereits mehrmals gerüstet, um ihnen Hülfe zu senden, doch hatte die wiederholte Versicherung des Kaisers, daß er die Religionsfreiheit auf keine Weise kränken werde, ihn bisher vermocht, von seinem Vorhaben abzustehen. Jetzt war er, wie wir bereits wissen, auf dem Wege nach Segeberg, um die ihm angetragene Würde eines niedersächsischen Kreisobersten anzunehmen. Wußte er, daß mit dieser Stellung Sorgen und Mühe mancher Art verknüpft waren, so gewann er doch mit derselben einen Einfluß auf die deutschen Angelegenheiten, den er nicht ohne Unruhe in die Hände seines ehrgeizigen Nachbars hätte übergehen sehen. –
Wenden wir jetzt unsere Blicke wieder der Reiterschar zu, welche unterdessen die ersten Häuser von Bramstedt erreicht hatte. Neben dem König ritt der damalige Besitzer des adligen Gutes Bramstedt, Arndt Stedingk; ihnen folgte der Stallmeister des Königs Wenzel Rothkirch, und zwei holsteinische Edelleute, Sigmund Pogwisch und Wolf v. Buchwald; dahinter das Gefolge, die Dienerschaft und die Leibwache des Königs. Christian IV. schien bei heiterster Laune und grüßte freundlich die Leute, welche durch das Pferdegetrampel vor die Thür gelockt wurden. Als er durch das Bekthor und gleich darauf an der Kirche vorüberritt, hielt er sein Roß an, lüftete den Hut und sprach andächtig ein kurzes Gebet; dann ritt er weiter, bis er die Bäckerbrücke erreichte, die schon damals nach dem hart an derselben gelegenen Backhause diesen Namen führte. Dort hielt er abermals sein Pferd an, um der anmuthigen Fernsicht zu genießen, welche den Blick auf den Pfarrhof, nach der Mühle hinüber und auf die Gärten und Baumgruppen am Ufer der Au von der Brücke aus gewährte. Auf einer Waschbrücke, welche im Vordergrunde von einem Garten ins Wasser hinaus gelegt war, stand in der kleidsamen Tracht des Landes, mit hochgeschürztem Rocke, ein junges Mädchen und spülte und klopfte das sauber gewaschene Leinenzeug. Als sie die vornehme Reiterschar über die Brücke ziehen sah, hielt sie verwundert inne und schaute, den Körper leicht nach vorn gebeugt, das Waschholz in der erhobenen Rechten, neugierig auf die Fremden, ohne zu ahnen, daß sie selbst einenmalerischen Ruhepunkt für die Augen der vornehmen Herren bildete. *(historisch, Anm. J.M.)
„Fürwahr, ein reizendes Bild, die Maid müssen wir näher beschauen“, rief der König munter, worauf Arndt Stedingk das Mädchen herbeirief.
Sei es nun, daß sie den Gutsherrn nicht gleich erkannte und glaubte, die Fremden seien des Weges unkundig, oder daß sie an Gehorsam gewöhnt dem Rufe folgte, genug: die junge Magd hüpfte leichtfüßig über den Zaun, glättete eilends die Röcke, zupfte an der grünen Bandschleife unter dem Kinn, welche das knappe, gestickte Käppchen hielt, und trat dann raschen Schrittes vor die Fremden.
„Wie heißt Du, schönes Kind?“ fragte der König, das blühende, rothwangige Gesicht mit den klugen, nußbraunen Augen wohlgefällig betrachtend.
„Ich heiße Wiebeke Kruse, und mit Verlaub, hoher Herr, wer seid Ihr?
„Wenn ich Dir das sagte, würdest Du mir vielleicht kaum glauben“, lachte der König, seinem Begleiter mit der Hand zu schweigen winkend.
„Bist Du die Tochter aus jenem Hause?“ fragte er weiter.
„Nein, Herr“, antwortete Wiebeke, den Kopf stolz aufrichtend, „hier bin ich Magd, aber auf dem Hofe meines Vaters, des Vollhufners Hans Kruse in Föhrden, bin ich Tochter vom Hause.“
Der König konnte sich ob dieses Patricierstolzes eines Lächelns nicht erwehren. „Warum dient denn die Tochter des begüterten Großbauern in fremdem Hause?“
„Weil mein Vater dafür hält, daß man erst sich in fremden Willen schicken und gehorchen lernen muß, bevor man selbst befiehlt,“ antwortete Wiebeke.
„Das ist brav“, rief der König, durch die freimüthigen, verständigen Antworten der Bauerntochter angenehm überrascht. „Wenn Du aber doch eine Zeit Dich in der Fremde umsehen willst, könntest Du ja auch meiner Gemahlin dienen. Sag‘, hast Du Lust mit mir zu kommen?“
Wer hätte, wenn ihm bei achtzehn Jahren der Eintritt in die Zaubergärten einer fremden Welt geboten wird, abwehrend die Augen davor geschlossen? So klopfte auch Wiebeke’s Herz rascher, als sie mit leuchtenden Augen antwortete:
„Wohl hätte ich Lust, aber ich darf nichts thun, ohne den Willen meines Vaters zu befragen, und ebensowenig darf ich zur Unzeit aus dem Dienste laufen“.
„Davor sei Gott, daß ich Dich hindere, Kindespflicht zu üben,“ sprach mit Ernst Christian IV., bei welchem der Scherz einem wirklichen Interesse an dem verständigen Mädchen zu weichen begann.
„Mit dem Brodherrn der jungen Magd kann Ew. Majestät gleich arrangiren, wenn es Ihr mit der Sache Ernst ist“, sagte Arndt Stedingk, auf den von fern zuschauenden Hofbesitzer weisend und selbigen auf eine beistimmende Kopfbewegung des Königs herbeiwinkend.
„Se. Majestät der König findet Gefallen an Deiner Magd, Jörgen,“ fuhr er fort, als der Landmann herzutrat. „Willst Du sie entlassen, so kann sie in Sr. Majestät Dienst treten.“
Bei dem Namen des Königs zuckte es in Wiebeke’s Augen, die sich starr und unverwandt auf den Landesvater hefteten, während sie die unwillkürlich gefalteten Hände fest ans Herz preßte.
„Mein Haus und mein Gesinde stehen dem Allergnädigsten Könige jederzeit zu Befehl,“ sprach Jörgen Götsche, sich tief verbeugend. „Hans Kruse’s Tochter ist ein braves Mädchen, und Vater und Kind können die Ehre, die ihnen widerfährt, nicht hoch genug schätzen.“
„Das wäre also abgemacht,“ entschied der König. „Wenn nun der Vater einwilligt, so halte Dich bereit, wenn ich binnen drei Tagen wieder über hier komme, mit nach Steinburg zu fahren, wo meine Gemahlin alsbald mit ihrem Haushalte eintreffen wird. – Aber halt!“ rief er, die Börse ziehend und einen Glückstädter Species hervornehmend: „Du hast ja noch kein Gottesgeld bekommen!“
„Man giebt hier zu Lande nur fünf Schillinge Gottesgeld“, sagte Wiebeke, das Geldstück zurückweisend. „Auch darf ich mich nicht festmachen, bevor ich nicht mit dem Vater gesprochen habe“.
„Mädchen, wenn Du so gediegen von Grund aus bist, wie Du scheinst, so darf ich Frau Christine gratuliren,“ rief Christian IV. „Könige dürfen übrigens soviel Gottesgeld geben, wie sie wollen. Sie wissen am besten zu schätzen, wer ihnen treu und redlich dienen will. Auf Wiedersehen“!
Mit diesen Worten setzte er sein Roß in Bewegung, grüßte huldvoll die Einwohner, welche neugierig auf die Straße hinausgetreten waren und der ihnen höchst auffälligen Unterredung von fern zusahen, und lenkte, von Stedingk geleitet, rechts um die Ecke dem Schlosse zu, wo er ein Stündchen rasten und ein Frühmahl einnehmen wollte, bevor er die Reise nach Segeberg fortsetzte.
Wiebeke Kruse war, seitdem wir sie zuerst in Föhrden kennen lernten, um 4 Jahre älter geworden. Der kleine, fest geschlossene Mund und das offene Auge verliehen dem blühenden Gesichte einen Ausdruck festen Charakters, der jedoch durch den heiteren, freundlichen Blick um vieles gemildert ward. Sie diente seit einem Jahre bei dem Hufner Götsche in Bramstedt, und als Hans Kruse seine Tochter bei ihm vermiethete, hatte er ihm eine Ehre damit zu erzeigen geglaubt. Die Eheleute Götsche aber hatte er deshalb von anderen erwählt, weil er sein Lieblingskind dort wohl beaufsichtigt und wohl aufgehoben wußte und es, wenn er Sonntags vor dem Kirchengehen dort einkehrte, jedesmal ein Stündchen sehen und sprechen konnte. Wiebeke war auch eine der flinksten, gewandtesten Mägde, sowohl bei der Feld als Hausarbeit, und von ihrer Brodherrschaft wohlgelitten. Galt es aber am Sonntage mit den Kindern und mit den jungen Leuten zu spielen, da war sie gewiß nicht die letzte, und besonders hatten die kleinen Buben im Hause stets die besten Peitschen, womit sie nach Herzenslust knallten, daß es weit über den Blek schallte, was ihnen schon manche Rüge von den umwohnenden Nachbarn zugezogen hatte.
Sobald die Reiterschar um Fuhlendorf’s Ecke verschwunden war, drängten sich die Bleksleute um Wiebeke, um die Veranlassung, den Gegenstand und den Ausgang ihres Gespräches mit den vornehmen Herren zu vernehmen. Das junge Mädchen war indessen selbst noch viel zu verwirrt, um ordentlich Rede stehen zu können. Das Geldstück des Königs in ihrer Hand zeugte davon, daß ihr nicht geträumt habe, aber die Zukunft lag nicht in den Tinten der Freude vor ihr; sie empfand vielmehr eine leise Furcht, und dennoch hätte sie das gegebene Wort nicht zurücknehmen mögen. Als die Neugierigen genug erfahren hatten, um es weitertragen zu können, zog Frau Götsche ihre Magd mit sich in die Kammer, wohin ihnen der Hausvater alsbald folgte.
Nachdem Wiebeke dem würdigen Ehepaar ausführlich erzählt hatte, wie sich alles zugetragen habe, sagte Jörgen Götsche nachdenklich:
„Das Beste ist, ich ziehe Stiefel an und gehe gleich mit Dir nach Föhrden; da kann Dein Vater selbst den Ausschlag geben.“
Wiebeke zuckte mit den Brauen. Sollte sie jetzt ihr Elternhaus wiedersehen und allen Angehörigen und Bekannten mit eigenem Munde sagen, daß sie sich von ihnen lossagen und in eine andere Welt ziehen wolle? – Sie fühlte, wie schwer ihr dies werden würde, und sprach deshalb nach kurzem Bedenken:
„Besser wäre es, der Vater käme hierher; wenn er dann seine Einwilligung nicht geben will, so braucht es das ganze Dorf ja nicht gleich zu erfahren.“
„Das Mädchen hat recht, Alter. Mach‘ Dich nur allein auf den Weg oder laß Hans Kruse bitten, einmal herzukommen“, rieth die Frau, und so geschah es.
Im Flecken verbreitete sich unterdessen rasch die Kunde von der Anwesenheit des Königs. Alt und Jung eilte nach dem Blek und harrte des Augenblickes, wo der Landesvater, von Stedingkshof kommend, an ihnen vorüber zum Hamthore hinausreiten würde.
Nur Wiebeke nahm an dem Jubel keinen Theil. Sie war wieder still an die Arbeit gegangen; aber so wortkarg und ruhig sie dem Aeußern nach blieb, so lebhaft und stürmisch wogte es in ihr. Sie sehnte sich nach der Ankunft des Vaters, dessen Anblick sie gleichwohl scheute, gleichwie sie den Tag der Abreise herbeiwünschte und doch jede Stunde hätte im Fluge aufhalten mögen. – Wer hätte nicht in seinem Leben ähnliches erfahren!
Das Bramstedter Schloß lag hart an der Straße, die vom Blek über die Hudaubrücke führt, in dem späteren gutsherrschaftlichen Garten, wie die vor einigen Jahren unternommenen Untersuchungen durch Entdeckung der Grundmauer bestätigten. Jenseit der Au stand ein Thorgebäude, dem entsprechend, welches am Blek dem Marktplatze des Fleckens liegt und seit dem Abbruche des verfallenen eigentlichen Schlosses als herrschaftliches Wohngebäude benutzt wird.
Arndt Stedingk hatte seine Gemahlin durch einen Boten von der Ankunft des hohen Gastes unterrichtet und wollte, daß sie erst in der letzten Stunde an die Beamten des Ortes eine Einladung zum Frühstück ergehen lasse. Wir finden daher sämmtliche Herren, die wir vor wenigen Stunden in der Apotheke beisammen fanden, jetzt neben der Gutsherrin in der Vorhalle stehen, allein die erhitzten Gesichter, das unruhige Zupfen an Kragen und Manschetten verrathen, wie schnell sie in die Festkleider gefahren sind.
Nachdem der König sich aus dem Sattel geschwungen und mit Arndt Stedingk das Haus betreten hatte, stellte dieser ihm seine Gemahlin und die anwesenden Herren vor. Christian IV. bot der Dame den Arm.
„Ihr müßt großmüthig verzeihen, edle Frau, wenn ich im bestäubten Reisekleide vor Euch erscheine und den guten Anstand verletze, den ich Damen gegenüber sonst nicht gern außer Acht lasse,“ sprach König Christian artig.
„Ew. Majestät würde mich in große Verlegenheit setzen, wenn Sie Ihrerseits dem Besuche eine Ceremonie beilegte, welche zu beobachten mir unmöglich war, da es mir zu einem würdigen Empfange unseres hohen Gastes an Zeit gebrach. Ich rechne stark auf Ew. Majestät Nachsicht, wenn ich bitte mit einem patriarchalisch einfachen Frühmahle fürlieb zu nehmen.“
„So liebe ich’s“, entgegnete der König, in den Saal tretend, wo eine stattlich gedeckte Tafel mit den Entschuldigungen der Hausfrau im Widerspruch zu stehen schien.
Nachdem der König eine Weile mit den Fleckensbeamten geredet hatte, setzte man sich zu Tische, wo der vornehme Gast eine ungezwungene Unterhaltung anzubahnen wußte. Er erzählte der Frau v. Stedingk, welche zu seiner Linken saß, daß er bereits im Orte eine Magd gemiethet habe, und erklärte hausväterlich, wie er solches keineswegs ohne Vorbedacht gethan, sondern befohlen habe, daß man die dänischen Mägde, welche Frau Christine Munk „) (Christian IV. vermählte sich bekanntlich nach dem Tode der Königin Anna Catharina von Brandenburg mit Christine Munk, einer Tochter des Amtmannes zu Kor sör, Ludwig Munk.) in den deutschen Landen mehr zur Last als zum Nutzen seien, nach Kopenhagen zurückschicke, und daß die Frau Amtmännin zu Steinburg es übernommen habe, ein neues Dienstpersonal zu besorgen. Darauf wandte er sich plötzlich an den Hausherrn mit der Frage, ob man den Erbauer des Bramstedter Schlosses kenne und wie alt man selbiges halte.
„Das habe ich trotz eifriger Nachforschungen nimmer erfragen können,“ antwortete Arndt Stedingk, „doch ist es Thatsache, daß es früher den holsteinischen Grafen gehörte und daß es Residenz des Grafen Johann II. war, welcher letzterer sich hier aufhielt als er gefangen und nach Kiel geführt ward.“
„Ueber die Erbauung des Schlosses weiß ich leider auch nichts zu sagen,“ begann der Pfarrer. „Daß aber der Blek Bramstedt schon zu heidnischen Zeiten ein angesehener Ort gewesen ist, glaube ich mit, ich möchte sagen, historischer Gewißheit behaupten zu können. Wir wissen, daß die Sachsenapostel hier gepredigt haben; dieselben pflegten ihre Vorträge vorzugsweise an solchen Orten zu halten, wo die Heiden sich zu ihren Opferfesten und Thingsversammlungen zahlreich einzufinden pflegten. Daß hier am Orte ein heidnisches Heiligthum und Gerichte bestanden, ist mehr als wahrscheinlich, einmal weil der Ort an der großen Heerstraße von Süden nach Norden liegt, zweitens weil man die christlichen Kirchen meistens an solchen Stellen errichtete, wo bis dahin heidnischer Götzendienst getrieben worden, und dann auch, weil die alten heidnischen Thingstätten nicht selten in christliche Gerichtshöfe umgewandelt wurden. Ein ursprünglich heidnisches Gericht war das noch vor hundert Jahren hier gehaltene Göding up dem Jahrschen Balken. Auch unsere Rolandsäule möchte ich damit in Verbindung bringen.“
„Daß die Rolandbilder dem Neffen und Günstlinge Carl’s des Großen zu Ehren aufgepflanzt wurden, lernten wir bereits auf der Schulbank“, meinte Wolf v. Buchwald, den Pfarrer mit Ueberlegenheit anblickend,
„Allerdings, edler Herr,“ erwiderte der Geistliche mit feinem Lächeln, „doch pflegte mein Lehrer, der gelehrte Dr. Caresius hinzuzufügen, daß die Entscheidung der Frage späteren Jahrhunderten aufgehoben sein dürfte, und ich muß ihm darin beipflichten. Was mich dazu treibt, sie mit dem Gerichtswesen in Verbindung zu bringen, ist die einfache Thatsache, daß die Brabanter Kaufleute, welche über hier nach Norden ziehen, stets auf dem grünen Anger unter der Rolandsäule ihre Contracte schließen und ihre Streitigkeiten schlichten, was die hier anwesenden Bramstedter Herren und jeder Fleckenseingesessene bezeugen können. Daß ein solcher Ort sich zur Gründung einer Kirche eignete und einen christlichen Edelmann zur Anlage einer Burg verlocken mochte, finde ich sehr wahrscheinlich.“
„Die erste Kirche aber soll nicht im Orte, sondern beim Anklever, einem nordöstlich vom Flecken gelegenen Haine, gestanden haben,“ bemerkte der Kirchspielvogt.
„Daß dort eine Capelle gestanden, läßt sich allerdings kaum bestreiten, indem ein umzäunter Platz, auf dem man verschiedene zum Gottesdienste gehörende Geräthe ausgegraben hat, noch heute den Namen Capellenhof führt, und darauf hindeutende Erinnerungen noch im Volksbewußtsein fortleben, erwiderte der Pfarrer. Ob aber diese Kirche die Hauptkirche gewesen ist, wage ich nicht zu entscheiden; sie scheint mir an die Stelle eines Heiligthums erbaut zu sein, das entweder einer heidnischen Göttin geweiht oder von einer Priesterin beschützt war, da abergläubische Leute noch jetzt nicht selten im Anklever eine Frau in weißem Gewande erblickt haben wollen, die auf einem Baume sitzt und spinnt oder wehklagend dort umherirrt. Man hat mich wiederholt aufgefordert, den ruhelosen Geist zu bannen.“
„Eure Muthmaßungen zeugen von Scharfsinn und Ihr habt uns durch Euren Vortrag viel Vergnügen gemacht,“ sprach der König, der den Worten des Geistlichen in der That mit Interesse gelauscht hatte. „Wir müssen beklagen, daß bisher für die Aufzeichnungen der historischen Begebenheiten aller einzelnen Ortschaften so wenig gethan ist. Hoffen wir von der Gegenwart und Zukunft ein Besseres!“
„Ew. Majestät thut jedenfalls alles, um das Interesse der Wissenschaften zu fördern,“ sprach Wolf v. Buchwald, „und die Nachwelt wird König Christian für manches Institut zu danken haben, welches die Cultur und Ausbreitung der Künste und Wissenschaften bezweckt.“
Christian IV., welcher ein taubes Ohr für Schmeicheleien hatte und Wolf v. Buchwald als abgesagten Feind allgemeiner Aufklärung kannte, richtete sein klares Auge mit einem Blicke auf den Sprecher, vor welchem dieser die Lider senkte.
„Wißt Ihr denn auch, schöne Frau,“ sprach er dann, als man ihm gerade eine Schüssel mit marinirtem Aal anbot, „wißt Ihr denn auch, daß ich einstmals dieses schmackhaften Fisches wegen mit Gert Stedingk, dem Oheim Eures Gemahls, unliebsame Briefe gewechselt habe?“ *)( Historisch, Anm. J.M.)
Frau v. Stedingk verneinte. Ihr Gemahl aber rief von der anderen Seite des Tisches herüber: „Bei Gott, Ew. Majestät vortreffliches Gedächtniß ist nicht umsonst sprichwörtlich geworden, wenn Sie sich jenes Processes erinnert, der meinem Oheim seiner Zeit viel Verdruß bereitet hat.“
„Die Sache hing mit einem anderen Umstande zusammen, welcher auch mir Unbehagen verursachte“, sprach der König offenherzig und fuhr dann, zu seiner Dame gewandt, fort: „Der Proceß entstand wegen der Anlage eines Aalwehrs, und Herr Gert mochte seinem Nachbar hart zu Leibe gegangen sein, weil dieser Schutz bei dem königlichen Amte suchte. Da das Einschreiten des Amtmannes nichts fruchtete, ging die Sache so weit, daß ich einen eigenhändigen Brief an Herrn Gert erließ, um ihn an seine Pflicht und Schuldigkeit zu erinnern. Auch dies Schreiben blieb ein halbes Jahr lang unbeantwortet, bis Herr Gert sich endlich schriftlich mit seiner Abwesenheit entschuldigte, da er eine Reise nach Schweden gemacht habe. In dem Briefe erinnert er daran, daß er auf seinem Gute Gerechtigkeit über Hals und Hand habe und folglich auf seinem Gebiete thun könne, was ihm beliebe. Diese stolzen Aeußerungen meines Landsassen abgerechnet, wußte ich, daß er einer der Gesandten des Herzogs von Holstein gewesen sei, die von Carl IX. von Schweden zu eben dem Reichstage in Linköping eingeladen waren, zu dem meine Räthe nicht zugelassen wurden, indem der König ihnen halbwegs entgegenreiste und sie in Jönköping empfing, allwo sie ihr Anliegen vorbrachten und zur Umkehr nach Dänemark entlassen wurden. Ich war an dem Tage, wo ich das Stedingksche Handschreiben empfing, nicht sehr günstig gegen Euren Ohm gestimmt, obgleich ich es gewohnt bin, daß die Holsteiner so in Privat wie in Landessachen auf ihre Privilegien trotzen.“
„Ew. Majestät ist viel zu gerecht, um darin einen Tadel aussprechen zu wollen“, sprach Sigward v. Pogwisch, ein schöner Mann, der dem Könige mit schwärmerischer Verehrung anhing, freimüthig. „Thut nicht jedes Thier, das seinen Bau angegriffen sieht, was es kann, um denselben zu vertheidigen? Wie sollte da nicht der Mensch, in welchem Rechtsbewußtsein lebt, eine Nation, die zu politischem Selbstbewußtsein gekommen ist, ein Gleiches thun!“
Wenzel Rothkirch ergriff seinen Becher und leerte ihn mit einem beredten Blicke auf den Sprecher. Auf seinem offenen, ehrlichen Gesichte las man den Beifall, den er nicht in Worten auszusprechen wagte.
Arndt Stedingk rückte ungeduldig mit dem Stuhle. Er mochte befürchten, daß das Gespräch eine minder erfreuliche Wendung nehme, und ergriff deshalb den Becher, um auf das Wohl des königlichen Hauses zu trinken, da er bereits zu Anfang des Mahles die Gesundheit des Landesherrn zum Trinkspruch gewählt hatte. Die Gäste verstanden seine Absicht, und die Unterhaltung lief fortan über harmlose Gegenstände, bis der König die Tafel aufhob und bald darauf das Zeichen zum Aufbruch gab.
Daß er draußen von den versammelten Einwohnern mit lautem Jubel empfangen und bis vor das Thor begleitet wurde, haben wir bereits erwähnt. König Christian ging ernsten Zeiten entgegen, und die heitere Laune, die ihn heute so liebenswürdig gemacht hatte, ward von den Sorgen, welche das drohende Unwetter am politischen Horizonte ihm verursachte, mehr und mehr umhüllt, so daß sie nur selten wieder dauernd hervorbrach.
III.
Das Steinburger Schloß, welches gegen Ende des dreißigjährigen Krieges vom Grafen Christian Rantzau abgebrochen und in Glückstadt wieder aufgebaut wurde (nachdem es ihm von Christian IV. zu diesem Zwecke geschenkt worden), war im Jahre 1625 noch eine mit Thürmen, Ringwall und doppeltem Graben versehene, wohlbefestigte Burg. Sie war der Sitz des Steinburger Amtmannes und diente dem Könige Christian IV. bei seinen Reisen in den Herzogthümern oftmals als Aufenthaltsort, weshalb die Prachtwohnung des Schlosses stets zu seinem Empfange bereit stand, und jetzt zur Aufnahme der königlichen Familie, nach damaligen Begriffen von wohnlicher Behaglichkeit, noch besonders ausgeschmückt war.
In einem dieser Prunkgemächer saß in hohem Armstuhle eine noch jugendliche Dame, die Rechte, die ein kostbar gebundenes Psalmbüchlein umschlossen hielt, schlaff herabhängend, die feine Wange an die seidenen Polster gelehnt, die Lider halb geschlossen.
Bei einem Geräusche an der schweren eichenen Thür, welchedas Zimmer von dem Corridor trennte, zuckte sie leicht zusammen, ein wärmerer Farbton belebte flüchtig dasblasse Gesichtund sie erhob sich, um den Eintretenden zu begrüßen. Es war König Christian, welcher mit raschen Schritten sich seiner Gemahlin näherte und ihren Gruß mit einem Kusse auf die Stirn erwiderte.
„Ich kam um Dich zu einem Spaziergange aufzufordern, aber Dein Aussehen nimmt mir den Muth zu einer solchen Einladung,“ sprach er mit bekümmertem Blicke auf ihr blasses, leidendes Gesicht.
„Die kurze Ruhe hat mir wohlgethan,“ erwiderte Christine Munk freundlich, „und wenn Ihr mir noch ein Viertelstündchen vergönnen wollt, so bin ich bereit, Euch zu folgen, wohin es Euch beliebt.“
„Das brauchst Du bei Gott nicht zu betheuern,“ rief König Christian, den Arm um die schlanke Gestalt legend und das feine Köpfchen gerührt an sich drückend. „Mich reut, daß ich Dich schon jetzt reisen ließ, Du hättest Dich in Kopenhagen rascher erholt.“
„Sprech nicht so, mein Gemahl,“ sagte Christine, die Hand, welche ihr zärtlich die Locken aus der Stirn strich, an die Lippen drückend. „Die Sorge um Euch würde die Rückkehr meiner Kräfte mehr beeinträchtigt haben, als die kurzen Tagereisen bei so schöner Jahreszeit.“
„Ich habe mancherlei mit Dir zu reden,“ begann der König nach einer Pause, indem er Frau Christine sanft in den Sessel gleiten ließ und ihr gegenüber Platz nahm. „Hier sind Briefe für Dich von der Königin Sophie. Ihre Majestät schreibt mir, daß es den Kindern wohlgeht und daß unser Söhnlein Friedrich Christian keineswegs so schwach und lebensunfähig ist, wie die Aerzte glaubten, sondern so herrlich gedeiht, wie man es von einem sechswöchigen Kinde erwarten kann. Da wird er hoffentlich noch vor dem Herbste seiner Mama einen Besuch in deutschen Landen machen können.“
Christine Munk bezeugte ihre Teilnahme nur durch ein stilles Lächeln.
„Hier ist ein Schreiben von Frau Anna Lykke,“ fuhr der König fort. „Sie nimmt die Stelle als Hofmeisterin bei den Kindern an, doch kann sie ihr Amt nicht vor September antreten. Jetzt liegt es bei Dir zu entscheiden, ob Du Dich bis dahin ohne sie behelfen kannst, oder ob Friis, der sie uns recommandirte, sich nach einer anderen erkundigen soll“.
„Frau Anna Lykke ist mir so vielfach gerühmt worden, daß ich um ihretwillen schon etwas Geduld üben muß“, erwiderte Christine. „Die Kinder werden diesen Sommer viel im Freien spielen und sind in den Händen der alten Dorthe, ja selbst bei Deiner Holsteinerin wohl aufgehoben.“
„Denkst Du denn die alte Dorthe mit über die Elbe zu nehmen?“
„Gewiß. Sie ist mir treu ergeben und kann das neue Personal in seinen Dienstobliegenheiten unterweisen, da sie sich mit ihrem Rothwälsch sehr wohl verständlich zu machen weiß.“
„Und mit meiner Holsteinerin bist Du zufrieden?“
„Das ist ein merkwürdiges Mädchen,“ rief Christine lebhaft. „Sie hat zwar bäuerische Sitten und eine bäuerische Sprache, aber ein so scharfer Verstand, ein so feines Schicklichkeitsgefühl und eine so strenge Moralität sind mir selten vorgekommen. Auch mit den Kindern weiß sie umzugehen. Die Kleinen wollen sich bei niemandem an ders gedulden, selbst die heftige, herrschsüchtige Anna Catharina wird unter Wiebeke’s Aufsicht weich wie Wachs, ohne daß ein hartes Wort vonnöthen wäre.
„Es war also ein glücklicher Augenblick, in dem ich sie von der Waschbrücke herbeirufen ließ,“ meinte der König lächelnd.
„Ich will nicht vorschnell in Urtheil und Plänen sein,“ begann Christine von neuem, „doch möchte ich, wenn Ew. Gnaden nichts dagegen hat, dies Mädchen in verschiedenen nützlichen Dingen unterweisen lassen und mir eine brauchbare, schätzbare Hofjungfer an ihr erziehen.“
„Auf derlei Sachen versteht Ihr Frauen Euch besser, als ich,“ entgegnete der König. „Meine Einwilligung gebe ich dazu. – Hier halte ich es jedoch nicht länger aus,“ rief er aufstehend und an das Fenster tretend. „Durch diese niedrigen Scharten kann ja der liebe Gottessonnen schein nur tropfenweise hereindringen; die dumpfe Stubenluft kann Dir nimmermehr dienlich sein. Ich werde
dort unter den Kastanien ein Zelt für Dich ausspannen lassen, und dann sollen sie Dich in den warmen Sommertag hinaustragen, wo Du Deine Kinder mit den Vögeln um die Wette zwitschern hören und wie Blumen unter den Blumen spielen sehen kannst.“
Als er sich noch einmal mit fragendem Blicke nach seiner Gemahlin umwandte, nickte diese bejahend und fragte ihrerseits: „Ist es nothwendig, daß ich an der Tafel erscheine?“
„Du weißt, daß ich Dich ungern an meiner Seite vermisse,“ entgegnete der König. „Heute erwarte ich oben drein die Herren von Brandenburg und Weimar, die mit Fuchs aus dem Lager bei Itzehoe herüberkommen und mir von dem Stand der Dinge berichten sollen. Ist alles so weit gediehen, wie ich erwarte, so brechen wir übermorgen auf nach Haseldorf und gehen dort über die Elbe nach Stade zu.“
Christine Munk’s Blicke hafteten noch eine Weile freundlich an der Thür, durch welche ihr königlicher Gemahl verschwunden war, dann öffnete sie langsam das Siegel des erhaltenen Briefes, um zu sehen, was die verwittwete Königin Sophie ihr zu melden habe.
IV.
Obwohl wir nicht beabsichtigen auf diesem Blatte der vaterländischen Geschichte zugleich auch ein Bild des niedersächsisch-dänischen Krieges zu entwerfen, dürfen wir doch die kriegerischen Vorgänge jener Zeit nicht gänzlich unberücksichtigt lassen.
Dem Grafen Tilly waren die Truppenbewegungen in Holstein, sowie die Vorgänge in Segeberg, wo König Christian bei der Uebernahme des Kreisoberstenamtes den Besuch mehrerer Fürsten und zahlreiche Gesandtschaften empfing, kein Geheimniß geblieben. Er zog seine Truppen in Norddeutschland zusammen und überrumpelte einen wichtigen Paß an der Weser: die Stadt Höx.– ter, die unter braunschweigischen Schutzstand gehört,e. Zwar entschuldigte er diese Gewaltthat bei dem Haupte der Union damit, daß der Herzog Christian von Braunschweig und der Graf von Mansfeld in’s Clevische eingebrochen seien und sich dort, verschanzt hielten; doch konnte man sich im protestantischen Lager über die wahren Absichten des kaiserlichen Feldherrn nicht länger täuschen, zumal auch Wallenstein mit seinem Heere von Osten her im Anmarsch stand, weshalb man beschloß, der gewaffneten Neutralität mehr Leben zu geben, indem man sich dem liguistischen Heere gerüstet gegenüberstelle und seine Bewegungen in der Nähe beobachte.
Die Armee, reit welcher Christian IV. am 7. Juni bei Haseldorf über die Elbe ging, bestand aus 10,000 Reitern und 15,000 Mann Fußvolk. Außer den Herzogen Ulrich von Braunschweig und Adolph Friedrich und Johann Albrecht von Mecklenburg, welche dem Kreisobersten als „Gehülfen“ beigesellt waren, nennen wir von den Befehlshabern des Heeres: den kriegserfahrenen Philipp Fuchs, einen fränkischen Edelmann, und den Markgrafen Christian Wilhelm von Brandenburg, sammt den vom Könige ernannten Kriegscommissairen Sigward Pogwisch, Wolf v. Buchwald und Marquard Penz, welcher letzterer sich im letzten Schwedenkriege bei der Einnahme von Calmar durch persönliche Tapferkeit rühmlich ausgezeichnet hatte. Viele auserlesene, sowohl dänische, als fremde Officiere boten ihre Dienste an, und auch unter den freien Landessöhnen hatte mancher thatendürstende Jüngling sich freiwillig unter die Fahne gestellt.
Mit dieser stattlichen Heeresmacht zog Christian IV. von Stade über Hoya, Verden und Nienburg nach Stolzenau. Den ersten Grund zu Mißvergnügen fand er auf der Kokammerhaide, wo es sich bei der Musterung der niedersächsischen Truppen herausstellte, daß ihre Stärke unweit geringer sei, als sie von dem Kreise angegeben war. Nachdem er daselbst mehrere Tage gerastet, setzte er seinen Zug weiter fort bis nach Hameln, wo er die Truppen zu beiden Seiten der Weser Lager aufschlagen ließ, selbst aber mit der Hoffahne in der Stadt Quartier nahm.
In dem inneren Cabinette, dem sogenannten Geheimzimmer des Königs, fanden sich die Befehlshaber der vereinigten Truppenkörper versammelt. Der König hatte eben den englischen Gesandten entlassen, welcher ihm, im Auftrage seiner Regierung, ansehnliche Geldsummen zur Verfügung gestellt hatte, als Sold für das für englische Rechnung geworbene Kriegsvolk. So erwünscht diese Subsidien dem Kreisobersten kamen, so war er doch augenscheinlich bei schlechter Laune. Graf Tilly hatte sich nämlich über das Vorrücken der Unionsarmee beschwert, doch war es hauptsächlich die hochfahrende Ausdrucksweise des Generals, welche den König beleidigte. Als er den anwesenden Herren das Tillysche Handschreiben vorlegte, verfehlte es nicht seine Wirkung auf die Versammlung.
„Geruht Ew. Majestät mich mit Beantwortung dieses Schreibens zu beauftragen, so werde ich nicht ermangeln dem General ins Gedächtniß zu rufen, welche Sprache man gegen einen König führt“, rief Ulrich von Braunschweig.
„Ich meine, daß es gar keiner brieflichen Antwort bedarf,“ erklärte Philipp Fuchs. „Der Kaiser ist durch Se. Majestät von den Plänen der Union in Kenntniß gesetzt worden; General Tilly’s Versuch, dem Könige von Dänemark über sein Vorhaben Rechenschaft abzufordern, scheint mir dagegen nur eine Antwort mit dem Degen in der Faust zu verdienen.“
Die anwesenden Herren stimmten dieser Aeußerung bei, nur die von Mecklenburg schauten finster drein und schwiegen. Der König lächelte wohlgefällig; er hatte nämlich die Antwort an Tilly bereits fertig, und zwar ganz nach Fuchs‘ Sinne dem General erklärt, daß er ihn nicht für befugt halte, sein Thun und Lassen zu meistern. Nachdem das Schreiben laut verlesen und mit lebhaftem Beifalle begrüßt war, erhoben sich die Herzoge von Mecklenburg, die noch selbigen Tages heimreisen wollten, um sich bei dem Könige zu verabschieden. Da trat der Stallmeister des Königs ein mit der Meldung, daß eben ein braunschweigischer Landmann die Kunde gebracht habe, daß eine ansehnliche Heeresmacht von Osten her durch braunschweigisches Gebiet ziehe, um sich mit Tilly zu vereinigen, und daß Tilly einen Platz, genannt „Zum Stein“ besetzt habe und gen Hameln vorrücke.
Der König schwieg zu dieser Meldung, ging einige Male mit raschen Schritten im Zimmer auf und ab und blieb dann plötzlich vor einem mit Karten und Papieren bedeckten Tische stehen.
„Wenn wir dem Herren nicht bald ein Bein stellen, so wird er uns in unserem eigenen Lager aufsuchen,“ sprach er, die Hand schwer auf den Tisch fallen lassend. „Läßt er doch wider allen Respect seine Plänkler so dicht vor unserer Nase tanzen, als gelüste es ihn, die Schärfe unserer Schwerter zu prüfen!“
„Besser, man pfeift anderen zum Tanze, als nach anderer Pfeife zu tanzen“, sprach Wolf v. Buchwald halblaut.
„Gottes Tod! „Zum Stein“ sollen sie nicht lange rasten, da werden wir sie mit des Allmächtigen Hülfe bald vertreiben,“ fuhr der König fort.
„Ew. Majestät wolle bedenken, daß Sie durch einen Angriff auf diesen von kaiserlichen Truppen besetzten Ort aus der defensiven Stellung treten würde, die zu beobachten Ew. Majestät dem Kaiser versprochen hat“, bemerkte Johann Albrecht mit offenbarem Mißvergnügen.
„Wenn die Union als angreifende Partei die Feindseligkeiten eröffnet, ladet sie jedenfalls große Verantwortung auf sich,“ ergänzte Adolph Friedrich, der zweite Mecklenburger, bedenklich.
Der König betrachtete seine beiden Vettern mit übel verhaltenem Grimm. Eine tiefe Falte legte sich zwischen seine Brauen, und seine Augen blitzten als er mit starker Stimme rief:
„Die Feindseligkeiten haben begonnen mit dem ersten Tropfen protestantischen Blutes, der von den Kaiserlichen vergossen ward, seitdem sie gewaltsam in den Unionsländern Quartier nehmen und verwüsten, plündern und morden, wo man sich ihnen zur Wehr setzt. Die Kunst des Feldherrn besteht aber darin, bei jedem Unternehmen den rechten Augenblick zu erfassen, und den glaube ich jetzt gekommen.“
Als er bei diesen Worten seinen Blick über die Versammlung fliegen ließ, glättete sich seine Stirn, indem er die ungeduldigen Geberden seiner Getreuen bemerkte, die zusammengedrängt im Fenster standen und den Verhandlungen mit gemischten Empfindungen beigewohnt hatten.
„Die Wahl eines Befehlshabers für das abzusendende Corps würde mir schwer werden“, fuhr der König fort, indem sein Auge gnädig auf Penz und Pogwisch ruhte, „hätte nicht Wolf v. Buchwald, der mir am Musterungstage auf der Kokammerhaide einen nicht unwichtigen Dienst leistete und sich dafür eine Gnade von mir aus bitten sollte, mich um die Gunst ersucht die ersten Truppen wider den Feind führen zu dürfen. Ich löse also mein königliches Versprechen, wenn ich jetzt Dich, Wolf, beauftrage, mit drei Compagnien Fußvolk und zwei Fähn lein Reiterei gegen den Stein vorzurücken. Du sollst Dich bereit halten binnen einer Stunde weitere Ordres zu empfangen.“
Wolf v. Buchwald strahlte vor innerer Freude. „Wenn Gott mir beisteht werde ich Ew. Majestät beweisen, daß ich dieser Gnade werth war,“ sprach er, sich tief vor dem Könige verbeugend, und verließ dann, die übrigen Herren grüßend, das Gemach.
„Für Euch anderen bleibt noch Arbeit genug“, nickte König Christian den schweigsamen Rittern zu, und, sich an seine Vettern wendend: „Jetzt muß ich auch Ew Lieb den glückliche Reise wünschen, weil ich noch mehre Cou riere heute nach Norden zu expediren habe“.
Die Herren von Mecklenburg erhoben sich, grüßten den König, der ihnen treuherzig die Hand schüttelte, mit höfischer Steifheit und schritten der Thür zu, gefolgt vom General Fuchs und den Kriegscommissairen, in deren Blicken Christian IV. las, daß sie seinem Beschlusse ein müthig Beifall schenkten.
Als Penz und Pogwisch miteinander die Treppe hinabstiegen, sahen sie unten in der Halle einen kleinen Buben, bekleidet mit Helm und Küraß von versilberter Pappe und mit einem hölzernen Stoßdegen in der kleinen Faust, mit langen Schritten auf den Hof hinauslaufen.
„Wohin so eilig, Herr Waldemar?“ rief Pogwisch lachend, indem er den Kleinen einholte und am Weitergehen hinderte.
„Wolf sagt, es geht los, und der König hat mir versprochen, daß ich mit soll, wenn es losgeht, und nun muß laufen, daß ich Wolf einhole, ehe er davonreitet,“ rief der Knabe mit glühenden Wangen und bemüht sich von Sigward’s kräftigen Armen freizumachen.
Die Herren, welche dachten, daß der Kleine ohne Erlaubniß reißaus nehme, und ihn deshalb seiner Aufseherin, der alten Dorthe, wieder ausliefern wollten, hatten ihre Freude an dem Knaben, der sich nicht übel zur Wehr setzte und sich wacker durchzuschlagen bemühte, als sie zufällig an einem offenen Fenster des oberen Stockes Frau Christine Munk erblickten, die dem Gebaren ihres vierjährigen Söhnleins lachend zusah. Die Herren grüßten ehrerbietig hinauf und als sie in der Ferne eine Wärterin gewahrten, gaben sie den jungen Helden frei und setzten ihren Weg fort.
„Der Kleine beschämt die Herren von Mecklenburg“, sagte Marquard Penz ingrimmig. „An ihrer zaghaften Unentschlossenheit wird alles scheitern.“
„Sage, an ihrem Eigennutze, an ihrem Neid, an ihrer Uneinigkeit,“ fügte Pogwisch hinzu.
„Der Schwedenkönig hatte Recht, als er seinen Beistand unter der Bedingung zusagte, daß er vor allem freie Hand haben wolle und daß keiner der verbündeten Fürsten gegen sein Wissen und seine Einwilligung mit den Liguisten unterhandle,“ fuhr Penz fort. „Gedenke meiner Worte Sigward, Christian IV. wird Kummer und Undank ernten mit seinem großmüthigen Dazwischentreten. Ich habe bereits manches vernommen, was mir nicht gefällt; ’ne Schande ist es, daß von Tilly besoldete Officiere in unseren Reihen stehen!“
„Die sind nicht so stark, wie der Ast, an dem sie über kurz oder lang baumeln werden,“ entgegnete Pogwisch. „Tilly’s Armee leidet an demselben Schaden: sowohl Officiere, als Gemeine empfangen von uns ihren Sold für geschickte Mittheilungen. Ich weiß dies aus des Königs eigenem Munde.“
„Mag sein,“ brummte Penz. Aber schimpflich ist die Haltung dieser Duodezfürsten. Das Beispiel des Lüneburgers wird mehre nachziehen, und Johann Albrecht von Mecklenburg macht seit seiner zweiten Heirath ein so reformirtes Gesicht, daß er bei der ersten Verwüstung, die sein Land von Seiten der Kaiserlichen trifft, sogleich zu ihrer Fahne schwören wird.“
„Nun, er würde das Schiff nicht retten, wenn er im Sinken wäre,“ lachte Penz. „Ich bin härter im Gedränge gewesen, als wir es jetzt in düsterer Vorahnung sehen, und habe mich dennoch durchgeschlagen. So lange der Arm sehnig und stark und das Herz auf dem rechten Flecke ist, so lange hat es keine Noth, mein Freund. Du hast den König noch nicht im Gefechte gesehen. Er schlägt sich wie ein Kerl und hält, wo die Kugeln am lustigsten pfeifen, seine Haut nicht werthvoller, als die des gemeinen Soldaten. Es ist eine Lust an seiner Seite zu kämpfen. – Doch, wohin gehen wir eigentlich?“
„Ich wollte zu Wolf und ihm, wenn er ausrückt, das Geleite geben,“ erklärte Pogwisch.
„Topp, ich bin dabei“, entgegnete Penz, „doch muß ich erst in mein Quartier. Ein munterer Ritt wird uns die Mecklenburger Grillen wohl verscheuchen.
V.
Die königliche Familie war dem Heere in kurzen Tagereisen auf dem Fuße gefolgt. Der Aufenthalt in der freien, warmen Sommerluft hatte Frau Christine Munk wunderbar gestärkt und ihre anmuthige Schönheit wieder in holder Frische aufblühen lassen. Sie hatte ihren Haushalt auf den Feldfuß gestellt und deshalb ein geringes Gefolge von dienendem Personal. Wiebeke Kruse stieg mit jedem Tage höher in ihrer Gunst. Das Mädchen hatte sich wunderbar rasch in die neuen Verhältnisse zu schicken gewußt. Ihre kräftigen Glieder, ihr practischer Verstand, ihr entschlossener froher Sinn hatten sie sowohl für ihre Gebieterin, als für die königlichen Kinder zu einer unschätzbaren, unentbehrlichen Reisegefährtin gemacht, so daß die offenen Gunstbezeugungen, die dem jungen Mädchen zu Theil wurden, nicht verfehlten, die Eifersucht der alten Dorthe zu erregen. Frau Christine, welcher dies nicht entgangen war, hatte bei ihrer Ankunft im Hauptquartiere Hameln dem Ausbruch der üblen Laune ihrer alten Wärterin dadurch vorzubeugen versucht, daß sie bis zur Ankunft der neuen Hofmeisterin die Kinder undderen Magd unter ihre Aufsicht stellte, wodurch es ihr möglich ward, Wiebeke ganz für ihren Dienst zu verwenden. Was sie eigentlich aus dieser machen wollte, etwa ein Mittelding zwischen Staatsjungfer und Kammerzofe, war ihr selbst nicht klar. Eigentlichen Zofendienst konnte Wiebeke schon deshalb nicht verrichten, weil ihr die Geschicklichkeit dazu fehlte. Frau Christine ließ sie daher einstweilen in verschiedenen weiblichen Fertigkeiten unterrichten und behielt sie meistens in ihrer unmittelbaren Nähe, damit sie in ihrem äußeren Wesen den Schliff der vornehmen Welt sich anzueignen Gelegenheit habe. Diesem Treiben der vornehmen Frau lag mehr als bloße Caprice zu Grunde, nämlich der Wunsch, bei ihrer einstigen Rückkehr nach Dänemark eine treufeste nur ihr anhängende Person zur Seite zu haben, welche den Bestechungen und Ohrenbläsereien von gewisser Seite unzugänglich sei. Wiebeke selbst bekümmerte sich wenig um die Art ihrer Verwendung; sie half, wo sie Hülfe nöthig fand und wo sie helfen konnte. Wenn sie ihre Gebieterin zu den Festen schmücken durfte, welche während der langen Reise hier und dort die Edlen des Landes um die vornehme Frau versammelten, da hatte sie an den kostbaren Geschmeiden und den mit Perlen und blitzenden Steinen gestickten Prachtgewändern eine kindische Freude, und ihre Herrin erschien ihr so blendend schön wie eine Himmelskönigin. Wenn sie durch die Menge der prächtig geschmückten Frauen und stattlichen Ritter in den goldgestickten, eng anliegenden Sammetkleidern, den kurzen spanischen Mänteln und den mit wallenden Federn geschmückten Hüten einherging, da glaubte sie oft in der Zauberwelt der Märchen zu wandeln; aber sie fühlte sich nicht fremd in dieser Welt und wäre ohne Scheu am Arme eines dieser vornehmen Herren in die bunten Reihen getreten. Der plötzliche Uebergang aus der patriarchalisch idyllischen Heimath in die Hofsphäre ließ sie die Kluft, welche diese beiden Puncte der menschlichen Gesellschaft trennt, nicht erkennen. Wäre sie stufenweise zu der Höhe emporgestiegen, würde ihre tactfeste Sicherheit vielleicht einer befangenen, linkischen Schüchternheit gewichen sein. Die Vergangenheit erschien ihr wie ein Traum. Oft trat das Bild des Vaters vor ihre Seele und mahnte sie, die Lehren, die er ihr mit auf den Weg gegeben hatte, eingedenk zu sein. Wenn sie der Unterredung gedachte, welche er, der schlichte Mann, mit dem Könige um ihretwillen gehabt, bevor er sie ziehen ließ, da fühlte sie, wie die Wange heiß und das Auge feucht wurde. Könnte er mich nur einmal hier sehen, dann würde er schon zufrieden sein, sprach sie dann bei sich, ich habe ja Gott vor Augen und im Herzen und suche in allen Stücken brav zu sein und zu bleiben! Mit diesen und ähnlichen Gedanken beruhigte sie sich und gab sie den bestrickenden Eindrücken der wechselnden Gegenwart arglos hin.
————————
Es war am 20. Juli, als der König Nachmittags an Frau Christine’s Arm in dem hinter seiner Wohnung belegenen Garten lustwandelte und den Spielen der Kinder zusah, welche mit den Schmetterlingen, nach denen sie haschten, von Blume zu Blume eilten, wobei der kleine Waldemar nicht selten über die eigenen Füße fiel. Nur die sechsjährige Eleonore Christine betheiligte sich nicht an der Jagd. Sie stand abwärts vor einem Rosenstrauche und bemühte sich vergeblich eine aufgeblühte rothe Rose zubrechen. Das zarte Händchen bebte mehrmals vor den scharfen Dornen zurück, aber sie hob sich auf die äußersten Fußspitzen und streckte die Arme so hoch sie konnte, bis es ihr nach manchem mißlungenen Versuche gelang, die Rose zu pflücken. Die Eltern hatten ihrem Treiben lächelnd zugesehen; sie hatten bemerkt, wie der herabgebogene Zweig, als die Blume sich plötzlich von ihm trennte, heftig zurückschnellend, den kleinen Finger streifte, aus dem ein purpurrother Tropfen hervorquoll. Mit heißen Wangen kam die Kleine herbeigesprungen und legte, den verwundeten Finger bergend, die Rose in des Königs Hand.
„Warum gabst Du Dir so viele Mühe die schöne Blume zu pflücken? Du hast mir ja schon eine gebracht,“ sagte der König.
„Du gabst sie der Mama; diese sollst Du selbst behalten,“ erwiderte das Kind.
Der König hob sein Töchterchen empor, ergriff die widerstrebende Hand und küßte das blutende Fingerchen. „Schmerzt es?“ fragte er, die Kleine gerührt an sich drückend. Eleonore schüttelte lächelnd das blonde Köpfchen und legte darauf die Arme liebkosend um den Hals des Königs.
Armer Vater! Wenn ein Blick in die Zukunft ihm damals offenbart hätte, wie dieser Lieblingstochter dereinst als Ulfeldt’s unglücklicher Gattin das Herz verbluten würde, wie seine nächsten Nachkommen dies zarte, liebliche Geschöpf maßlosem Jammer Preis geben und diese strahlenden Augensterne einst thränenversiegt in den Höhlen brennen würden!
Aus einem Seitengange der Buchsbaumhecken kam der General Fuchs gegangen, der beim Anblicke der königlichen Familie ehrerbietig stehen blieb. Der König winkte ihm, näher zu treten.
„Was giebt’s, General?“ rief er huldreich. „Der Wolf wird sich, nachdem er die Schafe vertrieben, doch nicht von dem Hunde haben beißen lassen?“
„Davon ist mir zur Stunde nichts bekannt, Majestät“, antwortete der General, „und hoffe ich, daß die roth-weiße Fahne auf den Mauern Zum Stein festes Posto gefaßt hat. Ich komme nur, um Ew. Majestät zu bitten, falls Hochdieselbe heute noch einen Spazierritt machen sollte, den Weg nach dem Norderthore einzuschlagen, wo die aufgeworfene Erdmasse die Ringmauer geborsten hat. Man hat den Wall aufgegraben, um die Mauer, die aus der Linie geschoben wurde, wieder schnurrecht aufzumauern, doch scheint mir die Arbeit nicht rasch genug von Statten zu gehen. Ich darf dies zwar in Gegenwart des Generallieutenants nicht aussprechen, allein ich hoffe, daß Ew. Majestät meine Ansicht billigen und in Höchsteigener Person die Beschleunigung der Arbeit verlangen werde.“
Der König lächelte. Es war nicht das erste Mal, daß Johann Philip die Anordnungen des Markgrafen von Brandenburg nicht gutheißen konnte und, um daraus erwachsenden Schaden zu verhüten, an die Vermittelung des practischen, sachkundigen Königs appellirte.
„Du sollst uns auf diesem Spazierritt begleiten“, antwortete der König, „und wollen wir uns jetzt von Frau Kirstin beurlauben, bis wir uns heute Abend wieder zusammenfinden.“
„Ihr hört, General, daß in diesen Worten eine Einladung liegt, Euch heute Abend wieder von Sr. Majestät im Brettspiele schlagen zu lassen,“ scherzte Frau Christine, als die Herren sich verabschiedeten und sie mit den Kindern im Garten zurückließen.
———————–
Zwei bis drei Stunden waren seit des Königs Entfernung verflossen, die Kinder waren zur Ruhe gebracht und Frau Kirstin saß einsam im Garten, den träumerischen Blick gen Himmel gerichtet, wo leichte Wölkchen, von den Strahlen der untergehenden Sonne mit Rosentinten gefärbt, ruhig durch den klaren Aether schifften. Sie war kaum dem Kindesalter entwachsen, als sie sich dem Könige von Dänemark vermählte, dem sie mit kindlicher Verehrung anhing, und so lau und leidenschaftlos, wie ihr Gefühl für den Gemahl, war auch die Liebe zu ihren Kindern. Ihr Leben glich einem einzigen linden Sommertage, kein Sturm, kein Unwetter hatte ihre Kraft erprobt und gestählt. Die einzigen vorüberziehenden Wolken an ihrem Himmel waren zeitweilige Mißhelligkeiten zwischen ihrem, Gemahle und ihrer Mutter. Frau Ellen Marsvin war eine energische, kluge Frau, die ihre ansehnlichen Güter selbst verwaltete und oftmals mit ihrem königlichen Schwiegersohne in Geldgeschäften stand, bei deren Abwicklung sich allzu leicht kleine Differenzen aufwarfen, die Frau Ellen dann mit der vollen Heftigkeit ihres Charakters auszugleichen suchte. Christine nahm sich diese kleinen Zerwürfnisse indessen nicht sehr zu Herzen, sie faßte das Leben von der sorgenfreien Seite, in der es sich ihr bot. Zufrieden an der Seite eines Gemahls, der sie mit allen Gaben, die das Herz erfreuen, überschüttete, gab sie sich mit dem Frohsinn der Jugend den Festen hin, bei welchen sie als Königin erschien, und sog begierig den Weihrauch ein, der ihrer Schönheit und ihrem Range von allen Seiten gespendet ward. Vielleicht gedachte sie auch jetzt der Huldigungen, welche ihr neuerdings von deutschen Fürsten und Rittern gezollt waren, denn ein feines, fast schelmisches Lächeln schwebte auf ihren Lippen, als sie durch die Stimme der herbeieilenden Wiebeke aus ihren Träumereien aufgeschreckt ward.
„Es muß etwas Großes geschehen sein,“ rief diese athemlos. Es ist ein Rennen, eine Verwirrung im Hofe, die nichts Gutes bedeutet, und eben kommt der General Fuchs durchs Thor gesprengt, als sei er mit Noth dem nachsetzenden Feinde entronnen“.
Frau Christine hatte den Sinn dieser Worte noch kaum erfaßt, als schon der General über den Rasen daherkam.
„Ew. Gnaden wolle nicht zu sehr erschrecken, wenn ich mich zu der Mittheilung genöthigt sehe, daß Se. Majestät von einem Unfalle betroffen worden, der mit Gottes Hülfe keine üblen Folgen haben wird,“ sprach General Fuchs, seine Aufregung vergeblich bekämpfend. „Der König ist mit dem Pferde gestürzt, doch unversehrt geblieben, obgleich er die Besinnung verlor.“
„Wo ist er?“ stammelte Christine, bleich vor Schrecken und den Arm des Generals fassend, als wolle sie von ihm zu dem Könige hingeführt werden: „Erzählt wie es geschah! Sprecht!“ befahl sie mit ungewohnter Heftigkeit.
„Als Se. Majestät, von Wenzel und mir begleitet, fortritt, nahmen wir den Weg durch die Stadt, wo der König in allen Straßen mit lebhaften Acclamationen begrüßt ward. Außerhalb des Thores wurden wir durch die Besichtigung neu angelegter Erdarbeiten aufgehalten, bis wir den Wall hinanritten und uns der schadhaften Stelle in der Mauer langsam näherten. Man hatte den über 20 Fuß hohen Wall abgegraben und, um die Passage nicht zu hemmen, die Lücke mit starken Bohlen belegt, über welche ich heute Vormittag schon mehrmals hingeritten war. Auch der Markgraf, welcher uns vorauf ritt, passirte eben die Stelle. Er schien den mehrfach wiederholten Zuruf des Königs nicht zu hören, weshalb Se. Majestät das Pferd antrieb um den Grafen einzuholen. Sowie aber das Thier das donnerähnliche Getöse vernahm, welches es selbst mit seinen Hufen auf den hohl liegenden Bohlen verursachte, scheute es, bäumte sich, so daß durch das Stampfen und Getrampel die Balken sich verschoben und eine Oeffnung entstehen ließen, durch die Roß und Reiter hinabstürzten. Das Pferd war todt, der König durch wun derbare, gnädige Fügung des Himmels unbeschädigt, aber besinnungslos. Ich eilte, Se. Majestät unter Wenzel’s treu er Obhut zurücklassend, voraus, um Ew. Gnaden von dem Ereignisse in Kenntniß zu setzen, bevor man den König hierher bringt.“
Während der General den Vorgang erzählte, hatte e Frau Kirstin, die sich nur mit Mühe aufrecht zu halten vermochte und sich deshalb auf seinen Arm stützte, durch den Garten ins Haus geführt. Er wünschte sie vor der An kunft des traurigen Convoi in ihre Gemächer zu bringen als man mit der Bahre, auf welcher der scheinbar todte König ruhte, durch das Thor schritt.
Christine Munk riß sich los von ihrem Begleiter und stürzte an der Bahre, die man bei ihrem Anblicke wie auf Commando niedersetzte, auf die Knie. Heiße Thrä nen flossen auf das bleiche Gesicht das mit geschlossenen Lidern dem Tode anheimgefallen schien.
„Tragt ihn hinauf in mein eigen Schlafgemach!“ befahl sie, als der Markgraf sanft die Hand auf ihre Schulte legte und sie bat, den Kranken weiterbringen zu lassen.
Wiebeke Kruse, welche diesen Befehl hörte, eilte vor aus und bereitete das Lager, auf das man den leblosen König bettete, worauf die Aerzte aufs neue Wiederbe lebungsversuche vorzunehmen begannen.
In der Stadt, wie im Lager herrschte die größte Bestürzung. Man fürchtete allgemein, daß der Feind, der dies Unglück bald genug erfahren mußte, dasselbe zu einem Ueberfalle benutzen werde, wobei die persönliche Sicherheit des Königs leicht gefährdet werden konnte.
Kaum waren die Oberbefehlshaber des Heeres in dem Zelte des Generallieutenants zusammengetreten, um über die zu ergreifenden Maßregeln zu berathen, als, wie durch ein unseliges Verhängniß herbeigeführt, ein von Tilly gesandter Trompeter im Lager erschien, mit einem Sohreiben des Generals, in welchem dieser das frühere Begehren, die Kriegsrüstungen einzustellen, wiederholte, dahingegen versicherte, daß er bisher nur nach dem Willen des Kaisers gehandelt habe und nichts wider den Religions- und Landesfrieden zu unternehmen gesonnen sei. In der herrschenden Verwirrung war es nicht möglich, dem Trompeter die verlangte Antwort zu geben. Man begnügte sich, denselben bei Tagesanbruch mit einem Geldgeschenke und mit einem von dem Generallieutenant unterzeichneten Scheine zu entlassen, welcher besagte, daß er das ihm anvertraute Schreiben in die rechten Hände abgeliefert habe. – Mit dem interimistischen Oberbefehl betraute man den Markgrafen von Brandenburg, und wiewohl die Officiere es nicht auszusprechen wagten, waren sie doch sämmtlich froh, daß die Mecklenburger Herren, welche, als dem Kreisobersten beigeordnet, einen höheren Rang bekleideten und deshalb nicht hätten übergangen werden dürfen, am Vormittage gleich nach der oben beschriebenen Sitzung beim Könige abgereist waren.
——————-
Dreimal hatte die Sonne die Nebel der kurzen Sommernacht verscheucht und neue Hoffnung in den bekümmerten Herzen geweckt, ohne daß in dem Zustande des Königs eine Veränderung eingetreten wäre. Seine Augen waren geschlossen, ein schwacher Athem hob die Brust und kein Zeichen verrieth, daß er höre, was um ihn vorging. Frau Kirstin hatte das Lager ihres Gemahls keinen Augenblick verlassen und auch Wiebeke hatte treu mit ihrer Gebieterin gewacht und nebenher für deren Pflege liebevoll gesorgt. In dem Nebenzimmer lösten sich die Aerzte und Hofherren im Dienste ab, und alles flüsterte und trat so leise auf, als hielte man Wache bei einem Todten.
Als Wiebeke am dritten Morgen im Auftrage Frau Christine’s hinunter in den Garten ging und aus der Halle in den Hof trat, hörte sie neben sich den Schrei einer Eule. Wohl wissend, daß dies Thier sich nicht bei lichtem Sonnenschein hören lasse, schaute sie verwundert um sich, als ihr Auge zufällig auf die am Thore postirte Schildwache fiel, einen jungen Burschen mit gelbem Zigeunergesichte, über das eben ein schlaues Lächeln glitt. So wenig furchtsam sie im Grunde war, so beschleunigte sie doch ihre Schritte und sah weder rechts noch links, als sie über den thaufeuchten Rasen nach dem Erdwalle schritt, wo sie eine Erfrischung für ihre Herrin zu finden hoffte. Das mitgebrachte Körbchen war bald gefüllt, und sie erhob sich, um rasch ins Haus zurückzukehren, als sie durch das Hollundergebüsch ein schwarzes Augenpaar gewahrte und gleich darauf ein fremdes Weib, welches ihr den Weg vertrat. Sie erkannte dieselbe Zigeunerin, die ihr schon einmal begegnet war, obschon die Jahre sie gealtert hatten.
„Daß Du hier seiest, wußte ich lange,“ begann die Fremde und ihre Stimme klang so sanft und voll, wie das erste Mal. „Ich habe Dich auf der Reise und hier mehrmals gesehen und sah auch, daß es Dir gut ging. Seit Mittwoch warte ich hier auf eine Gelegenheit, Dich zu sprechen, weil Du dem Könige einen Dienst leisten sollst. Ich bin zwar keine Freundin der gekrönten Herren, aber der Dänenkönig ist ein ganzer Mann und ein freundlicher, menschenliebender obendrein. Ich bin ihm gut, weil er einmal, als er in Norwegen reiste, meinen Vater von einer schimpflichen Strafe errettet hat. Hier hast Du ein Päckchen Kräuter und zwei Steine, deren innere Seiten mit fremdartigen Buchstaben bezeichnet sind. Zwischen diesen Steinen sollst Du Blätter und Stengel quetschen und sie mit ihrem Safte auf die Pulsadern am Handgelenke und auf die Magengrube des Kranken legen; die Steine aber schiebst Du ihm unter den Nacken. Das wird besseren Erfolg haben, als die nichtsnutzen Mittel der studirten Herren.“
„Werden sie aber dulden, daß ich nach Eurer Anweisung handle?“ fragte Wiebeke zaghaft.
„Bah, am Mittwoch würden sie Dich vielleicht fortgejagt haben, aber nachdem sie drei Tage lang vergeblich ihre Köpfe in die Weiche gelegt, werden sie schon fügsamer sein,“ lachte die Fremde. Nach einer kurzen Pause ergriff sie Wiebeke’s Hand und sprach, sie mit fast mütterlichem Wohlgefallen betrachtend:
„Gelt, daß wir uns hier wiedersehen würden, dachten wir nicht. Aber dies ist nur der erste Schritt, und bevor Deine Lebenssonne aufgeht, muß erst ein Unwetter über Dich einbrechen. Die Linien in Deiner Hand liegen so klar, daß kein Irrthum möglich ist. Aber Kind, beherzige meinen Rath: Rede immer die Wahrheit; biete nie die Hand zu unredlichem Thun und sei treu, wo Du Treue schuldig bist. Wiederhole diese Worte, damit ich höre, daß Du sie verstanden.“
So sehr die Fremde ihr imponirte, gehorchte Wiebeke diesem Befehle doch widerstrebend und warf stolz den Kopf zurück, als sie sprach:
„Ich rede immer die Wahrheit; ich biete niemals die Hand zu unrechtem Thun und bin treu, wo ich Treue schuldig bin.“
Die Fremde lächelte und wollte eben noch einmal prüfend in die Hand des jungen Mädchen blicken, als sich wiederum der Eulenschrei hören ließ, und ehe Wiebeke sich dessen versah, war sie verschwunden.
Nicht ohne Verlegenheit begab sich Wiebeke in das Krankenzimmer und erzählte ihrer Gebieterin, was ihr begegnet sei, wobei sie jedoch verschwieg, daß sie das Zigeunerweib schon früher gesehen habe.
Frau Christine wagte nicht, das geheimnißvolle Heilmittel anzuwenden, weil sie in der Fremden ein Werkzeug des Feindes sah und die Kräuter für giftig hielt. Als aber der mit den Aerzten anwesende Pharmaceut betheuerte, daß es durchaus unschädliche Pflanzen seien, und zum Beweise dafür selbst ein Blättchen davon verschluckte, da erlaubte sie, daß man dieselben nach Wiebeke’s Anweisung anwende.
Sei es nun, daß die von den Aerzten angewandten Mittel erst jetzt zur Wirkung kamen, daß die kräftige Natur von selbst zu neuem Leben erwachte oder daß wirklich der frische, kühlende Kräuterumschlag wohltätig wirkte, – wahr ist, daß nach einem Viertelstündchen die Lippen des Königs sich färbten, die Finger sich bewegten und daß er endlich das Auge aufschlug und durch Zeichen zu verstehen gab, daß er höre, was man spreche.
Die Freude, der Jubel in den Räumen, wo eben noch die Sorge mit bleischwerer Hand die Herzen gedrückt hatte, läßt sich nicht beschreiben. Ehe noch der Markgraf mit den übrigen Herren auf die frohe Kur de herbeigeeilt war, hatte der König die Sprache wiedergewonnen, und die Aerzte erklärten die Lebensgefahr für gewichen, obwohl bei der großen Mattigkeit des hohen Kranken die äußerste Ruhe und Vorsicht nothwendig seien.
Man hatte auf diese Crisis in dem Zustande des Königs gewartet, um Tilly den nöthigen Bescheid zu senden. Sigward Pogwisch und Marquard Penz ritten deshalb unverzüglich ins feindliche Lager, um die verspätete Antwort mit der Bestürzung über den Unfall des Königs zu entschuldigen. Sie erklärten, daß der König von Dänemark und der niedersächsische Kreis keineswegs zu den Waffen gegriffen hätten, um Krieg zu führen, sondern lediglich um sich vor ferneren Drangsalen, wie die bereits erlittenen, zu schützen und den Religions- und Landesfrieden zu schirmen. Sie erboten sich im Namen des Königs die Vorschläge anzunehmen, welche Tilly zur Befreiung und zur Sicherheit des Kreises stellen werde, und dasselbe Anerbieten ward im Namen des niedersächsischen Kreises in einem Schreiben wiederholt, welches der Markgraf als fungirender Kreisoberst den beiden Rittern mitgegeben hatte.
Graf Tilly empfing die Herren mit ausgezeichneter Artigkeit. Er drückte unverhohlen seine Bewunderung für den König von Dänemark aus, dessen vorzügliche Eigenschaften er nicht genug rühmen konnte, und erkundigte sich mit vieler Theilnahme nach den näheren Umständen des traurigen Ereignisses. Als man aber danach die obwaltende Frage berührte, spannte er andere Saiten auf und behauptete nochmals, seinerseits nur nach kaiserlichem Befehle gehandelt zu haben, wohingegen die Kriegsrüstungen des niedersächsischen Kreises dem Reichsgesetze und dem schuldigen Gehorsam gegen den Kaiser zuwiderliefen, weshalb er keinen Fußbreit weiche, bevor nicht der Kreis seine Truppen beurlaube, andernfalls aber das Glück der Waffen entscheiden lassen wolle. Mit noch schärferen Ausdrücken beantwortete der kaiserliche Obergeneral das Schreiben der Kreisstände, indem er ihr Verfahren so strafwürdig nannte, daß er sie lediglich der Gnade des Kaisers überantworten könne.
Als die beiden Ritter mit diesem Bescheid ins Hauptquartier zurückkamen, fanden sie dort den Herzog Ulrich von Braunschweig, welcher auf die Nachricht von dem Unglücksfalle gleich nach Hameln geeilt war, um sich in eigener Person nach dem Zustande des Königs zu erkundigen. Mit der Antwort an Tilly erklärte er sich einverstanden, doch hielt er es für nothwendig, durch eine Retirade die Person des Königs, wie auch das Heer sicherer zu stellen, als sie es bei obwaltenden Umständen und mit Bezug auf Tilly’s Antwort hinfort in Hameln waren. Es wurden daher in aller Stille schleunige Vorbereitungen zur Abreise getroffen, und schon am 25. Juli ward der noch bettlägerige König mit aller ersinnlichen Behutsamkeit und Vorsicht spät Abends von Hameln nach Rinteln gebracht.
Bevor man Hameln verließ, ja gleich nachdem der König wieder zum Leben erwacht war, hatte Frau Kirstin Boten ausgesandt, um die Spur der Zigeunerin aufzufinden; allein niemand wollte eine solche gesehen haben, und auch die Schildwache, welche Wiebeke so verdächtig vorgekommen war, schien verschwunden, und niemand konnte Auskunft über den braunen Burschen geben, der offenbar mit der Fremden im Einverständniß gestanden hatte.
Von Rinteln ward der König über Petershagen und Hoya nach Verden geführt, welchen letztgenannten Ort er am 28. Juli erreichte, und erst, nachdem er diese Reise ohne schädliche Folgen überstanden, erklärten die Aerzte, für seine Wiedergenesung bürgen zu können. Nicht wenig trug zu derselben die unerwartete Ankunft des Kronprinzen bei, welcher, nachdem er die Unglückspost aus Hameln durch einen Courier empfangen hatte, noch in derselben Stunde von Kopenhagen abgereist war. Der König fand sich durch dies Liebeszeichen seines Sohnes so angenehm überrascht, daß er sich von Stunde an sichtlich erholte und schon am 7. August zuerst wieder selbst die Losung ausgab. Als er sich den Soldaten zeigte, ward er, besonders von seinen Landestruppen, mit so maßlosem Jubel empfangen, daß ihm helle Thränen in die Augen traten.
Auch in seiner Familie herrschte wieder die Freude, die nur bei Frau Christine dadurch getrübt ward, daß ihre Mutter wiederum die Ungnade des Königs auf sich gezogen hatte, und zwar in so ernster Weise, daß sie keine andere Hülfe zur Beseitigung des Zwistes sah, als daß sie selbst persönlich mit Frau Ellen unterhandle. Als sie deshalb schüchtern dem Könige die Bitte vortrug, den Kronprinzen nach Kopenhagen begleiten zu dürfen, sah dieser in ihrem Begehren nur eine verhehlte Sehnsucht nach den in Kopenhagen zurückgebliebenen jüngsten Kindern und willigte gerührt ein, daß sie die Hinreise im Schutze des Prinzen Christian mache und in Begleitung der neuen Hofmeisterin zurückkomme.
Diese Reise ward am 25. August angetreten. Da Wiebeke der dänischen Sprache unkundig war, begleitete die alte Dorthe ihre Herrin wieder als Kammerfrau, während Elsabe v. Dieden, eine Deutsche von Adel, den königlichen Kindern als Ehrenfräulein beigesellt ward, mit welcher Wiebeke die Aufsicht über Kinder und Wärterinnen theilte.
VI.
Der König hatte schon während der Anwesenheit des Kronprinzen den Oberbefehl wieder in seine Hände genommen, weil Tilly aus dem Rückzuge der Unionsarmee möglichst großen Vortheil zu ziehen suchte. Letzterer hatte sofort Hameln und Minden besetzt und das befestigte Stolzenau genommen und belagerte darauf Nienburg, wo die dänische Besatzung sich tapfer hielt, bis ihr von dem Herzoge von Weimar Verstärkung zugeführt wurde. Christian IV. war zunächst darauf bedacht, Tilly aus dieser Position zu vertreiben. Er ließ Hoya nehmen, entsetzte Nienburg und machte einen Versuch Stolzenau zu überrumpeln, welches jedoch erst im Spätherbst wieder in die Hände der Dänen fiel. Obwohl der könig diese Unternehmungen gern in eigener Person ausführte, sah man ihn doch oft im Hauptquartiere, wo ihm Gesandtschaften der niedersächsischen Höfe und der englischen, französischen und holländischen Regierung aufwarteten.
Wenn er in Verden erschien, war sein erster Weg in die Kinderstube, wo er meistens unerwartet eintrat und sich von allen Einzelheiten in Betreff der Pflege der Kleinen Rechenschaft geben ließ. Von diesen Kindern war Anna Catharina – welche schon in zarter Jugendblüthe, und zwar aus Gram über den Tod ihres Verlobten Franz Rantzow starb – damals 8 Jahre alt. Sophia Elisabeth, die sich später mit einem Penz vermählte, zählte 7, und Eleonore, die nachmalige Gemahlin Ulfeldt’s, 5 Jahre.
Die Kleinen hatten sich über die Abreise der Mutter bald getröstet. Elsabe v. Dieden war gut und nachsichtig mit ihnen und Wiebeke zeigte nie das grämliche Gesicht, welches sie bei der alten Dorthe so sehr fürchteten. Sie hatten die Bauerntochter herzlich lieb, weil sie immer neue Kurzweil zu ersinnen wußte und niemals ermüdete für ihre Unterhaltung zu sorgen. Bald flocht sie ihnen Körbe aus Binsen und Weidenzweigen, die mit Obst oder Backwerk gefüllt wurden, bald wußte sie aus geschälten Binsen zierliche, weiße Kronen zu biegen, die sogar Elsabe v. Dieden als Zimmerschmuck werth hielt, oder sie schnitt Peitschen und Weidenpfeifen für den kleinen Waldemar. Den größten Reiz für die Kinder hatten jedoch die vielen schönen Geschichten, die Wiebeke zu erzählen wußte und die zu hören sie niemals müde wurden.
Am 20. Septbr. kam König Christian von Nienburg zurück, wo die Befreiung der Stadt mit einem Te deum gefeiert worden war. Er beabsichtigte das Hauptquartier dahin zu verlegen, und kam nach Verden, um die Uebersiedelung ins Werk zu setzen.
Als er seiner Gewohnheit nach die Schritte nach der Kinderstube lenkte, vernahm er drinnen lauten Wortwechsel, worin er besonders Anna Catharina’s klangvolle Stimme unterschied.
„Ich lasse mir von niemandem etwas verbieten, als von meiner Mutter“, rief sie heftig, „und Mutter hat gesagt, daß Ihr an mir ein Beispiel nehmen sollt.“
„Dann darfst Du aber auch nicht thun, was Mama verboten hat. Du weißt recht gut, daß wir nach dem Abendbrod nicht mehr hinausgehen dürfen“, wandte Sophia Elisabeth ein.
„Du darfst mich aber nicht hofmeistern! Wiebeke sage Du ihr doch einmal, daß sich das nicht schickt und daß die jüngeren Geschwister sich nach den älteren richten sollen“.
Der König war lauschend an der Thür stehen geblieben, neugierig, wie die Magd den Streit zwischen seinen Töchtern schlichten werde.
„Gewiß sollen die jüngeren Geschwister sich nach den älteren richten, aber dann müssen diese auch stets der Wünsche und Befehle der Eltern eingedenk sein,“ sprach Wiebeke freundlich. „Aber warum wolltet Ihr denn jetzt hinunter in den Garten? Es ist naß im Grase und der Wind weht kalt. Wir können uns hier viel besser vergnügen, bis Jungfer Elsabe heimkommt. Ich weiß eine ganz neue Geschichte; soll ich sie erzählen?“
„Ja, ja!“ riefen einstimmig die Kleinen und umringten die Jungfer so stürmisch, daß sie den Eintritt des Königs nicht bemerkten, bis dieser rief: „Was treiben denn die Kinder und lärmen, wie in einer Bauernschenke?“
Als die Kleinen die wohlbekannte Stimme vernahmen, waren sie keineswegs erschrocken. Mit lautem Jubel stürzten sie zu dem Vater hin, umfaßten seine Knie, ergriffen seine Hände, und jedes wollte zuerst von ihm geliebkost sein.
„Was triebt Ihr denn aber als ich hereintrat?“ wiederholte der König seine Frage.
„Wiebeke wollte gerade eine Geschichte erzählen,“ sagte Eleonore rasch, als fürchtete sie, der Streit der Schwestern möchte noch einmal beginnen. „Wiebe weiß so schöne Geschichten. Bleibt hier und hört mit zu!“ bat sie schmeichelnd und den Vater mit den klaren Kinderaugen flehend anblickend.
„Nun denn, ein Stündchen darf ich Euch wohl schenken,“ antwortete der leicht gerührte Vater. „Laß mich denn eine Deiner hübschen Geschichten hören, Wiebe.“
Er setzte sich nieder, nahm die beiden jüngsten Töchter aufs Knie und schlang den Arm um die sich an ihn schmiegende Anna Catharina. Wiebeke nahm ihnen gegenüber auf einem Schemel Platz. Für den König mußte sie etwas besonderes aus ihrem Gedächtnißschatze hervorholen. Nach kurzem Bedenken begann sie, nicht ohne Verlegenheit:
„Es war einmal ein holsteinischer Graf, der hieß Johann der Einäugige. Er hatte vier Söhne und eine Tochter, die er so lieb hielt, daß er schon bei Lebzeiten all sein Gut unter sie vertheilte. Für diese Liebe ward ihm jedoch schlechter Dank. Sein Gut war nicht so ansehnlich, daß seine Söhne davon standesgemäß leben konnten, weshalb sie ihre Untergebenen durch harte Erpressungen quälten. Diese warfen ihren Haß auf den alten Grafen, welcher sie in so schwere Drangsal gebracht hatte, und als sie einst durch neue Gewaltthätigkeiten seiner Söhne empört waren, überfielen sie Graf Johann, als derselbe seiner Gewohnheit nach sinnend unter den großen Bäumen in seinem Schloßgarten zu Bramstedt saß, und schleppten ihn gefesselt nach Kiel. Alle vier jungen Grafen starben früh und zum Theil gewaltsamen Todes. Graf Adolph wurde im Segeberger Schlosse von Hartwig Reventlow erstochen…“
„Warum das?“ fragte der König, um zu hören, welche der beiden Versionen dieser bekannten Geschichte sich vorzugsweise im Volksmunde erhalten habe.
„Der v. Reventlow soll kein eigentlicher Uebelthäter gewesen sein,“ berichtete Wiebeke. „Man sagt Graf Gert habe ihn zu der Unthat verleitet, weil er das Gut dieser Grafen für sich gewinnen wollte. Deshalb giebt man ihm auch die Schuld an dem Tode des zweiten Grafen, welcher in Kiel von einem neben ihm stehenden Junker aus dem offenen Fenster gestoßen wurde, so daß man ihn todt unten im Burggraben liegen fand. Niclas von Oldesloe und Johann von Bramstedt starben auch früh, und niemand hatte Mitleid mit dem seiner Kinder und seiner Güter beraubten alten Grafen, während Graf Gert immer mehr Freunde gewann. Nur seine Tochter, die mit einem Grafen von Wittenberg vermählt war, härmte sich um den Vater und um die Brüder, besonders um Herrn Adolph,den sie sehr lieb gehalten hatte und dessen Tod von keinem gerächt war. Zu dieser Pflicht erzog sie ihr Söhnlein, und als der junge Günzel alt genug war, um selbst ein Heer gegen den Feind zu führen, da fertigte sie Sendboten nach Holstein ab, welche auskundschaften sollten, ob sie auf die Hülfe gleichgesinnter Ritter und Edlen zählen könne.
Um diese Zeit besuchte Graf Henneken den Grafen Johann in Kiel. Er fand den Alten im Anschauen eines Käfigs versunken, in dem zwei junge Spatzen saßen, die von den Alten, die durch das offene Fenster ein- und ausflogen, gefüttert wurden. „Was treibt Ihr denn da, Herr Vetter?“ fragte Henneken. „Ich lasse mir von den Spatzen erzählen, wie thöricht ich gewesen bin,“ antwortete Johann. „Diese jungen Dinger habe ich selbst aus dem Neste genommen und sehe nun täglich, wie die Alten kommen und sie füttern. Hätte ich statt der Jungen die Alten gefangen, glaubt Ihr die Jungen hätten sich darum gekümmert ob die Alten zu fressen haben oder nicht?“ – Henneken verstand, daß der alte Graf dabei an sich selbst dachte, weil seine Kinder, nachdem sie ihr Erbtheil bekommen, nicht für den Unterhalt des Vaters gesorgt hatten. Das Schicksal des Alten ging ihm zu Herzen, und als bald nach seiner Heimkunft die Boten der Wittenbergerin vor ihm erschienen, da gelobte er ihr Unternehmen zu fördern. Auch Graf Adolph der Jüngere versprach, mit einem Trupp Dithmarscher zur Hülfe zu kommen. Bald darauf brach Günzel bei Hamburg ins Holsteinische ein; doch fiel der erste Zusammenstoß mit dem Feinde so unglücklich für ihn aus, daß die Seinen geschlagen und zerstreut und er selbst gefangen nach Segeberg geführt wurde. Graf Gert brachte aus Hademarschen, Nortorf, Schenefeld, Kellinghusen und Kaltenkirchen eiligst ein Heer zusammen und setzte sich bei Bramstedt fee. Da stieß er mit Adolph zusammen, welcher die Ankunft der Dithmarscher nicht abwarten mochte und kampfbegierig mit einer kleinen Schar auserlesener Streiter auf den viel stärkeren Feind eindrang. Da floß viel Blut; aber so tapfer Adolph mit den Seinen stritt, mußte er doch der Uebermacht weichen. Was nicht um kam, suchte sein Heil in der Flucht. Er selbst hoffte, Bramstedt zu erreichen, mußte aber, vom Feinde verfolgt, dicht vor dem Flecken unter einer Brücke Zuflucht suchen, wo er sich unter den dort wachsenden Seeblättern wohl verbarg. Schon hörte er die Feinde über die Brücke reiten und wäre gerettet gewesen, hätte nicht sein Jagdhund, der winselnd umherrannte, seine Fährte gefunden. Dies bemerkte ein Ritter aus Graf Gert’s Gefolge. „Mir nach, Freunde, ich jage Hochwild!“ rief er und folgte der Spur des Thieres, welches eben seine Freude über den wiedergefundenen Herrn laut werden ließ, als die Feinde das Versteck erreichten, Graf Adolph gefangen nahmen und ihn zu Günzel nach Segeberg brachten. Die Dithmarscher kamen freilich am anderen Tage und schlugen Graf Gert in die Flucht, aber das nützte dem alten Grafen Johann nichts. Er starb bald darauf in Armuth und Gram.
„Der arme, alte Herr“, rief Anna Catharina, welche die Erzählung mit Verständniß angehört hatte. „Warum hieß er denn der Einäugige? Hatte er nur ein Auge?“
„Er hatte das andere durch einen unglücklichen Zufall verloren. Als er einstmals am Weihnachtfeste mit seinen Hof leuten im Kieler Schlosse zu Tische saß und der Wein die Zunge zu lösen begann, wie man wohl sagt, da trieben die Junker viel Kurzweil untereinander. Hauptsächlich hatten sie es auf den Narren abgesehen. Als aber ihre Späße zu derbe wurden, ward dieser zornig und ergriff einen Knochen um ihn einem der Junker an den Kopf zu schleudern. Er zielte ungeschickt, der Knochen flog dem alten Grafen gerade ins Auge und das Auge lief aus. Daher heißt er der Einäugige.“
„Von wem hast Du diese Geschichte gehört, Mädchen?“ fragte der König, als Wiebeke schwieg.
„Ich hörte sie von dem Pfarrer in Bramstedt, welcher sie bei Jörgen Götsche auf der Kindtaufe erzählte.“
„Den Pfarrer zu Bramstedt müssen wir in gnädigem Andenken behalten,“ sprach König Christian halblaut für sich. „Die Herren Pastoren sollten sich ein Beispiel an ihm nehmen, und wenn sie mit den Landleuten verkehren, lieber derartige hübsche Sagen aus der Landesgeschichte erzählen, als daß sie müßiges Dorfgeklatsch anhören oder über Dinge mit ihnen verhandeln, die sie doch nicht verstehen.“
„Jetzt erzähle noch einmal von der alten Frau, die im Kornfelde sitzt und die Kinder holt, welche beim Blumenpflücken das Korn niedertreten,“ bat Eleonore, die an der vorigen Geschichte wenig Gefallen gehabt hatte.
Wiebeke tröstete sie auf ein anderes Mal, als Anna Catharina, die, ein Geräusch von der Straße herauf vernehmend, ans Fenster geeilt war, rief: „Ein Reisewagen! Kommt doch schnell! – Das ist die Mama, die zum Fenster herausguckt, und noch eine Dame!“
„Das ist die Großmama!“ rief Sophia Elisabeth.
Da waren alle Geschichten vergessen. Es war wirklich Frau Christine Munk, die mit ihrer Mutter und Frau Anna Lykke um einige Tage früher ankam, als sie erwartet war.
VII.
Trotz der häufigen Scharmützel, welche zwischen den liguistischen und niedersächsischen Truppen zu Ende des Jahres 1625 und zu Anfang 1626 vorfielen, ließ man von Seiten der Union doch nicht ab, an der Wiederherstellung des Friedens zu arbeiten. Alle billigen Forderungen wurden jedoch von den kaiserlichen Generälen verworfen, das Schwert sollte das Loos der bedrängten Protestanten entscheiden. Diese schöpften neuen Muth aus einem zu Haag geschlossenen Bündnisse, laut welchem der König von Dänemark den Krieg energisch fortführen sollte, unterstützt von den niedersächsischen Fürsten, von denen keiner einen Separatfrieden mit dem Kaiser schließen oder sich seiner Bundespflichten entziehen durfte. England und Holland verpflichteten sich zu einer monatlichen Beisteuer an Geld zur Deckung der Kriegskosten, und die übrigen europäischen Staaten sollten eingeladen werden, diesem Bunde beizutreten.
Diese glänzenden Versprechungen blieben leider unerfüllt. In England, wo nach König Jacob’s Tode Carl I. den Thron bestiegen hatte, waren die Verhältnisse so unglücklich, daß von dort her keine Hülfe zu hoffen war. Die niedersächsischen Fürsten waren lau und wankelmüthig, und bald vernahm König Christian, daß Georg von Lüneburg im Geheimen werbe, um sich den Kaiserlichen anzuschließen. Graf Mansfeld war von Wallenstein geschlagen. Christian von Braunschweig erlag einem hitzigen Fieber. Dieser tapfere, junge Mann, welcher dem ünglücklichen böhmischen Königspaare sein Leben geweiht hatte, war in seiner Kindheit mit dem dänischen Prinzen zusammen erzogen worden und Christian IV. betrauerte ihn wie einen Sohn.
Die Dänen hatten sich bis ins brandenburgische und westphälische Gebiet ausgebreitet, aber dadurch ihre Hauptmacht so sehr geschwächt, daß sie eine entscheidende Schlacht, die Tilly offenbar herbeiführen wollte, zu vermeiden suchten. Christian IV. hatte sein Hauptquartier von Rothenburg nach Wolfenbüttel verlegt. Im August suchte er durch das Eichsfeld und Thüringen einen neuen Weg in die liguistischen Länder, als Tilly Kunde von seinen Plänen erhielt und ihm durch Eilmärsche den Vorsprung abgewann. König Christian zog sich, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, ins Braunschweigische zurück; aber Tilly, der inzwischen durch einige Wallenstein‘ sche Regimenter verstärkt war, verfolgte ihn unablässig, bis es nach mehrtägigen Scharmützeln bei Lutter am Baremberge zur Schlacht kam. Die Dänen kämpften mit großer Tapferkeit, und besonders wissen Freund und Feind nicht genug den Muth des Königs zu rühmen, welcher die Seinen dreimal in dem Kampf führte und stets da gesehen wurde, wo es am heißesten herging. Obgleich die Königlichen durch ihre Stellung gegen Sonne und Wind und durch die Bodenbeschaffenheit im Nachtheil waren, schien sich der Sieg doch anfangs auf ihre Seite zu neigen; doch geriethen sie bald durch das Zusammenwirken verschiedener Mißgeschicke in Noth. Die Regimenter Hessen und Solms blieben in einem Moraste; ein anderes geriet in der Hitze des Gefechtes unter die eigenen Kanonen; am schlimmsten wirkte die Treulosigkeit der ausländischen Reiterei, welche, schon lange mißvergnügt, jetzt das Feld räumte und dadurch das Fußvolk blosstellte, welches durch einen Hinterhalt des Herzogs von Lüneburg im Rücken angegriffen, total vernichtet ward. Der Kampf dauerte von 8 Uhr Morgens bis 5 Uhr Nachmittags. Die Walstatt war mit Todten bedeckt; was nicht von dem kaiserlichen Heere niedergehauen war, suchte sich durch die Flucht zu retten. Das Geschütz und ansehnliche Vorräthe von Proviant und Munition fielen in die Hände des Feindes. König Christian, der sich bis zum letzten Augenblicke hielt, mußte sich mit einer kleinen Schar durch einen Trupp feindlicher Reiter durchhauen und erreichte glücklich das Hauptquartier, wohin wir ihm einstweilen vorauseilen wollen.
Wir verließen Frau Christine Munk als sie, mit ihrer Mutter von Kopenhagen in Verden angekommen, sich anschickte, ihrem königlichen Gemahle nach Nienburg zu folgen. König Christian, welcher sich mit Frau Ellen ausgesöhnt hatte, gab ihr zu Ehren glänzende Feste, bei denen die deutschen Edelfrauen an Schönheit und kostbaren Gewändern mit den dänischen wetteiferten, und FrauEllen gefiel sich inmitten des wechselvollen Lebens und des kriegerischen Treibens im Hauptquartiere so gut, daß sie erst, als dasselbe im Monate December nach Rothenburg verlegt wurde, ihre Rückreise nach Dänemark antrat.
Von Rothenburg war die königliche Familie nach Wolfenbüttel übergesiedelt, wo Frau Christine während der Abwesenheit des Königs ihre Tage in einförmiger Stille verlebte. Einen Ersatz fand sie in der Gesellschaft der dänischen Hofmeisterin, einer munteren, lebhaften Frau, die mit geistvollem, heiterem Geplauder die Stunden kürzte und bald einen bedeutenden, aber leider nicht wohltätigen Einfluß auf die hohe Frau zu üben begann. Nur in Betreff Wiebeke’s vermochte sie nichts über Frau Kirstin, und alle ihre Ränke, wie die Bemühungen der alten Dorthe, die junge Holsteinerin in der Gunst der Gebieterin herabzusetzen, scheiterten an dem offenen, treu festen Wesen der neuen Hofjungfer. Es gab Stunden, wo Christine Munk ein leises Mißtrauen gegen ihre Landsmänninnen empfand, wo sie sich in ihrer Einsamkeit nur bei Wiebeke sicher fühlte, wo ihr mütterlicher Instinct gleichsam errieth, daß die Kinder unter Frau Anna Lykke’s Händen nicht wohl aufgehoben seien; doch tadelte sie sich stets über diese inneren Regungen und zeigte sich nach einer Anwandlung solchen Mißtrauens nur desto freundlicher gegen die Hofmeisterin.
Zu Ende des Augustmonats saßen beide Damen einst plaudernd beisammen. Frau Kirstins Augen ruhten sinnend auf einem Strauße von wildem Mohn, dessen klare schöne Tinten sie vergeblich auf dem Papier wiederzugeben suchte. Sie mischte die Farben, schüttelte mißbilligend den Kopf, versuchte aufs neue, retouchirte die Blätter und horchte dabei auf Anna Lykke, welche ihreinige Schriften vorlas, die ihr von dem Kronprinzen Christian gesandt worden und voll Lobes über den heldenmüthigen Kreisobersten waren.
„Wie glücklich seid Ihr, gnädige Frau, einen so allbeliebten und berühmten Gemahl zu besitzen,“ sprach AnnaLykke , nachdem sie ihre Lectüre beendet und eine Weil ein Schweigen verharrt hatte. „Wohin Se. Majestät sich wendet, geht der Ruhm seiner vorzüglichen Eigenschaften vor ihm her, und wo er erscheint, trägt die einnehmende Persönlichkeit dazu bei, das herrlichste Lob neu zu begründen und zu befestigen.“
„Du hast Recht, Anna, Christian IV. wird immerdar ein berühmter Sproß des Oldenburger Stammes bleiben,“ erwiderte Frau Christine. „Er ist aber nicht erst groß und berühmt als Mann geworden, schon als Kind setzte er die Reichsräthe durch seine verständigen Aussprüche in Staunen, und sein Fleiß, seine vielseitige Thätigkeit, seine Gerechtigkeitsliebe und sein menschenfreudiges Herz berechtigten früh zu den schönsten Hoffnungen. Hast Du niemals die Sage gehört, daß ihm als Kind, wenn er reine Wäsche anlegte, Funken aus den Haaren flogen? Ich habe dies aus dem Munde Ihrer Majestät der Königin-Mutter, welche dies nicht glauben wollte, bis sie sich eines Tages selbst davon überzeugte und darin ein Vorzeichen der künftigen Größe ihres Sohnes erblickte.“
„Schade, daß Se. Majestät nicht jünger an Jahren ist, damit Ew. Gnaden ihm mit der inbrünstigen, heißen Liebe anhängen könne, die das Frauenherz so sehr beglückt!“
„Was sprichst Du, Anna! Bin ich meinem Gemahle nicht stets in treuer Liebe zugethan gewesen?“
„Als Ew. Gnaden sich vermählte, war Sie zu jung, um Liebe zu kennen, und an der Seite eines so bejahrten Mannes kommt sie nicht zur Blüthe. Aber hat denn Ew. Gnaden niemals empfunden, daß ein Wort aus gewissem Munde unendlich größeren Reiz haben kann, als Tausende der süßesten Schmeicheleien, daß ein Blick aus gewissem Auge oft tiefere Bedeutung hat, als eine lange Lobrede!“
„Darüber habe ich niemals nachgedacht“, antwortete Frau Christine, die in zarter Jugend gleich so hoch geflogen war, daß sie wohl berechtigt schien, den Weihrauch, den man ihr streute, für den Ausdruck aufrichtiger Verehrung zu halten, aber alle diese Huldigungen mit der kühlen Ruhe aufgenommen hatte, die ihr ganzes Wesen charakterisirte.
„Sollte man wirklich 28 Jahre in dieser Welt leben können, ohne die süßen Freuden und Qualen einer tieferen Neigung kennen zu lernen?“ flüsterte die gefährliche Frau leise bei sich, mit einem forschenden Blicke auf Christine Munk.
„Wenn Du so großen Werth auf Huldigungen legst, da muß es Dir hier recht einsam vorkommen. Du sehnst Dich vielleicht nach dem fröhlichen Kopenhagener Leben zurück?“ fragte Christine.
„O nein, gnädige Frau,“ rief Anna Lykke lebhaft. „Das Leben im Felde behagt mir ungemein, und ich ziehe es dem Hof leben jedenfalls vor. An Festen wird es uns künftigen Winter auch nicht fehlen, und wie viel herrlicher ist es, sich mit den Rittern und Junkern zu unterhalten, die mit Lorbeeren bedeckt aus dem blutigen Tanze mit dem Feinde heimkehren, als die faden Redensarten der Pagen und Hofjunker anzuhören, die keinen anderen Schauplatz ihrer Großthaten kennen, als den glatten Parquetboden bei Hofe.“
Frau Kirstin lächelte. „Ich hoffe, daß wir die Winterquartiere in Westphalen beziehen werden,“ sprach sie, nicht ahnend, wie bald sie aus diesem glücklichen Wahne gerissen werden sollte. „Der König war in seinem letzten Briefe aus Duderstadt voll frohen Muthes, und wenn die Engländer und Franzosen Kunde von den neu errungenen Vortheilen erhalten, so werden sie desto leichter zur Unterstützung bereit sein.“
Die Damen hatten noch eine Weile so fortgeplaudert und sich tiefer und tiefer in die politischen Zeitverhältnisse hineingeredet, als plötzlich die alte Dorthe händeringend eintrat und kaum hörbar die Kunde hervorstieß:
„Se. Majestät ist zurück, – der Feind verfolgt ihn, und alles, alles ist verloren!“
Christine Munk starrte die Alte eine Weile mit stummem Entsetzen an, dann erhob sie sich und wankte an’s Fenster, wo sich ein trauriges Schauspiel darbot. Ein Trupp Reiter, der mit dem Könige gekommen war und eben vom Pferde absaß, bestätigte und vervollständigte den Bericht der Dorthe. Die Pferde waren mit Schaum und Schlamm bedeckt, die Reiter zum Theil ohne Waffen und Sturmhaube, mit bestäubten, zerrissenen Kleidern und so erschöpft, daß einige nicht ohne Hülfe vom Pferde steigen konnten.
„Wo ist der König?“ fragte Christine Munk.
„Se. Majestät zog sich gleich in seine Gemächer zurück und verschloß die Thür,“ sagte die Alte.
„Geh‘ hinauf zu den Kindern, Anna, ich werde Dich rufen lassen, wenn ich Deiner bedarf“, sprach Christine ernst. Auch sie fühlte, gleich dem Könige, das Bedürfniß, allein zu sein. –
Zwei lange Stunden waren vergangen. Christine Munk war angstvoll in ihrem Zimmer auf- und abgewandelt, als sie endlich, von den Qualen der Ungewißheit überwältigt, leise die Thür nach dem Corridor öffnete und, da sie niemand erblickte, bis an die Gemächer ihres Gemahls vorschritt, wo sie schüchtern an die Thür pochte und Einlaß begehrte.
Der König öffnete nicht allein die Thür, er öffnete ihr auch bewegt die Arme, und Christine sank weinend an seine Brust.
„Sprecht, sagt, was ist geschehen!“ schluchzte sie. „Ich vermag das Schlimmste zu hören.“
„Ich habe eine Schlacht verloren, und meine Armee ist theils vernichtet, theils zerstreut,“ sagte der König.
„Kann denn eine verlorene Schlacht einen so tapferen König niederbeugen?“ fragte Christine sanft.
„So fragst Du, weil Du nicht weißt, wie schwer dieser Verlust mich trifft und wie unheilvoll die Folgen werden können.“
Als er sie an einen Sitz geführt und neben ihr Platz genommen hatte, begann er ihr zu erzählen, was wir bereits über die Schlacht wissen.
„Der Lüneburger soll seinen Verrath dereinst vor dem Throne des ewigen Richters verantworten,“ sprach er feierlich und fuhr nach einer Pause fort: „Als ich mit der Reiterei, die sich um mich scharte, mir einen Weg durch den Feind gebahnt hatte, der sich meiner Person zu versichern trachtete, ritten wir über Moräste und zertretene Kornfelder querfeldein. Da stürzte mein todtmüdes Pferd. Der Diener, welcher mein Handpferd bereit hielt, war geblieben. Wenzel Rothkirch, der sich den ganzen Tag in meiner Nähe gehalten hatte, gab mir das seinige und folgte mir eine Strecke Weges zu Fuß, bis wir abermals einen Sumpf passiren mußten, wo er, aufs äußerste erschöpft, zurückblieb. Gebe Gott, daß er zu den Unseren gestoßen und nicht in Feindes Hände gefallen ist! Bleibt er mir erhalten, so werde ich diesen Liebesdienst, den er mir erwiesen, nicht vergessen!“
Nach einer Pause sagte der König seltsam bewegt: „Du erkundigst Dich gar nicht nach unseren braven Freunden,“ und als Christine, von seiner Weichheit ahnungsvoll betroffen, schwieg, fuhr er fort: „Der 27. August hat mich arm gemacht. Penz, der bisher unverwundbar schien, der vor Calmar, wie eine Hüne über alle hervorragend, die Feinde wie die reifen Aehren mähte, seine Freunde rächend, die rechts und links um ihn zu Boden sanken, – Marquard Penz hat nun die deutsche Erde mit seinem Herzblute getränkt! Johann Philipp Fuchs, der edle Franke, der tapfere, kriegserfahrene General, mein treuer zuverlässiger Freund, ist auch nicht mehr. Auch Philipp von Hessen, den jugendlichen Helden, dürfen wir nicht mehr zu den Lebenden zählen. Sigward Pogwisch, der mit Wenzel mir zur Seite blieb und über meine Sicherheit wachte, schlug einen auf mich gezückten Pallasch aus der Hand des eindringenden Feindes, als er, von einer Kugel ins Herz getroffen, zu Boden sank.
„Laßt mich liegen und rettet den König!“ rief er im Sinken, – es war sein letztes Wort, denn als man ihn auf meinen Befehl aus dem Gefechte trug, war er bereits verschieden.“
Hier versagte die Stimme des Königs; ein tiefer Seufzer entrang sich seiner gepreßten Brust. Christine Munk bedeckte das weinende Gesicht mit ihrem Tuche. Sie schlang den Arm um seinen Hals, lehnte den Kopf an seine Schulter, und so saßen sie schweigend eine Weile, als an der Schwelle ein Page erschien, welcher meldete, daB der Rheingraf Ludwig Otto v. Solms um Vortritt bäte.
„Er soll kommen!“ rief der König lebhaft, und als Christine sich entfernen wollte: „Bleibe und höre, was der Graf neues bringt. Ich hoffe, daß die zerstreuten Glieder sich nach und nach hier wieder zusammenfinden, bevor der Feind ihnen den Weg abschneidet.“
Der Eintretende, ein schöner Mann mit dunklen Locken, dunklen, feurigen Augen und edlem Anstande, verbeugte sich tief vor dem Könige und dessen Gemahlin.
„Was bringt Ihr, Herr Graf?“ fragte der König, ihm huldvoll die Hand reichend.
„Wenig mehr als meine eigene, Ew. Majestät treu ergebene Person,“ sprach der Rheingraf ernst. „Meine Braven sind mit dem Hessischen Regimente in jenem unseligen Moraste versunken, der uns vor der Schlacht vor dem feinde trennte. Ein geringes Häuflein entrann mit mir diesem schmählichen Tode, doch hat sich unterwegs eine Anzahl versprengter Reiter zu uns gefunden, so daß ich mit 500 Mann hier eingerückt bin.“
„Ichfreue mich, Euch wohlbehalten wieder zu sehen, und möchte wünschen, daß Eure Meldung der Anfang zu mancher ähnlichen sein möge,“ sprach der König. „Jetzt ruht Euch aus, Herr Graf und macht’s Euch bequem. Die Etiquette ist in Zeiten, wie die jetzige, über Bord geworfen. Meine Hausfrau wird sich freuen, die uns erhaltenen Freunde begrüßen und bewirthen zu können.“
Als Christine Munk dem Grafen ihre Hand zum Gruße reichte und ihr Auge seinem feurigen Blicke begegnete, senkte sie erröthend die Lider und lud ihn, auf einen Armsessel deutend, zum Niedersitzen ein.
Das Gespräch lenkte bald wieder in die einzelnen Begebnisse des Kampfes ein, und der Rheingraf schleuderte ein Anathema auf den abtrünnigen Lüneburger, dessen Bruder als Haupttriebfeder agirt, als man den König von Dänemark um seinen Schutz für Niedersachsen angerufen hatte.
„So Gott will, werden wir eines Tages Revanche für die Affaire bei Lutter nehmen,“ sprach der König. „Das Heer erholt sich rasch, wenn erst die Glieder wieder gesammelt und die Lücken ausgefüllt sind. Aber alle Schätze des katholischen Heeres möchte ich darum geben, könnte ich damit das Leben der Edlen wieder kaufen, die ich vor meinen Augen habe fallen sehen! Penz, Fuchs, Sigward Pogwisch, Philipp von Hessen, – ihr Verlust lastet schwer auf meinem Herzen.“
Frau Kirstin’s Thränen brachen aufs neue hervor. „Wer hätte so Schreckliches ahnen können,“ sprach sie. „Ach, man muß die Braven gekannt haben, um den schmerzlichen Verlust des Königs fassen zu können!“
„Das Leben des Krieges ist ein fortwährendes Ringen mit dem Tode, der für mich alle Schrecken verlöre, wenn ich die Gewißheit hätte, von so schönen Augen beweint zu werden,“ sprach der Rheingraf und abermals ruhten seine brennenden Blicke auf Christine Munk’s lieblichem Antlitze, dem die schmerzliche Erregung ihres Innern einen neuen Reiz verlieh, und abermals mußte sie vor den glühenden Blicken die Lider senken, während ein tiefes Rosenroth ihre Wangen färbte.
„Man hat allseitig den Tod Christian’s von Braunschweig beklagt,“ fuhr er fort, „ich habe ihn beneidet. Er hatte sein Leben seiner schönen unglücklichen Cousine, der entthronten Königin, geweiht. Ihr Handschuh zierte seinen Hut. Für Sie! war das Wort, das man auf seinen Fahnen las, das Zauberwort, mittelst welchem er ohne Geldmittel eine ansehnliche Heeresmacht zu werben wußte. So trug er diese treue, ehrsame Liebe den Augen der Welt zur Schau, lebte, kämpfte, litt und starb für sie, – bei Gott, ein beneidenswerthes Geschick!“
„Hätte ich doch nimmer geglaubt, daß Ihr, Herr Graf, ein solcher Schwärmer wäret,“ lächelte der König.
Frau Kirstin versuchte ebenfalls zu lächeln, aber ihr war beklommen ums Herz, und selbst als sie sich Abends von den Herren verabschiedet und in ihr Schlafgemach zurückgezogen hatte, tönte noch immer das Wort: für sie! in ihren Ohren wieder, mit dem Wohllaute der klangvollen Stimme des Grafen, und auch die seltsamen Augen traten ihr wieder ins Gedächtniß, vor denen sie selbst in der Erinnerung erröthen mußte.
Als sie sich von Wiebeke die Locken auflösen ließ und, zu sehr mit sich selbst beschäftigt, dem jungen Mädchen kteine Aufmerksamkeit geschenkthatte, hörte sie es schwer aufseufzen. „Was fehlt Dir, Kind?“ fragte Christine freundlich.
„Mir fehlt nichts, als daß ich viel Trauriges vernommen habe, ohne zu wissen, ob es wirklich wahr ist“, entgegnete Wiebeke. „Ich stand im Corridor, als der König heimkehrte, und als er an mir vorüberschritt und mir gnädig guten Tag bot, da blickten seine Augen so düster und schmerzvoll, daß es mich weinen machte.“
„Ja wohl ist viel Trauriges geschehen, mein armes Kind,“ sagte Christine wehmüthig. „Ich kann es mir noch gar nicht denken, daß wir die treuen Freunde, die uns von Glückstadt her mit kurzen Unterbrechungen nahe waren, wirklich nimmermehr wiedersehen sollen. Der Krieg ist schrecklich wenn er uns solchergestalt sein grauenhaftes Wesen offenbart, und Du, arme Wiebeke, bereust vielleicht schon, daß Du Frau Ellen’s Anerbieten sie nach Dänemark zu begleiten abgelehnt hast.“
„Nein, nein!“ versetzte Wiebeke schluchzend, „aus eigenem Antriebe verlasse ich Ew. Gnaden nicht.“
„Ich weiß, daß Du mich lieb hältst und hätte Dich auch nicht gern ziehen lassen,“ sagte Frau Kirstin. Geh‘ jetzt schlafen, Kind, wir wissen nicht wie lange wir hier noch in Ruhe bleiben dürfen.“
VIII.
Ah Christian IV, die unheilschweren Folgen seiner Niederlage bei Lutter voraussah, war er sich seiner mißlich en Situation wohl bewußt. Es fehlte an den größeren und kleineren protestantischen Höfen nicht an verkappten Jesuiten, welche Zwietracht zwischen den lutherischen Fürsten zu stiften suchten, vor allem aber die Bande der niedersächsischen Union zu lösen bemüht waren,in den sie die deutschen Herren vor dem geheimen Eroberungsgelüste des Dänen warnten und ihnen in dem entthronten Könige von Böhmen das trostlose Beispiel eines Fürsten vorführten, der durch sein Auflehnen wider den Kaiser sich seines väterlichen Erblandes beraubt sah und als Flüchtling in fremdem Lande umsonst auf bessere Zeiten hoffte. Nach dem Lüneburger sagte sich der Herzog von Braunschweig von dem Bündnisse los; bald danach versicherten die Mecklenburger den Kaiser ihres Gehorsams, und sogar der Herzog von Holstein betheuerte seinem Lehnsherrn, daß er niemals den Krieg gewollt, sondern zum Schutze seiner Glaubensgenossen der Union beigetreten sei; England benutzte gleichfalls die Gelegenheit um seine Hand vollends zurückzuziehen – und so sah sich denn Christian IV. mit seinem Heere allein, von den meisten seiner Bundesgenossen verlassen und bedrängt von dem immer stärker anwachsenden Heere der vereinigten kaiserlichen Feldherren. In allen festen Plätzen starke Garnisonen zurücklassend, zog er sich nach Stade zurück, welches er schleunig befestigen ließ. Zwar hatten sich nach der Schlacht bei Lutter die zersprengten Truppenkörper zahlreich wieder eingefunden, doch erlaubte die Beschaffenheit des Heeres dem Könige nicht mehr angreifend zu Werke zu gehen. Er war nur darauf bedacht dem anrückenden Feinde den Uebergang über die Elbe zu wehren und seine Länder zu schützen. Je schmerzlicher sich Christian IV. von der Treulosigkeit seiner Verbündeten, von der Wortbrüchigkeit des englischen Hofes berührt fand, desto empfänglicher war er für den abermaligen Liebesbeweis seines ältesten Sohnes, der ihm von Dänemark aus 4000 Mann auserlesener Hülfstruppen zuführte.
Auch in Holstein ward gerüstet. Auf einem am 28. November in Rendsburg gehaltenen Landtage hielt der Statthalter, der hochbetagte Gerhard Rantzow, eine eindringliche Rede an die Landstände, in welcher er ihnen die Pflicht ans Herz legte, das eigene Land und die reine Lehre Christi zu schirmen; er selbst wolle der Erste sein, der seine grauen Haare gegen den Feind wage, und alle sollten einmüthig seinem Beispiele folgen.
Der Adel verpflichtete sich in Person zu Felde zu ziehen; Stadt und Land steuerten mit Geld und Mannschaft zur Ausrüstung eines Heeres bei, welches bald zu einer Macht von 2 000 Reitern und l 000 Mann Fußvolk anwuchs und von dem Könige gemustert wurde.
Im Sommer des Jahres 1627 zog sich das Unwetter immer drohender über den Häuptern der Schleswig-Holsteiner zusammen, indem Tilly, Wallenstein und Pappenheim sich nach Norden wandten. König Christian hatte längst eingesehen, daß er einer so großen Uebermacht denUebergang über die Elbe nicht lange würde sperren können, als er während seiner Anwesenheit bei einem zweiten Landtage in Rendsburg plötzlich die Kunde erhielt, daß Tilly seine Entfernung benutzt habe, Luttershausen, einen Paß an der Elbe, zu überrumpeln und, nachdem er Boitzenburg und Lauenburg besetzt, nach Hamburg vorrücke.
Die königliche Familie hielt sich noch in dem neu befestigten Stade auf. Der König hatte bei seiner Abreise nach Rendsburg geäußert, daß er längere Zeit in Holstein verweilen werde, und Frau Christine Munk, die von dem Vordringen der Kaiserlichen nichts wußte, verlebte sorglos Tag auf Tag und erwartete nichts weniger als die Rückkehr ihres Gemahls, als dieser einst mitten in der Nacht vor ihr Lager trat.
„Stehe auf und mache dich reisefertig, „Kind!“ rief er, ihre Hand fassend. „Im Hafen liegt ein segelfertiges Schiff und der Wind ist günstig.“
Christine Munk fuhr schlaftrunken empor. „Reisen? – – wohin? – – weshalb?“ fragte sie.
„Nach Dänemark,“ erwiderte der König. „Tilly ist in Holstein eingefallen. Ich muß eilen um Schleswig zu schützen.“
„Und warum müssen wir reisen?“ fragte Christine. „Gebt Ihr denn alle festen Plätze diesseit der Elbe auf?“
„Das ist das erste Mal, daß Du Dich um kriegerische Operationen kümmerst,“ sprach Christian IV. befremdet. „Hast Du Lust hier zu bleiben, abgeschnitten von Deiner Heimath, schutzlos den Gefahren einer wahrscheinlichen Belagerung ausgesetzt?“
Christine seufzte und griff nach ihren Kleidern.
„Ich gebe Dir drei Stunden Zeit. Was nun nicht rasch eingepackt werden kann, muß nachgeschickt werden.“ Mit diesen Worten verließ der König das Zimmer.
Zurück nach Dänemark! Warum erfüllte dieser Gedanke sie mit Zagen und leisem Grauen? Sie überließ es Wiebeke und der alten Dorthe, das nöthige Gepäck zu besorgen, und ging gleichgültig umher, bis der König kam, um sie an Bord zu begleiten. Als sie aber von den an der Brücke versammelten Herren und Hofleuten Abschied nahm, da brach sie in ein heftiges Weinen aus.Schon war die Brücke eingezogen und das Schiff eine kleine Strecke vom Lande entfernt, als ein hochgewachsener Mann, in einen schwarzen Mantel gehüllt, den Hut tief über die Stirn gezogen, sich durch die am Ufer stehende Menge drängte und einen spähenden Blick auf das Schiff warf. Christine Munk sah ihn, bewegte das Tuch, mit dem sie ihre Augen bedeckte, wie zum Gruße und begann aufs neue zu weinen.
„Das ist ja der Rheingraf,“ rief der König, den Fremden, welcher eben nach dem Schiffe hinüber grüßte, scharf ins Auge fassend. „In Rendsburg sagten mir die Officiere seines Regimentes, er sei nach Braunschweig gereist. Ist er schon länger hier, und hast Du ihn gesehen?“
Christine bedeckte schluchzend das Gesicht und blieb die Antwort schuldig.
„Gelten Deine Thränen dem Abschiede von Deutschland oder dem Unglücke, welches mich in meine eigenen Länder verfolgt?“ fragte der König mit einem Anfluge von Spott. Und als Christine auch diese Frage unbeantwortet ließ, wandte er ihr den Rücken und knüpfte ein Gespräch mit dem Capitain des Schiffes an.
Christine Munk schien seit einiger Zeit dem Könige etwas fremder gegenüberzustehen. Sie kam ihm nicht, wie sonst, mit offenen Armen, mit den offenen, klaren Kinderaugen entgegen, wenn er nach längerer Abwesenheit zu ihr heimkehrte. Scheu und verlegen mied sie seine Nähe, oder sie begrüßte ihn mit einer stürmischen Zärtlichkeit, die ihrer Natur nicht eigen war. Der König war durch Sorgen mancher Art zu sehr beschäftigt, um sich um die Laune seiner Gemahlin zu kümmern. Ihr seltsames Betragen bei der Abfahrt hatte ihn jedoch unangenehm berührt, wie auch Christine ihrerseits sich durch seine Worte verletzt fühlte. Als sie aber nach Verlauf einiger Stunden von der schwankenden Bewegung des Schiffes zu leiden begann und der König mit rührender Sorgfalt für ihre Bequemlichkeit sorgte, da ergriff sie in aufwallender Dankbarkeit seine Hand und preßte sie heftig an ihre Lippen.
Nach einer glücklichen Fahrt näherten sie sich am folgenden Tage unweit Büsums der holsteinischen Küste. Als man nahe genug war die Gegenstände am Ufer unterscheiden zu können, bemerkte man dort ein seltsames Hin- und Herrennen. Hier und da blitzte ein Flintenlauf in der Sonne, und verworrenes Geschrei und laute Drohungen schallten über das stille Wasser.
„Was gilt’s,“ lachte der König, „die Dithmarsen halten unser Schiff für ein feindliches und wollen uns die Landung wehren.“
„Befiehlt Ew. Majestät, daß ich ein Boot ans Land schicke, um sie eines besseren zu belehren?“ fragte der Capitain.
„Ich will selbst mit den Frauen ans Land, da werden sie wohl Freund und Feind unterscheiden,“ versetzte der König und bestieg mit den Frauen die ausgesetzte Schaluppe.
König Christian hatte die Bewegung am Ufer richtig beurtheilt. Als die Strandwache das Kriegsschiff in Sicht bekam, hatte sie dasselbe für ein kaiserliches gehalten und Alarm gemacht, worauf die Bauern aus Büsum und Weslingburen, Männer und Weiber, mit Piken, Schießgewehren, Forken und Knitteln bewaffnet, zusammenliefen um den vermeintlichen Feinden die Landung zu wehren.
Als das Boot anzulegen versuchte, pfiff eine Kugel dicht über die Köpfe der Frauen hin.
„Hoho, Freunde,“ rief der König, einen Pfahl erfassend und sich mit einem Sprunge ans Land schwingend, „solchen Empfang mögt Ihr für andere aufsparen!“
Kaum hatte er den Fuß ans Land gesetzt, als er sich von den Bauern umzingelt sah, die mit hochgeschwungenen Waffen auf ihn eindrangen, und schon hob der Vorderste seinen Knittel zu einem gewaltigen Streiche, als Wiebeke Kruse sich zwischen ihn und den König stürzte und, die Arme gebieterisch emporhebend, mit lauter Stimme rief:
„Schießt nicht, stecht nicht, Freunde! Kennt Ihr denn Euren Landesherrn nicht, der Frau und Kinder in die Heimath zurückführt?“
„Wie könnt Ihr denken, daß der Feind mit Frauen und Kinderhier landen würde?“ rief Christine Munk, welche nebstdem männlichen und weiblichen Gefolge ebenda herzutrat.
Die Bauern sahen die Ankömmlinge und sich einanderverlegen an und warfen die Waffen fort. Christian IV.,welcher sich bei dem Vorgange passiv verhalten hatte, lachte, daß er sich die Seiten halten mußte.
„Bravo, Ihr Dithmarsen“ rief er. „Ihr bewährt den alten Ruf, daß Ihr Euer Land von Feinden rein zuhalten wißt. Manchem Kampfe bin ich glücklich entronnen,“fuhr er, einem Weibe, welches mit einer Forke auf ihn eingedrungen war, freundlich auf die Schulter klopfend,fort „und gerieth nun hier in Gefahr von einer Marsin gespießt zu werden. Wohl hat man mir den Heldenmuth der Dithmarser Frauen gerühmt; fortan kann ich aus eigener Erfahrung davon erzählen. Jetzt gewährt meiner Familie gastlich Obdach und schafft mir Fuhrwerk, daß ich weiterkomme; meine Zeit ist kostbar.“
Die Frauen, welche Christine inzwischen umringt hatten, führten sie nebst ihren Dienerinnen freundlich ins nächste Haus und sorgten für Speise und Trank, während einige von den Männern nach Weslingburen eilten um die stattlichsten Wagen und die schönsten Pferde herbeizuholen. Nach einigen Stunden mahnte der König zum Aufbruch. Die Frauen ließen es sich nicht nehmen den Wagen, in welchem der König und Frau Kirstin fuhren, mit weichen Kissen und gewaltigen Speisekörben zu bepacken, und so fuhr die königliche Familie nach Friedrichstadt und von dort ohne Aufenthalt weiter nach Flensburg.
Dies kleine Abenteuer hatte den Reisenden Stoff zu lebhafter Unterhaltung gegeben. Der König nannte Wiebeke scherzweise seine Lebensretterin; aber Wiebeke verbarg unter ihren munteren Antworten ein wehmüthiges Herz. Sie hatte lange darauf gehofft, von Glückstadt aus ihre alten Eltern besuchen zu dürfen, und mußte nun auf die Freude verzichten und nebenbei die Befürchtung hegen, daß die Ihrigen viel Unbill von dem fremden Kriegsvolke zu dulden haben würden.
In Flensburg erfuhr König Christian, daß Pinneberg sich nach achttägiger Belagerung dem Tilly ergeben habe, und daß auch Wallenstein in Holstein eingerückt sei und unaufhaltsam vordringe.
Christian IV. war zunächst darauf bedacht, die Truppen, die zu seiner Verfügung standen, in Schleswig zusammenzuziehen. Ein niedersächsisches Corps unter dem Befehle des Markgrafen von Durlach schiffte sich in Wismar ein und landete zwischen Oldenburg und Heiligenhafen, um sich mit dem in Rendsburg liegenden Regimente Solms zu vereinigen. Diesen Plan suchte der kaiserliche General Schlick zu vereiteln, indem er den Markgrafen, ehe dieser sein Lager bei Heiligenhafen verschanzt hatte, mit großer Uebermacht angriff und ihn zu einer Schlacht zwang, welche bis an den Abend dauerte. Der Markgraf benutzte die Nacht, um sich in seine Schiffe zurückzuziehen; aber kaum war das schottische Regiment Monroe, welches am meisten gelitten hatte, eingeschifft, als mit Tagesanbruch der Kampf aufs neue entbrannte. Außer der holsteinischen adeligen Reiterfahne und dem Regimente des Herzogs von Weimar wurde das ganze Corps vernichtet; was nicht gefallen war, streckte die Waffen, und nur von einem geringen Häuflein heißt es, daß es sich glücklich durchgeschlagen und Rendsburg erreicht habe. Als der König diese Nachricht in Flensburg erhielt, gab er das Festland verloren und war darauf bedacht, die Inseln zu schützen. Die von Heiligenhafen zu Schiffe angekommenen Truppen wurden nach Fühnen geschickt, wohin sich später auch diejenigen Regimenter begaben, die durch das Holstenland hindurch bis nach Jütland vom Feinde verfolgt waren. Frau Christine Munk war mit ihrem Gefolge von Flensburg gleich weiter nach Dalum auf Fühnen gereist, wohin der König ihr nach einigen Wochen folgte. Dort besuchte sie Frau Ellen Marsvin, die aus Furcht vor dem andringenden Feinde ihre beweglichen Güter von Jütland nach Fühnen hinübergeschafft hatte. Ihr lebhafter Geist und ihre weitverzweigten Geschäftsverbindungen gestatteten ihr nicht, sich bleibend in Dalum niederzulassen, doch kam sie oft von ihrem Gute Kjaerstrup hinüber ins Hauptquartier.
Dort saß sie einst in dem Schlafzimmer ihrer Tochter und sah, nachdem in der Unterredung eine Pause eingetreten war, nachdenklich auf den König, welcher mit verschränkten Armen und gerunzelter Stirn sinnend am Fenster stand.
„Was grübelt mein König?“ fragte sie in ihrer eigenthümlich freimüthigen Weise. „Lassen die Sorgen sichselbst in Gesellschaft der Damen nicht ein Stündchen abschütteln?“
Frau Ellen hatte großen Einfluß auf Christian IV., welcher sie gern in seiner Nähe sah. Auch jetzt trat er zu ihr hin und sagte lächelnd: „Wäre ich Ellen Marsvin, so besäße ich vielleicht die Artigkeit, in liebenswürdiger Gesellschaft alle verdrießlichen Gedanken zu verjagen. Ich dachte eben daran, daß ich eigentlich übermorgen in Kopenhagen sein muß.“ Und um Frau Ellen’s weitere Fragen zu unterbrechen, fuhr er zu seiner Gemahlin gewandt fort: „In Holstein sieht es traurig aus. Tilly ist von seiner Wunde, die er vor Pinneberg erhielt, genesen und hat Elmshorn, Steinburg, Wilder und Rendsburg besetzt, und die beiden Besitzungen, die Du Dir zu eigen wünschtest, Haseldorf und Breitenburg, sind von Wallenstein genommen.“
„Waren sie so schlecht bewacht oder schlecht befestigt?“ fragte Ellen Marsvin.
„Breitenburg war schlecht befestigt und hielt sich dennoch sechs Tage lang gegen eine Macht von 10,000 Mann. Erinnerst Du den Major Dumbar, der in Wolfenbüttel mit verbundenem Kopfe ein zersprengtes Corps einführte? Der Brave lag dort mit vier Compagnien Schotten und einigen Deutschen. Als der Feind Bresche gemacht hatte und den Platz zur Uebergabe aufforderte, antwortete er: „So lange noch Blut in Dumbar’s Hirnschädel ist, liefert er das Haus nicht in Feindes Hand!“ Einige Stunden später ward er von einer Kugel zu Boden gestreckt. Die Officiere wollten nach dem Tode ihres braven Commandanten sich ebenso wenig ergeben und sind fast alle geblieben. Als der Feind endlich über die Gräben kam, schonte er nur Weiber und Kinder; alles übrige wurde niedergemacht, das Schloß geplündert und leider auch die reiche Bibliothek mit ihren vielen kostbaren Handschriften zerstört.“ *)( Sie soll größtentheils nach Hamburg gekommen sein., Anm. J.M.)
„Habt Ihr diese Nachricht kürzlich erhalten?“ fragte Christine.
„Heute Morgen durch einen Officier aus Glückstadt. Die Festung hält sich tapfer.“
„O, der Krieg ist schrecklich!“ seufzte Christine. „Das ganze schöne Deutschland wird zu Grunde gehen; Ihr glaubt nicht, Mutter, welch ein Elend dort bereits herrscht.“
„Du urtheilst kurzsichtig, mein Kind,“ erwiderte Frau Ellen. „Deutschland geht durch den Krieg nicht zu Grunde. Das Volk ist in gewaltiger Gährung; aber wenn einst alles Unreine und Verdorrte ausgeschieden und niedergeschlagen ist, so wird es geläutert und kräftigen Geistes neu erstehen. Wir erleben dies nicht, aber solchen Gährungsproceß haben viele Nationen durchgemacht; manche ging dabei zu Grunde, aber Deutschland hält aus; das prophezeie ich, obgleich ich den Deutschen nicht hold bin.“
„Vor keinem Gewaltmittel zurückbeben, wenn es zu glorreichem Ziele führt, daran erkenne ich Euch, Frau Schwiegermutter,“ rief der König lächelnd. „An Euch hat die Welt einen Feldherrn verloren, Ellen.“ Nach diesen Worten versank er in neues Grübeln und verließ bald darauf das Zimmer.
„Jetzt sind wir allein“, begann Frau Ellen nach einer Weile, „jetzt sage mir, Kind, wonach ich Dich lange habe fragen wollen: was war es mit Anna Lykke?Wodurch hat sie sich die Ungnade des Königs zugezogen?“
„Das weiß ich nicht“, erwiderte Christine. Ich hoffte etwas von Euch darüber zu erfahren.“
„Ei, Du wirst doch wissen, auf welche Weise die Gouvernante Deiner Kinder aus Deinem Hause entlassen wurde?“
„Was ich weiß, will ich Euch sagen; doch ist es nicht viel. Ich war noch krank und schwach, meine kleinen Zwillingstöchter waren kaum vierzehn Tage alt, als Dorthe eines Morgens zu mir eintrat. An ihren fest zusammengekniffenen Lippen und dem unruhigen Hin- und Hertrippeln merkte ich, daß sie sich gewaltsam zu schweigen zwinge. Nun, was giebt’s? fragte ich. – Weiß Ew. Gnaden schon, daß Frau Lykke verreist ist? – Als ich verneinte und ihr befahl, sich deutlicher zu erklären, vernahm ich, daß man früh Morgens zwei Soldaten mit gezogener Waffe vor Anna Lykke’s Thür postirt habe und daß zwei Officiere in ihre Kammer gegangen seien. Als Dorthe hinein verlangte, wies man sie barsch zurück, doch sah sie durch den Thürspalt, daß Wiebeke drinnen war. Nach einer kleinen Stunde trat Anna Lykke tief verschleiert aus der Kammer und bestieg, von den Officieren begleitet, einen bereitgehaltenen, dichten Wagen und fuhr davon.“
„Fragtest Du denn Wiebeke nicht, wie sie zu Anna Lykke gekommen sei?“
„Allerdings. Sie hatte einen schriftlichen Befehl des Königs erhalten, sich zu der Lykke zu verfügen und bei ihr zu bleiben, bis sie abreise. Sie hatte ihr beim Ankleiden geholfen, hatte die nothwendigsten Kleider für sie gepackt, alles unter Aufsicht der Officiere, welche ihre Kisten und Schränke durchsuchten und alle Papiere und Briefschaften mit sich fortnahmen. Anna Lykke hatte kein Wort gesprochen, selbst dann nicht, als Wiebeke fragte, ob sie keinen Gruß, keinen Auftrag an mich habe.“
Seltsam, seltsam!“ flüsterte Frau Ellen kopfschüttelnd. Hast Du nie den König danach gefragt?“
„Gewiß. Aber er gerieth in Zorn und befahl mir, zu schweigen. Die Kinder wurden einige Tage später zu der Fürstin Nassau-Dietz geschickt.“
„Wart‘ einmal Kind, wer ist die Nassau-Dietz? Ich kann mich unter den vielen deutschen Fürstinnen nicht zurechtfinden.“
„Eine Tochter der Herzogin von Braunschweig, Schwestertochtar des Königs.“
„Ah, nun weiß ich. Ich war gerade in Kopenhagen, als es plötzlich hieß, Anna Lykke sei unter strenger Bewachung in Kronburg angekommen und werde dort in Haft gehalten. Alle fragten, was sie verbrochen – keiner wußte es. Der Kronprinz fuhr gleich nach Nyborg zu der verwittweten Königin. Diese schickte mehrere Couriere an den König ab, und man meint, daß auf ihre Fürsprache die Unglückliche in ein besseres Gefängniß geführt sei. Die Ursache ihrer Einkerkerung blieb allen ein Räthsel. Einige sagten, sie habe sich in die Politik gemischt und den König und den Kronprinzen zu entzweien gesucht; andere beschuldigten sie geheimen Einverständnisses mit dem Feinde; noch andere wußten, sie habeDich zu leichtfertigem Wandel zu verführen gesucht, um Dich zu stürzen und des Königs Gunst sich zuzuwenden,“ – hierbei ruhten Frau Ellen’s Augen forschend auf ihre Tochter, die sich entfärbte und wie ermüdet die Augen schloß.
„Vor dem Herrentage zu Kolding sollte sie ihr Verhör bestehen, doch bewirkte die Königin Sophie, daß sie ihrer Haft entlassen wurde. Sie hat übrigens immer noch Hausarrest und darf ihre Wohnung nur verlassen, um in die Kirche zu fahren.“
Christine enthielt sich jeder Bemerkung über diese Angelegenheit.
„Sehnst Du Dich nicht nach Deinen Töchtern?“ fragte die Mutter nach einer Weile.
„Sie sind ja bei der Fürstin gut aufgehoben,“ versetzte Frau Kirstin gelassen.
Die Erziehung der Kinder war ein Punct, m welchem Mutter und Tochter niemals übereinstimmten, weshalb Frau Ellen auch jetzt diese Frage nicht weiter erörterte, sondern das Gespräch auf andere Gegenstände lenkte.
——————-
Es war mittlerweile Winter geworden. Die kaiserlichen Truppen hatten bis nach Jütland hinauf Winterquartiere genommen. In Jütland hielten sie sich friedlich und hinderten Bürger und Bauern nicht, ihren Geschäften nachzugehen, ja sie förderten den Handelsverkehr durch Reisepässe und sicheres Geleit. In den Herzogthümern ging es weniger ruhig her. In Angeln griffen die Bauern nicht selten zu den Waffen, um die Fremden Sitte und Ordnung zu lehren, wobei hunderte der fremden Soldaten ums Leben kamen. Die Friesen an der Westküste nahmen den Kaiserlichen sogar ein paar mit Proviant und Kriegsbedarf befrachtete Schiffe, bemannten sie mit eigenen Seeleuten und kreuzten damit an der Küste, um dem Feinde fernere Zufuhr abzuschneiden, und es gelang ihnen wirklich, mehre Schiffe aus Bremen und Dünkirchen als Prise aufzubringen.
Im Hauptquartiere zu Dalum mangelte es nicht an Nachrichten aus den Herzogthümern. Man erfuhr, daß die Kaiserlichen sich an der Stör verschanzt hatten, aber von der Glückstädter Besatzung aus dieser Position vertrieben waren. Auch die Affaire bei Bramstedt kannte man, als die Glückstädter am Osterabend dicht vor dem Flecken ein paar kaiserliche Compagnien überfielen und ihnen kostbare Beute abgewannen.
Christian IV. hatte eine sehr natürliche Vorliebe für die von ihm angelegte Festung Glückstadt, weshalb die Nachrichten von den häufigen Ausfällen, womit die Besatzung den Feind unaufhörlich beunruhigte, ihm besondere Freude machten. Als man im Laufe des Sommers gar erfuhr, das Wallenstein der empfindlichen Verlüste wegen, die er während der Belagerung dieses Platzes erlitten, denselben aufzugeben beschloß, da jubelten die Dänen und glaubten Glückstadt für immer gerettet.
Keiner ahnte, daß diese Nachrichten einem armen jungen Frauenherzen schmerzliche Thränen verursachten. Wenn Wiebeke Kruse hörte man habe sich dicht vor Bramstedt geschlagen, so sagte sie sich, daß ihr heimathliches Dorf schwerlich verschont geblieben sei. Erzählte man Crempe sei so sehr von Nahrungsmitteln entblößt gewesen, daß man sich von Ratten genährt habe, bevor man dem Pappenheim die Thore öffnete, – da dachte sie, daß auch ihre Eltern durch übermäßig starke Einquartierung in Noth kommen könnten und daß die vorjährige Ernte gewiß längst aufgezehrt sei. Ihre lebhafte Phantasie malte diese Bilder mit starken Farben, und der Schmerz war desto herber, da sie ihn vor ihrer Umgebung verbarg.
Die Sorge um die Heimath war indessen nicht der alleinige Grund zu Wiebeke’s trüber Stimmung. Die Hauptsache war, daß sie sich weniger gut in ihrem Verhältniß zu ihrer Gebieterin gefiel. Ihr Dienst bei Frau Kirstin trug schon lange nicht mehr den Stempel abgöttischer Verehrung. Der Haushalt war trotz der Entfernung der ältesten Kinder nicht kleiner geworden; außer den in Stade geborenen Zwillingstöchtern war die Familie in Dalum noch um ein Töchterchen vergrößert. Aber alle Bekümmernisse, in der Politik wie in der Familie, alle körperlichen Leiden schienen an Christine Munk spurlos vorüberzugehen: sie war immer nur die schöne, alle bezaubernde Frau, ja, ihre Schönheit schien in Deutschland einen anderen Charakter angenommen zu haben; ihr Auge strahlte von einem Feuer, das man früher nie bei ihr wahrgenommen, ihre Rede athmete Wärme und Leidenschaft, und über ihr Antlitz, über ihr ganzes Wesen war ein Liebreiz ausgegossen, der alle Cavaliere zwang, ihr selbst vor den holden, in zarter Jugendblüthe prangenden dänischen Jungfrauen den Preis der Schönheit zuzusprechen.
In ihre früher so stille, friedliche Häuslichkeit schien indessen ein Geist gefahren, vor dem alle lichten, guten Hausgeister die Flucht ergriffen, und der, wie wir erwähnten, selbst über Wiebeke’s rundes, blühendes Antlitz einen Schatten tiefen Ernstes geworfen hatte.
Unter den Befehlshabern der Truppenkörper, die, vom Feinde nach Jütland hinauf verfolgt, sich nach Fühnen hinüber zum Könige begeben hatten und, seine nächste Umgebung bildend, täglich von ihm zur Tafel gezogen wurden, befand sich, außer dem Herzoge von Weimar, dem tapferen General Monroe, dem französischen General Montgomery und anderen ausgezeichneten Rittern und Edlen, auch der Rheingraf Ludwig Otto v. Solms. Der schöne, beredte Mann mit dem schwärmerischen, leicht entzündeten Herzen war ein gefährlicher Gesellschafter für Christine Munk, die schon längst die Wahrheit der Behauptung Anna Lykke’s erkannt hatte: daß ein Wort von gewissen Lippen, ein Blick aus gewissem Auge tiefere Bedeutung, größeren Werth haben könne, als die süßesten Schmeicheleien einer ganzen Schar von Verehrern. Der Graf war nicht blind für den Eindruck, den er auf Christine’s Herz gemacht hatte. Es schmeichelte ihm, ihr ein wärmeres Interesse eingeflößt zu haben, dessen sich bisher kein anderer rühmen konnte, und er scheute sich nicht ein Gefühl in ihr anzufachen, das eine Quelle von Unglück für sie werden mußte. Christine Munk überließ sich unbefangen dem bestrickenden Zauber seiner Unterhaltung. In seinen Huldigungen sah sie, in Erinnerung seiner eigenen Worte, den Ausdruck einer Liebe, wie Ernst von Braunschweig sie seiner unglücklichen Cousine geweiht und aller Welt zur Schau getragen hatte, ohne darüber getadelt worden zu sein. In den Hof kreisen fehlte es nicht an Spötteleien über das minnig liche Verhältniß. Der König war durch das über seine Länder und Unterthanen eingebrochene Kriegsunglück so tief bekümmert, daß er die Veränderung in dem Wesen seiner Gemahlin nicht beachtete. Er war schon im März nach Laaland aufgebrochen und hatte von dort aus seinen mit Erfolg gekrönten Zug nach Fehmarn unter nommen, wo er die kaiserlichen verjagt und danach seine Reise erst nach Kiel, dann nach Stade fortgesetzt hatte, welches er vergeblich zu entsetzen suchte. Bei seiner Rückkehr fiel ihm jedoch die ritterliche Dienstbeflissen heit des Rheingrafen als unstatthaft auf und er harrte einer passenden Gelegenheit, um den unbequemen Gast zu entfernen.
An einem Vormittage, bald nach der Heimkehr desKönigs, hatte der Rheingraf Frau Christine einen Blumenstrauß gebracht und ein Stündchen in traulichem Geplauder bei ihr verweilt. Christine Munk stickte Blumen von Silber und Gold auf ein rothes Seidenband und lauschte dabei der Rede, die warm und eindringlich von es Grafen Lippen floß. Worüber er sprach, wollen wir nicht ergründen, doch mußten seine Worte ihr tief zu Herzen gehen, denn sie ließ die Arbeit in den Schooß sinken und verdeckte mit der Linken die Augen, aus denen helle Tropfen hervorperlten. Draußen in der Gallerie hörte man rasche, feste Tritte, und gleich darauf wurde in der heftig aufgestoßenen Thür die große kräftige Gestalt des Königs sichtbar.
„Ei, ei, Herr Graf, das konnte ich freilich nicht denken, daß Ihr hier zu finden wäret“, sprach Christian IV., in dem ein gezwungenes Lächeln seine Lippen kräuste. „Der arme Wenzel hat überall nach Euch gesucht und suchenlassen, weil wir Euch einladen wollten, der Musterung der Truppen beizuwohnen, welche morgen mit Jörgen Wind nach Glückstadt abgehen sollen.“
„Mir ward heute früh ein Strauß seltener Blumen angeboten, und da Ihro Gnaden die Blumen liebt, glaubte ich dieselben nirgend besser aufgehoben, als in ihren schönen Händen, weshalb ich sie ihr darzubringen wagte,“sagte der Graf unbefangen.
„Aha!“ äußerte der König, den schönen Cavalier mit scharfem Blicke vom Scheitel bis zur Ferse messend.
„Jetzt aber will ich Ew. Gnaden nicht länger mit meiner Gegenwart lästig fallen,“ fuhr Graf Solms, die gereizte Stimmung des Königs unbeachtet lassend, fort, griff nach seinem Hute von veilchenblauem Sammet, an dem ein kostbarer Rubin die Aufmerksamkeit des Königs erregte, verbeugte sich tief vor dem hohen Paare und schritt stolz zur Thür hinaus.
Christian IV. folgte ihm mit den Augen und wandte sich darauf an seine Gemahlin:
„Wo sind Deine Hofjungfern?“
„Ich weiß es nicht; sie werden wohl gleich erscheinen“, antwortete Christine verlegen.
„Ich wünsche, daß Du fortan keinen Besuch von Cavalieren in meiner Abwesenheit annehmest,“ sprach der König weiter.
„Ihr fordertet mich in Deutschland selbst dazu auf, die Offiziere Eures Heeres artig zu empfangen, mein Gemahl,“ erinnerte Christine schüchtern.
„Wir sind aber jetzt nicht mehr in Deutschland, und auch dort sagte ich niemals, daß Du Deine Frauen bei solchen Besuchen fortschicken solltest. – Wo sind die Kinder?“
„Bei ihren Wärterinnen, wie ich vermuthe.“
„Und diese Vermuthung beruhigt Dich. Ich traf die Zwillinge mit ihren Mägden im Thorwege, wo heute der scharfe Nordost seinen Durchzug hält, und die Kleinste hörte ich im Vorbeigehen so jämmerlich weinen, daß ich hineinging. Ich fand Wiebeke, welche bemüht war, sie zu beschwichtigen, – die Mutter hatte anderes zu thun.“
Christine Munk nahm den Vorwurf schweigend hin, doch erhob sie sich nach einer Weile und verließ das Gemach. Der König ging mit verschränkten Armen und festen Schritten im Zimmer auf und nieder; seine Stirn legte sich in tiefe Falten, ein wiederholtes Zwicken der Augenwinkel verrieth einen inneren Sturm. Er gedachte des kostbaren Steines an dem Barette des Grafen, desgleichen er nur einen kannte, der in seinem eigenen Besitze war. Er griff nach der Stickerei seiner Gemahlin, auf welcher die künstlich verschlungenen Blumenranken ihm den Anfang einer Namenschiffre zu bilden schienen, – und in ihm stieg ein Verdacht auf, der schon früher einmal in ihm wach geworden, aber den sein großmüthiges Herz als entwürdigend sofort zurückstieß. Er verließ das Zimmer, wo ein so peinlicher Argwohn ihm die Brust beengte; doch hatte er dort einen Entschluß gefaßt, der schon in den nächsten Tagen zur Ausführung gebracht wurde: er sandte seine Familie nach Kopenhagen.
Bisher hatte niemand mehr durch die häufigen Besuche des Rheingrafen gelitten, als Wiebeke Kruse. Ihrer Verschwiegenheit gewiß, hatte der schöne Cavalier in ihrer Gegenwart seine Worte nicht ängstlich erwogen, und die Sprache seines glühenden Herzens hatte ihr oft das Blut in die Wangen getrieben. Sie allein hatte gesehen, mit welcher Sorgfalt Frau Kirstin die Blumen frisch zu erhalten suchte, die er zu bringen pflegte, mit welcher Inbrunst sie die langen, feingeschriebenen Briefe an sich preßte, die nicht des Königs Handschrift trugen. Ihr reines Herz sagte ihr, daß ihre Gebieterin einen gefährlichen, sträflichen Weg wandle, und sie hatte tausendfach die Abreise des Grafen herbeigewünscht. Daher betrieb sie die Vorbereitungen zu der nah bevorstehenden Abreise nach Kopenhagen mit frohem Herzen und wollte sich eben mit einbrechender Dämmerung in die Zimmer ihrer Herrin begeben, als sie den Rheingrafen vor sich erblickte, der ein zierlich gefaltetes Briefchen in ihre Hand schob.
„Seid gütig, Wiebeke, gebt Ihrer Gnaden dies Blättchen. Ich werde michdankbar bezeigenfür diesen Dienst,“ bat er freundlich.
Wiebeke öffnete die Finger und ließ das Papier achtlos zu Boden fallen. „Ich biete niemals meine Hand zu unrechtem Thun“, sprach sie streng. „Wenn Ihr meine Gebieterin werth haltet, Herr, so solltet Ihr sie nicht in Gefahr bringen.“
Der Graf sah sie betroffen an.
„Was giebt’s?“ fragte die aus Frau Kirstin’s Schlafgemach tretende Dorthe.
„Ich wünsche einen Brief an die Gräfin Munk überbracht zu haben…“
„Und die Hofjungfer weigert sich ihre Schuldigkeit zu thun,“ ergänzte Dorthe. „Ew. Gnaden muß sich mit solchen Aufträgen nicht an die Jungfer wenden, die viel zu fein ist, um ihre Dienstobliegenheiten jemals kennen zu lernen. Wo ist der Brief?“
Wiebeke bückte sich nicht, um denselben vom Boden aufzunehmen. Sie überließ es dem Grafen und ging davon, während dieser der Alten seine schriftlichen und mündlichen Grüße zur Besorgung anvertraute.
IX.
Es war Winter und auch wieder Frühling geworden, und das Unwetter, welches an dem Horizonte des königlichen Haushaltes aufgestiegen, schien glücklich abgewendet, Dank der Klugheit des Königs, welcher neue Hausgesetze geschrieben und durch sie die Tagesstunden seiner Gemahlin besser ausgefüllt hatte. Er hatte zunächst die ältesten Kinder aus Holland heimkommen lassen und befohlen, daß sie außer den Lehrstunden in der Nähe der Mutter blieben und während seiner Abwesenheit auch mit ihr gemeinschaftlich speisten. Auch den geselligen Umgang seiner Gemahlin hatte er in der Kopenhagener Damenwelt selbst gewählt und für ihre Beschäftigung und Zerstreuung gleich zärtlich gesorgt. Ihre Beziehungen zu dem deutschen Grafen hatte er für eine flüchtige Neigung angesehen und glaubte sie durch eine rechtzeitige Trennung von dieser sentimentalen Anwandlung völlig geheilt zu haben. So schien alles wieder im rechten Geleise fortzugehen, nur bei Wiebeke wollte der harmlose Frohsinn nicht wiederkehren. Es schmerzte sie in tiefster Seele, daß sie sehen mußte, wie der Heiligenschein, der in ihrer Phantasie die schöne Stirn ihrer Gebieterin geschmückt hatte, seinen Glanz verlor, und wie schmählich man den König hinterging, denn nur allzu gut kannte sie die Schriftzüge auf den zahlreichen Briefen, welche an die alte Dorthe abgeliefert wurden und untrügliche Vorboten einer frohen Aufregung bei Frau Kirstin waren.
Christine Munk hatte den Rheingrafen seit ihrer Abreise von Dalum nicht wieder gesehen. Er war dem Könige gefolgt, als dieser bald darauf nach Stralsund ging, welches durch Wallenstein belagert war. Dort war er mit seinen zwei Reiterregimentern ans Land gestiegen und von dem Könige von Dänemark geschieden. Im Laufe des Winters war er im Interesse der bedrängten Protestanten als Sendbote an den schwedischen Hof gegangen, und in derselben Eigenschaft erschien er im Februar 1629 in Kopenhagen, wo er um eine Privataudienz beim Könige nachsuchte und dieselbe erhielt. Christian IV. hatte zwar das rothe Band nicht vergessen, welches der Graf, als er sich in Stralsund von ihm verabschiedete, auf der Brust trug, – dasselbe Band, welches Frau Kirstins Hände in seiner Gegenwart mit Gold- und Silberblumen bestickt hatten; aber er war großmüthig und hatte die Aufwallung der warmen, jugendlichen Herzen, die er längst vergessen wähnte, nachsichtvoll verziehen. Als er daher den Grafen, nachdem dieser seine Botschaft ausgerichtet hatte, fragte, ob er der Gräfin Munk seine Aufwartung zu machen wünsche, und dieser angelegentlich bejahte, führte er ihn selbst in die Gemächer seiner Gemahlin, welche sie in Gesellschaft ihrer Mutter und Kinder antrafen.
Frau Ellen hatte den Grafen Solms schon auf Fühnen kennen gelernt und zum Ueberdruß die Hofgeschichten hören müssen, welche seinen Namen mit dem ihrer Tochter in Verbindung brachten, weshalb sie diese wiederholt zu größerer Vorsicht in ihrem Benehmen gegen den schönen Cavalier ermahnt hatte.
Sie richtete beim Eintritte des Grafen ihr Auge forschend auf Frau Christine, welche durch das unerhoffte Wiedersehen so tief ergriffen ward, daß ihre Erregung auch dem Könige nicht entging und einen Schatten wehmüthigen Ernstes über seine eben noch so freundlichen Züge warf. Als der Graf, nachdem er die Gemahlin des Königs begrüßt hatte, sich Frau Ellen in derselben Absicht näherte schnitt diese seine zierliche Anrede mit den Worten ab:
„Ei, ei, Herr Graf, was führt Euch denn noch einmal nach dem kleinen Dänemark zurück? Ich dächte, das arme Deutschland beschäftigte seine tapferen Söhne so vollauf, daß sie die Ferne darüber vergäßen!“
„Wer einmal so glücklich war, in den schwimmenden Gärten der Ostsee als Gast zu weilen, träumt sich oft dahin zurück, noch lieber aber betritt er sie in der Wirklichkeit wieder,“ antwortete der Graf.
Gereizt durch den bedeutsamen Blick, den der Graf bei diesen Worten auf Frau Kirstin richtete, fuhr Ellen Marsvin fort:
„Es giebt aber Fälle, wo es ehrenhafter ist, die Stätte, wo wir gern weilen, zu meiden.“
Der Rheingraf biß sich in die Lippen und verschluckte die Antwort, als Frau Ellen weiter fragte:
„Wie lange denkt der Herr Graf hier zu bleiben und wohin geht sein Weg von hier?“
„Die Zeit für meinen hiesigen Aufenthalt ist kurz gemessen, doch wird der Weg, den ich von hier aus einschlage, hoffentlich der Pfad zu meinem höchsten Erdenglücke sein. Ihr werdet vielleicht davon hören, edle Frau.“
Jetzt war die Reihe zu verstummen an Ellen Marsvin. Sie fühlte einen Stachel in den Worten des Deutschen und wandte sich ab, um zu Wiebeke zu gehen, die sich mit den Kindern in das äußere Zimmer zurückgezogen hatte.
„Der Rheingraf ist ein interessanter Herr und da er so kurze Zeit hier bleibt, könntest Du mich wohl benachrichtigen, wenn er Ihre Gnaden besucht, damit ich das Vergnügen seiner Unterhaltung theilen kann,“ sprach sie.
„Sehr gern,“ erwiderte Wiebeke, einen hellen freundlichen Blick auf Frau Ellen richtend; „da ich aber bei diesem Besuche zufällig abwesend sein könnte, und weil der Herr Graf nur kurze Zeit hier bleibt, solltet Ihr, gnädige Frau, um ihn nicht zu verfehlen, täglich zu Ihrer Gnaden herüberkommen.“
Ellen Marsvin merkte, das Wiebeke sie verstanden habe, und sagte, ihr die Wange streichelnd: „Du bist ein braves Kind. Wollte Gott, daß die Dorthe von Deiner Art wäre!“ Danach verließ sie mit einem Seufzer das Zimmer.
Der Rheingraf sah Christine Munk während seiner diesmaligen Anwesenheit niemals allein, und selbst als er nach der Abschiedaudienz bei dem Könige sich zu ihr begab, war Ellen Marsvin bei dem letzten Besuche anwesend. Kein Wort, kein Blick, keine Bewegung entging ihrem spähenden Auge, und als sich nach einem Viertelstündchen die Thür hinter dem stattlichen Cavalier schloß, sagte sie leise zu sich selbst: „Der reist so noch nicht fort……“
Dies Wort drängte sich ihr im Laufe des Tages noch mehrmals auf die Lippen, und als es Abend ward und nächtliche Dunkelheit die trüben, ängstlichen Gedanken nährte, da überfiel sie eine qualvolle Unruhe. War der Graf wirklich abgereist? War der König, wie er beabsichtigt hatte, nach Friedrichsburg gefahren? Wie trug Christine die Trennung nach dem flüchtigen Wiedersehen, – warsie allein? – so jagten sich die Gedanken in ihrem lebhaft erregten Innern. Bald stieß sie das Fenster auf und lauschte in die Nacht hinaus, bald ging sie mit raschen Schritten in ihrem Zimmer auf und nieder, bis sie plötzlich einen raschen Entschluß faßte und, sich in ihren Mantel hüllend, allein von dem Flügel, in dem die von ihr bewohnten Zimmer lagen, durch lange Corridore und Treppen der Wohnung ihrer Tochter zuschritt. Sie wollte sie sehen oder doch der treuen Wiebeke einen Wink geben, über sie zu wachen.
Sie fand die Vorzimmer leer und näherte sich dem inneren Cabinette, aus dem ein schwacher Lichtschein hervordrang. Schon wollte sie die schweren Thürvorhänge zurückschlagen, als eine wohlbekannte Stimme ihr Ohr traf, die ihre Schritte an die Schwelle bannte.
„Geht, geht um des Himmels willen! Ich darf Euch nicht anhören!“ ließ sich Christine Munk’s Stimme vernehmen.
„Sprecht nicht so, Christine,“ erwiderte der Rheingraf. „Ihr liebt weder Euren Gemahl, noch dessen Kinder, die doch auch die Euren sind, das habe ich längst errathen. Was fesselt Euch denn hier! Das Gerede der Welt verhallt im Strome der Zeit; ein Entschluß, ein Wort von Euch legt den Grund zu Eurem und meinem Glücke. Der Wind ist günstig, mit Tagesanbruch lichtet das Schiff, welches uns nach Schweden führt, die Anker; von Schweden aus gehen wir nach Deutschland – und die ganze Welt, der Himmel ist unser!“
Christine hatte sich der Liebe, welche bei so gereiften Jahren zum ersten Male sich ihres ganzen Seins bemächtigte, hingegeben, ohne jemals zu fragen, ob sie nicht Unrecht an ihrem Gemahl begehe, und erst jetzt, wo der Geliebte sie aufforderte, mit ihm einem Glücke entgegenzueilen, so süß, wie sie es nie zu träumen gewagt, erst jetzt fühlte sie die Sündhaftigkeit ihrer Neigung, und nie zuvor hatte das treue, liebevolle Antlitz ihres königlichen Gemahls ihr so klar vor Augen gestanden.
„Graf,“ sprach sie mit fester Stimme, „daß ich Euch nicht folgen darf, werdet Ihr bei ruhigem Gemüthe selbst einsehen, denn Ihr seid welterfahrener, als ich. Macht mir darum den Kampf nicht schwer, schützt mich vor mir selbst. Verlaßt mich und ich werde Eurer stets in Liebe gedenken!“
„In schönen Worten giebt sich die Versicherung heißer Liebe allerdings leichter als durch muthvolle That,“ rief der Graf bitter. „Christine, ist es möglich, daß Du in dem Ausdrucke meiner Liebe nichts sahst als die gewöhnliche Huldigung, die man schönen Frauen zu zollen pflegt; war Dein Gefühl kein anderes, als laue Befriedigung weiblicher Eitelkeit: – so verzeihe Dir Gott das Spiel, das Du mit mir getrieben, denn er allein weiß außer Dir und mir, wie schwer Du an der Liebe, die göttlichen Ursprunges ist, gesündigt hast!“
„Nein, bei Gott, Ludwig, ich liebe Dich wahrhaft und treu,“ schluchzte Christine. Gern entsagte ich allem Glanze, allen Ehren, um nur für Dich zu leben, und müßte ich Noth und Armuth mit Dir theilen, wenn ich nicht meinem gütigen Gemahle so schweres Unrecht damit zufügte. Gönne mir Zeit. Ich schicke morgen die Dorthe zu Dir und lasse Dir sagen, zu welcher Stunde Du wiederkommen darfst. Bisher habe ich gedankenlos gehandelt, aber den Schritt, der über mein Lebensglück entscheidet, will ich zum wenigsten nicht unüberlegt thun.“
Ellen Marsvin hatte der Unterredung mit verhaltenem Athem gelauscht. Sie bebte vor der Gefahr, in die ihre Tochter sich stürzte; doch erkannte ihr kluger Sinn, daß mit dem verlangten Aufschub alles gewonnen sei, und ein schwerer Seufzer erleichterte ihr Herz. Derselbe verhallte indessen nicht ungehört. Drinnen erhoben beide horchend den Kopf.
„Wir sind nicht allein,“ flüsterte Christine. „Wie konnte ich Unglückliche nur vergessen, daß hier Wände und Thüren Ohren haben. Geh‘, ich beschwöre Dich, Ludwig, geh‘!“
Als der Graf zögerte, ihre Bitte zu gewähren, kam Frau Ellen ihrer Tochter mit einem absichtlichen Geräusche an den Thürvorhängen zu Hülfe, worauf er durch eine verborgene Thür verschwand und von der alten Dorthe in’s Freie geführt wurde.
Mit bekümmertem Herzen kehrte Ellen Marsvin in ihre Gemächer zurück, entschlossen, ihrer Tochter am nächsten Morgen das Gefahrvolle ihrer Lage vorzustellen und sie auf den Weg des Rechten zurückzuführen.
Als der König am folgenden Morgen von Friedrichsburg zurückkam und mit seinem treuen Freunde Wenzel Rothkirch auf dem Schloßhof stand, kam der kleine Christian Waldemar vergnügt die Treppe herabgesprungen.
„Geh‘ hinauf zu Deiner Mutter und sage ihr, es sei ein wahrer Frühlingstag heute, ich erwarte sie zu einem Spaziergange.
„Die Mama hat mich gerade fortgeschickt. Ich darf nicht hinein,“ antwortete der Kleine.
„Warst Du vielleicht unartig?“
„Nein, sie zankt mit der Großmama, und die weint,“ berichtete der Knabe.
Die Herren lächelten.
„Geh‘ dennoch hinauf. und bitte die Mama, herunterzukommen,“ befahl der König.
Ellen Marsvin war wirklich mit Tagesanbruch zu ihrer Tochter gegangen und hatte ihr den Abgrund,an dem sie stand, mit grellen Farben gezeichnet. Sie hatte ihr bewiesen, daß der Schritt, zu welchem der leichtsinnige Fremde sie verleiten wollte, Schmach über das Land, über den König und ihre Kinder bringen, aber keineswegs zu ihrem eigenen Glücke führen werden, da Pflichtverletzung und Treubruch an ihm hafteten.
Wohl fühlte Christine die Wahrheit der Worte ihrer Mutter, aber sie fand sich durch dieselben gedemüthigt, und, gereizt, daß ihre geheime Unterredung mit dem Freunde nicht ohne Zeugen gewesen sei, hatte sie der Mutter schroff geantwortet, daß sie alt genug sei, um ihre Handlungen selbst zu beurtheilen. Die Botschaft des Königs begrüßte sie daher als ein willkommenes Mittel die Unterredung zu unterbrechen und beeilte sich dem Befehle nachzukommen.
Als Wenzel Rothkirch das hohe Paar verlassen hatte und dieses von dem Schlosse nach dem Zeughause hinüberging, fragte der König: „Warum weinte Deine Mutter? *)( Dieses Gespräch, sowie alles, was sich auf den Rheingrafen bezieht, ist historisch., Anm. J.M.)
„Die Mutter ist thöricht,“ antwortete Christine. „Du weißt, daß sie, Wiebeke ausgenommen, keine Deutschen leiden kann. Bin ich freundlich gegen die deutschen Officiere, so geräth sie außer sich, und auf den Rheingrafen hat sie vollends ihren Haß geworfen, obgleich er ihr keine Veranlassung zu Mißvergnügen giebt.“
„Das muß anders zusammenhängen,“ entgegnete der König. „Hüte Dich, Frau, die Thränen der Eltern rächen sich an den Kindern, und man sah niemals, daß es denen, die ihre Eltern betrübten, lange wohl ging.“
„Warum meine Mutter ausnahmsweise an der Wiebeke Gefallen findet, ist mir auch ein Räthsel,“ begann Frau Kirstin wieder. „Sie hat sich sehr zu ihrem Nachtheile verändert, und die alte Dorthe behauptet, daß sie allein Schuld daran ist, daß die Mädchen sich jetzt so häufig widerspenstig zeigen und sich meinen Befehlen widersetzen.“
„Die Dorthe sollte ihre Zunge hüten und nicht Unschuldige verleumden,“ sprach der König. Wenn die Mägde nicht thun was Du befiehlst, so verlangst Du wahrscheinlich Sachen, die meinem Befehle widersprechen. Du hast während meiner Abwesenheit mehre Paragraphen der Hausordnung umgestoßen getrachtet, wodurch der regelmäßige Gang der übrigen bedroht wurde, und da ist es nicht die Hofjungfer Wiebeke, sondern der Kronprinz Christian, welcher den Mägden befohlen hat nichts zu thun, was meinen ausdrücklichen Geboten zuwider ist.“
Christine erblaßte. Daß ihre Schritte so bewacht seien, hatte sie niemals geahnt. Eine bis dahin ungekannte Bitterkeit, ein eisiger Hauch berührte ihr Herz, und von stundan ging eine Veränderung in ihr vor, die nicht ohne Bedeutung für ihre späteren Lebensschicksale blieb.
Der Vorwurf aus dem Munde des Königs, von welchem Christine Munk sich schwer getroffen fühlte, war bei ihm nur der milde Ausdruck eines herben Kummers gewesen, der seit lange an seinem liebreichen und liebbedürftigen Herzen zehrte. Gleichwie er für die Dauer seines oftmaligen Aufenthaltes bei der Armee den Kronprinzen mit der Leitung der Regierungsgeschäfte betraut hatte, so empfahl er auch Frau Kirstins Haushalt seiner Aufsicht und seinem Schutze. Prinz Christian besaß viele liebens- und schätzenswerthe Eigenschaften, die ihn zum Lieblinge des Volkes gemacht hatten. Er war der Gemahlin seines Vaters herzlich zugethan gewesen, obschon sie ihm weder als Gattin, Mutter, noch Hausfrau die Achtung einflößte, die ihr in ihm einen schätzbaren Freund und Vertheidiger gesichert hätte. Die Unordnungen in Christine’s Haushalt, die Nichtachtung des königlichen Willens und viele andere Dinge konnten dem wachsamen Auge des Prinzen nicht verborgen bleiben. Friede und Freude waren aus der Umgebung dieser Frau gewichen. Seitdem der Rheingraf, der sie noch mehrmals heimlich besucht hatte, im Zorne von ihr geschieden war, fühlte sie sich unsäglich unglücklich. Statt in freudigem Stolze über den über das eigene Ich errungenen Sieg ihr Herz fortan ihrer blühenden Kinderschar zuzuwenden, sah sie in ihnen nur ein Hinderniß ihres Glückes, betrachtete sie sich nur als Märtyrerin ihrer Liebe. Und seitdem sie erfahren, daß ihre Schritte und Handlungen überwacht seien, war der letzte glimmende Funke von Zuneigung zu ihrem Gemahle erloschen, sah sie in allen Dienern nur von dem Könige besoldete Spione. Unzufrieden mit ihren Verhältnissen und mit ihrer Umgebung, bereitete sie letzterer täglich Verdruß und mußte auf die oftmals ungerechten Vorwürfe achtungswidrige Antworten der Mägde anhören, die dann zu neuen Zornausbrüchen Anlaß gaben.
Obgleich der Prinz zu vernünftig und edel war, um dem Könige alle diese kleinlichen Mißhelligkeiten zu hinterbringen, so erfuhr derselbe doch von dem Rentmeister, daß seine Gemahlin wiederholt beträchtliche Summen zur Kleidung für die Fräulein erhalten habe, obschon dieselben nicht einmal ordentlich, viel weniger standesgemäß gekleidet gingen; hörte er doch von anderer Seite, daß die Töchter sich meistens bei den Jungfern und Mägden aufhielten, mit ihnen an einem Tische äßen, während Frau Kirstin mit ihren Freundinnen tafelte; aller anderen Nachrichten nicht zu gedenken, die das Herz des Königs mit Schmerz und Bitterkeit füllten.
——————-
Mehre Wochen waren seit der Abreise des Grafen Solms verstrichen, als der König eines Tages eilfertig bei seiner Gemahlin eintrat mit der Frage: „Wo hast Du die Spitzenkragen, die ich in Deutschland kaufte und Dir in Verwahrung gab?“
„Sie werden mit der feinen Wäsche in dem Behältnisse liegen, welches Ihr mir in Wolfenbüttel einhändigtet,“ antwortete Christine Munk gelassen.
„Ich wünsche sie zu haben.“
„Jetzt?“
„Gleich, in diesem Augenblicke,“ rief der König ungeduldig, und nun erst gewahrte Christine an dem Zwicken der Augen, daß bei ihrem Gemahle ein Sturm im Anzuge sei.
Sie erhob sich, um die Dorthe zu rufen, und wiederholte vor derselben den Befehl des Königs.
„Ew. Gnaden wolle gefälligst erinnern, daß ich mit dem Gepäcke nichts zu thun hatte, darüber kann Wiebeke allein Auskunft geben,“ erklärte die Alte.
„So schicke die Wiebeke zu mir.“
„Wo ist der Kasten mit der feinen Wäsche des Königs, den ich in Stade Deiner Obhut anvertraute?“ fragte Christine die eintretende Hofjungfer.
Wiebeke Kruse richtete einen langen vorwurfsvollen Blick auf die Gräfin Munk, ohne zu antworten.
„Weißt Du nicht, daß Du Deiner Herrin Antwort schuldig bist?“ rief der König, heftig mit dem Fuße stampfend.
Wiebeke verneigte sich mit bejahender Geberde, doch ohne zu antworten. In Christine’s Herz erwachte ein Funken früheren Wohlwollens, denn sie wußte, daß das junge Mädchen ihr zu Liebe schwieg.
„Denk‘ einmal nach, Wiebe,“ sprach sie, „befand sich nicht dieser Kasten bei dem Gepäcke, welches auf der Reise von Büsum nach Flensburg verloren ging?“
„Nein, Ew. Gnaden,“ antwortete Wiebeke leise, aber fest. Christine merkte, daß Wiebeke sie nicht verstehen wollte, und der Unwille gegen die Holsteinerin, den Dorthe endlich in ihr Herz zu pflanzen gewußt hatte, regte sich von neuem.
„Wenn Du das so bestimmt behauptest, mußt Du auch wissen, wo er geblieben ist.“
Wiebeke schwieg.
„Ruf‘ die anderen Mägde!“ befahl der König, seinen Zorn mit Mühe bemeisternd.
Als die Gerufenen eintraten, fragte er selbst: „Wer von Euch kann mir sagen, wo sich der kleine, mit Messing beschlagene Reisekoffer befindet, den Ihr unter Frau Kirstin’s Reisegepäck gesehen haben müßt?“
„Wo derselbe jetzt ist, weiß ich nicht,“ begann eine der Mägde. „Ich sah ihn zuletzt in Dalum, als ich ihn eines Tages zu Ihro Gnaden hineintragen mußte, welche ihn auszupacken begann, als ich aus der Stube ging.“
„Ihro Gnaden wird erinnern, daß ich den Inhalt in die Schränke legen mußte,“ fiel die andere Magd ein. „Ich bewunderte die kostbaren Spitzenkragen, von denen der Rheingraf Tags darauf einen trug.“
Der König wandte sich ab, Christine Munk war kaum ihrer Sinne mächtig.
„Freche Dirnen, schamlose Lügnerinnen!“ rief sie außer sich. „Fort aus meinen Augen, fort aus meinem Dienste! Se. Majestät erfährt jetzt, mit welchem Gesindel ich mich habe abplagen müssen. Geht!“ herrschte sie, als die Mädchen, wie von Schreck gelähmt, stehen blieben und erst als der König sich umwandte und gebieterisch auf die Thür zeigte, verließen sie schluchzend das Zimmer.
Wiebeke allein war zurückgeblieben. Aus ihren sonst so frischen Wangen war alle Farbe gewichen. Stumm und starr ob des Geschehenen vergaß sie sich zurückzuziehen, als der König mit der Frage vor sie hintrat: „Haben die Mägde die Wahrheit gesprochen?“
Wiebeke senkte schweigend die Augen.
„Da seht Ihr, wie hartnäckig sie ist,“ rief Frau Kirstin dazwischen. Allein sie brauchte den König nicht mehr zum Zorn zu reizen, seine Geduld war lange zu Ende, und er schüttelte kraftvoll Wiebeke’s Arm, indem er rief: „Mädchen, vergißt Du, daß Du vor Deinem Könige stehst und daß er Dich strafen kann, wenn Du ihm ungehorsam bist?“
Da kehrte Wiebeke die Besinnung zurück. Weinend stürzte sie in die Knie und bat, die Augen flehend zum Könige erhebend: „Gnade, Majestät, zwingt mich nicht zu einer Antwort, die Ihr nimmermehr vergessen, nimmer verschmerzen würdet!“
„Hört Ihr, sie bittet um Gnade; um Gnade bittet nur, wer sich schuldig fühlt,“ rief Christine Munk.
„Sprich Kind und gestehe, wenn Du in Deinen Dienstobliegenheiten gefehlt hast. Es soll Dir verziehen werden“, sagte der König mit milderem Tone.
Als Wiebeke trotzdem in Schweigen verharrte, fuhr er fort: „So gehe denselben Weg, den eben Deine Genossinnen gingen. Daß ich mich auch in Dir, dem anscheinend so kernbraven Mädchen, getäuscht sehen muß, schmerzt mich. Derartige Erfahrungen machen mich nicht milder gegen meine Unterthanen. Geh‘, Trotzkopf, erzähle daheim, daß Dein König Dich in Ungnade fortgejagt hat!“
Das war zu viel für Wiebeke. Kaum traute sie ihren Ohren; doch belehrte sie ein Blick auf den König und dessen Gemahlin, daß sie von ihnen nichts mehr zu hoffen habe. Sie verneigte sich tief, Thränen entquollen ihren Augen, und sie flüchtete sich verzweiflungsvoll in ihre Kammer.
König Christian ging mit verschränkten Armen auf und nieder. Der Sturm in ihm war noch keineswegs beschwichtigt, ersuchte vielmehrihn gewaltsam zu bekämpfen. Endlich näherte er sich seiner Gemahlin und sprach, sie mit vorwurfsvollem Blicke betrachtend: „Christine, ich habe lange geduldet und geschwiegen, hoffend, Du werdest von der Verirrung Deines Herzens zurückkommen, ohne daß die Welt Zeuge derselben werde. Daß Dein Betragen so thöricht, so offenbar war, daß Deine Mägde sich erdreisten, Dich an die schmachvollen Einzelheiten zu erinnern, das beschimpft nicht allein Dich, sondern auch mich und mein königliches Haus“.
Wiederum ging er einige Male im Zimmer hin und her und fuhr dann, nicht ohne sichtliche Anstrengung, fort: „Ich fragte Dich nach den Spitzen und gedenke dabei der Kleinodien und des Silbergeräthes, welches ich einst Deiner treuen Obhut anvertraute. Willst Du mir gefälligst sagen, wo sich dasselbe befindet?“
„In jenem Schranke,“ flüsterte Christine.
„Habe die Güte ihn zu öffnen.“
Christine ging mit schwankenden Schritten nach dem Schranke und öffnete ihn mit einem Schlüssel, den sie nebst anderen an einem Ringe trug.
Christian IV. verglich die einzelnen Gegenstände mit der vorhandenen Liste und sagte: „Hier fehlen verschiedene Sachen.“
„Ich hoffe, daß Ew. Majestät nicht mich für das Fehlende zur Rechenschaft ziehen wird,“ erwiderte Christine. „Bei dem unstäten Leben, welches wir seit den letzten Jahren führten, kommt manches abhanden, unredliche Dienstboten kann niemand überwachen, und Ihr hattet eben selbst Gelegenheit zu sehen, mit welchem Gesindel ich umgeben gewesen bin.“
„Christine!“ rief Christian IV. streng, „ich hätte aus Deinem Munde eine Fürsprache für die armen Geschöpfe erwartet, die ich im Zorn, vielleicht in ungerechtem Zorn aus dem Dienste jagte und für welche niemand ein gutes Wort einlegen wird, nachdem meine Ungnade sie getroffen. Statt dessen bist Du grausam genug, ihnen eine Anklage nachzuschleudern, die sogar ihre unbescholtene Ehre antastet – das ist herzlos!“
Nach einer Pause fuhr er, unter verschiedenen kostbaren Steinen suchend, fort:
„Ich vermisse den schönen Rubin, der an dem Hosenbandorden saß, welchen Carl Morgan mir in Stade vom Könige von England überbrachte. Er war so selten schön, daß ich nur einmal seinesgleichen sah, nämlich an dem Federhute des Rheingrafen. Hast Du dies niemals bemerkt?“
Christine Munk schüttelte verneinend das Haupt.
„Sonderbar! Ihr Frauen pflegt doch sonst ein scharfes Auge für solche Dinge zu haben. Sahst Du denn auch nicht, daß der Knopf, der den Kragen des Grafen zierte, jenen Kragen, der den von mir gekauften so ähnlich war, eine orientalische Perle umfaßte, die an Größe und Reinheit der meinigen glich, die ich hier vergeblich suche?“
Christine war unfähig, zu antworten.
„Als ich diese Werthsachen in Deine Hände legte, geschah es, um Dir, falls ich plötzlich sterben sollte, ein Capital zu hinterlassen, welches Dir die Sorge für die Erziehung Deiner Kinder erleichtern sollte. Daß Du schon bei meinen Lebzeiten darüber verfügen würdest, fiel mir freilich nicht ein.“
Wieder schwieg der König einige Secunden und fuhr dann weich, fast wehmüthig fort:
„Fünfzehn Jahre lang habe ich Dich treu und warm geliebt, habe Dir für manche schöne Stunde zu danken, habe Deiner menschlichen Schwäche gern verziehen, – aber mit einer pflichtvergessenen und obendrein unwahren, herzlosen Frau vermag ich künftig nicht zu leben. Du wirst fortan Muße haben, über Deine Vergangenheit nachzudenken, und wirst Dir täglich gestehen müssen, daß ich Dich treu und zärtlich im Herzen getragen und daß Du das Band, das uns vereinigte, gewaltsam zerrissen hast!“
Christine Munk war vernichtet auf einen Stuhl gesunken. Das Antlitz mit beiden Händen bedeckend, gewahrte sie nicht den langen, schmerzvollen Blick ihres Gemahls, nicht die Thräne, die in seinen Wimpern zitterte, bevor er die Thür leise hinter sich schloß.
——————
Es ist eine alte, oft bewährte Erfahrung, daß in der materiellen, wie in der moralischen Welt geringfügige Kleinigkeiten Anlaß zu großartigen Katastrophen geben können. Der oben beschriebene Auftritt bei Christine Munk war durch ein Zerwürfniß zwischen dem Kammerdiener des Königs und der alten Dorthe herbeigeführt worden. Um sich an ihr zu rächen, hatte er den König beim Ankleiden an die schönen deutschen Spitzen erinnert, mit dem Bemerken, daß der Rheingraf eben solche trage, und erst als die Magd ihrer Gebieterin die beschämende Wahrheit sagte, dachte der König auch des Edelsteines, welcher einst seine Aufmerksamkeit und seinen flüchtigen Argwohn geweckt hatte.
Nach einer schlaflosen Nacht erhob sich der König, seiner Gewohnheit nach, zu früher Stunde von seinem Lager und machte um die qualvollen Gedanken abzuschütteln, einen Ritt ins Freie. Mit anbrechendem Tage kehrte er heim und ging eben über den Schloßhof, als er in der Morgendämmerung Frau Ellen Marsvin erkannte, welche eilfertigen Schrittes ihm entgegenkam.
„Was tausend Donnerwetter bringt Euch so früh aus den Federn?“ fragte der König. *)(Dies Gespräch ist, wie noch einige andere nach den eigenhändigen Aufzeichnungen des Königs wiedergegeben., Anm. J.M.)
„Ich wünschte mit Ew. Majestät allein zu sprechen,“ antwortete Frau Ellen.
„Das kann geschehen, hier hört uns niemand,“ versetzte der König.
Als sie darauf im Provianthofe auf- und niedergingen, begann Frau Ellen: „Ew. Majestät hat gestern die deutschen Mägde fortgejagt, und es ziemt mir nicht, zu beurtheilen, ob es recht war, sie so hart zu strafen, weil sie der Wahrheit gemäß die Frage beantworteten, welche Ew. Majestät an sie richtete, besonders da die Hofjungfer auffälligerweise dieselbe Strafe erlitt, weil sie diese Antwort nicht geben wollte.“
Als der König schwieg, fuhr sie fort: „Eine zweite Hofjungfer, wie Wiebeke, bekommt Christine niemals wieder. Wiebeke hat in der letzten Zeit viel von den Launen ihrer Herrin zu leiden gehabt, ohne sich jemals darüber zu beklagen. Sie hat vielmehr treu über sie gewacht, hat ihr treu gedient und ist in jeder Hinsicht ein braves Mädchen, ohne Lug und ohne Falsch. Jetzt sitzt sie in ihrer Kammer und stützt verzweifelt den Kopf, weil sie nicht weiß, wo sie ein Unterkommen suchen soll. Will Ew. Majestät gnädigst erlauben, daß ich sie mit mir nehme?“
„Warum nicht?“ versetzte der König. „Das Mädchen ist frei, hier kann es nicht bleiben und ich kann ihm keinen Dienst suchen.“
Frau Ellen dankte und entfernte sich.
König Christian war mit Frau Ellen’s Vorschlage zufrieden. Er hatte seit gestern mehrmals an Wiebeke’s alten Vater denken müssen, der ihm das Wohl seiner Tochter so dringend ans Herz gelegt hatte. Daß sie an den Unordnungen in seinem Hause Schuld sei, hatte er nie geglaubt, allein ihr hartnäckiges Schweigen hatte ihn gereizt und zu dem harten Spruche verleitet, den er bereute, aber nicht zurücknehmen konnte.
„Ich muß fort von hier!“ sprach er halblaut vor sich hin. „Es geht mir bald wie den alten Vikingen, die nicht unter rußigem Dache schlafen konnten. Draußen bei meinen tapferen Soldaten, oder wenn ich den frischen Seewind über meine Wangen streicheln lasse, wird das kranke Herz schon gesunden!“ Darauf rüstete Christian IV. zu einem neuen Unternehmen wider den noch immer in seinen Ländern hausenden Feind.
X.
Die Elbherzogthümer und das dänische Festland seufzten unter dem eisernen Drucke der Kriegslasten. Bürger und Bauern waren nicht mehr Herr in ihrem Hause, wo mit ihrem Eigenthum fremde Soldaten nach Belieben schalteten. Wohin man sah: rohe Gewaltthätigkeiten, Thränen, Klagen und Jammer aller Art, wozu in einigen Ortschaften obendrein der Mangel an Lebensmitteln fühlbar zu werden begann. Der strenge, finstere Winter war ein passender Rahmen zu diesen Schreckensbildern gewesen; aber nach ihm kam, mit der ganzen Sorglosigkeit der Jugend, der Frühling ins Land. Was kümmerten ihn die zerstampfte Wintersaat, die unbestellt gebliebenen Felder? Auf dem unbesäeten Acker zauberte er Blumen in allen Farben hervor, in die Dornen streute er hellrothe Rosen, ermahnte die Sänger in Bäumen und Hecken zu munterem Gesange und versuchte selbst in die gramerfüllten Gemüther neuen Muth zu lächeln. Wo ist ein Menschenherz so tief gebeugt, daß es dem sonnigen Strahle der Hoffnung unzugänglich wäre! Der Lenz kam vom Süden her ins Land; vom Süden kamen auch die auftauchenden Gerüchte, daß der Kaiser nicht abgeneigt sei mit dem Dänenkönige Frieden zu schließen, wenn dieser sich den gestellten Bedingungen unterwerfen wolle.
Auf den dänischen Inseln grünten und blühten Wald und Flur wie in glücklicher Friedenszeit. In den warmgelegenen Gärten des adligen Gutes Kjaerstrup auf Fühnen hatte der Mai einen Blumenflor entfaltet, den sonst erst der Juni zu bringen pflegte. In den grünen Laubgängen dieses Gartens lustwandelte, in tiefes Sinnen versenkt, eine junge Dame, als am Ende des Steiges ein spanischer Fliederstrauch ihre Aufmerksamkeit auf sich zog. Sie bog die Blüthenzweige herab und sog begierig den würzigen Duft derselben ein. Auch diese Blumen schienen mit ihren Gedanken in Verbindung zu stehen oder ferne Erinnerungen wachzurufen, denn ihre Blicke hafteten unverwandt auf den blauen Blumensternen, bis sie durch aufquellende Thränen verdunkelt wurden.
Es war Wiebeke Kruse, die wir hier in modischem Kleide als Dame wiederfinden. Frau Ellen hatte vollendet, was ihre Tochter einst begonnen, indem sie Wiebeke als ihre Gesellschafterin in ihr Haus eingeführt, und Wiebeke machte ihrer neuen Stellung Ehre. Der gediegene Kern ihres biederen festen Charakters hatte ihrem äußeren Wesen von je her das Gepräge ruhigen Selbstbewußtseins verliehen. In den vier Jahren, die sie bei der Gräfin Munk verlebt, hatte sie den äußeren Schliff angenommen, so daß ihr tactvolles anspruchsloses Benehmen keinen Verstoß gegen die Sitten der vornehmen Welt machte. Ihre äußere Erscheinung hatte durch diese Umwandlung nicht gewonnen. Ihr Gesicht war vielleicht zu voll und rosig, um auf Schönheit Anspruch machen zu können. Schlug sie aber die klaren, nußbraunen Augen auf, so wurde man durch den Blick so wunderbar gefesselt, daß man die unschönen Züge gar nicht bemerkte. Wer sie beschreiben wollte, wußte sich nur des strahlenden, sprechenden Augenpaares zu erinnern, und vergaß, was ihr sonst an Schönheit mangelte.
Seitdem Wiebeke Kruse sich unter Frau Ellen’s Schutze befand, waren ihre Gedanken oftmals in die Heimath geflogen. Sie sagte sich, daß ihr Vater mit ihrer jetzigen Stellung nicht einverstanden sein würde; sie fühlte sich selbst nicht befriedigt, obgleich die neue Lebensweise ihr sehr wohl zusagte. Frau Ellen, die sich an jenem Unglückstage, der sie von der Gräfin Munk trennte, wie ein rettender Engel ihrer angenommen hatte, schien sich ihrer Gesellschaft so zu freuen, daß Wiebeke nicht den Muth hatte, zu erklären, daß sie einen Wirkungskreis wünsche, der ihren Tag nützlicher ausfülle.
Ellen Marsvin war eine reiche angesehene Frau, die, wie bereits früher erwähnt wurde, die Verwaltung ihrer in Fühnen und Jütland belegenen Güter selbst leitete und schon deshalb zu rastloser Thätigkeit genöthigt war. Der Tag verging ihr mit Audienzen an Inspectoren, Pächter, Gärtner, Waldhüter, Haushälterinnen, Meierinnen u.s.w., mit Promenaden in Wälder, Aecker und Wiesen, in die Kornspeicher, Viehställe und Milchkeller; denn keine Veränderung, keine Verbesserung durfte vorgenommen werden, ohne ihr gemeldet und von ihr sanctionirt worden zu sein. Lieferungen von Naturalien an die Krone, Geldgeschäfte, Viehhandel in großartigem Maßstabe machten ihren Namen in der Geschäftswelt bekannt und berühmt, und dieser Sinn für haushälterische Interessen, verbunden mit ihrer bei Frauen seltenen Geschäftsklugheit und Energie, waren es, welche ihr die Achtung und Freundschaft des Königs gewonnen hatten. Wenn nun Christian IV. die Mutter seiner Gemahlin werth hielt, so erwiderte sie diese Zuneigung mit der innigsten Verehrung seiner Person, mit der wärmsten Bewunderung seines so vielseitig und reich begabten Geistes, seines liebevollen Herzens, und niemals konnte sie ihrer Tochter verzeihen, daß sie dem Manne, der mit Nichtachtung aller Standesvorurtheile sie über alle Frauen des Landes emporgehoben und auf den ehrenvollen Platz an seiner Seite gesetzt, nunmehr so übel vergolten habe.
Ellen Marsvin war in ihrem Arbeitszimmer beschäftigt gewesen ein Schreiben, welches ihr durch einen Courier überbracht worden, zu beantworten, und begab sich, nachdem sie den Boten expedirt hatte, in den Garten, wo sie Wiebeke unter dem Fliederstrauche fand und sie durch einen kräftigen Schlag auf die Schulter ihren Träumereien entriß.
„Was stehst Du hier wie ein mondsüchtiges Jüngferchen und schwatzest mit den Blumen, die Dich doch nicht verstehen,“ scherzte sie. „Ist es die Einförmigkeit des Landlebens, welche Dich so kopfhängerisch macht, so wird die Nachricht, die ich Dir bringe, Dich schon curiren. Wir bekommen Besuch von…, rathe einmal von wem?“
Als Wiebeke fragend zu ihr aufsah, aber durch ein leichtes Kopfschütteln andeutete, daß sie es nicht errathen könne, fuhr Frau Ellen fort: „Sr. Majestät wird nebst Gefolge auf einige Tage mein Gast sein“.
„Der König?“ rief Wiebeke, sich entfärbend.
„Warum erschrickst Du darüber? Macht es Dir nicht Freude, ihn wiederzusehen?“
Als Wiebeke verlegen schwieg, fuhr sie fort: „Nun, ich verstehe Dich schon. Sollte Se. Majestät, was ich jedoch nicht glauben kann, Dir nicht gnädig gesonnen sein, so bleibst Du in Deiner Kammer. König Christian ist ein Brausekopf, ganz wie Ellen Marsvin, aber wenn der jäh auf lodernde Zorn auch für eine Weile die Klarheit unseres Blickes trübt, so sehen wir hinterdrein nur desto schärfer, wo wir Unrecht begangen und durch unsere Heftigkeit gekränkt haben. Jetzt mußt Du mir behülflich sein bei den Vorbereitungen zum Empfange unserer Gäste. Käme der König allein, so würde ich keinen Finger darum rühren; er macht weniger Umstände als wenn mein Bruder Jörgen mit seiner Frau kommt; aber sich, Kind, der Komet hat einen Schweif, und wehe mir, wenn ich den Kammerdiener Sr. Majestät mit dem Diener des Hofmarschalls oder den Leibkutscher und den Reitknecht mit dem Stallknechte in ein Zimmer betten oder an einen Tische setzen würde!“
„Kommt der König denn mit so zahlreichem Gefolge?“ fragte Wiebeke.
„Ich habe Se. Majestät ersucht, dies nach eigener Bequemlichkeit zu bestimmen; das Haus ist ja groß genug. Wennauch die Generäle Holkund Schlamersdorfin Svendborg bleiben, so werden sie doch häufig hierherkommen, so daß wir Zimmer für sie bereit halten müssen. Oberst Oynhausen und der Hofmarschall Rothkirch werden gewiß kommen, denn letzterer folgt, seitdem er nach der Schlacht bei Lutter wohlbehalten wieder in Wolfenbüttel angelangte, dem Könige wie sein Schatten.“
„Und die Truppen, die auf Fühnen zusammengezogen wurden, sollen wirklich nach Schleswig hinüber?“
„Das war vorauszusehen. Als ich hörte, daß die 6000 Mann unter Morgan, die von Schonen abgingen, in Eiderstedt gelandet seien, da dachte ich gleich, daß der König von Osten in Schleswig einfallen und, sich mit Morgan vereinigend, einen Cordon quer über das Land ziehen wolle: da würden die Kaiserlichen in Jütland wie die Maus in der Falle sitzen!“
„Aber wie kann der König auf’s neue die Feindseligkeiten beginnen, da er seine Räthe in Lübeck an den Friedensunterhandlungen Theil nehmen läßt?“
Kind, von der Politik verstehst Du bei aller Deiner Klugheit so gut wie gar nichts. Leuchtet Dir nicht ein, daß das Gelingen eines Manövers, durch welches die kaiserlichen Truppen in Jütland von der Hauptmacht abgeschnitten würden, den Gegenvorstellungen des Königs mehr Nachdruck verleihen, als die weisesten Reden seiner Gesandten?“
Wiebeke nickte zustimmend mit dem Kopfe, und Frau Ellen schickte sich an, ihre belehrenden Auseinandersetzungen weiter auszuspinnen, als sie abermals ins Haus gerufen ward, wohin ihr Wiebeke folgte, um bei den häuslichen Anordnungen hülfreiche Hand zu leisten.
König Christian IV. kam früher als er erwartet war nach Kjaerstrup und zwar, wie Frau Ellen richtig vorhergesagt, in Gesellschaft seines Stallmeisters und Hofmarschalls Wenzel Rothkirch. Nachdem er seine Schwiegermutter begrüßt hatte, zog er sich in seine Gemächer zurück um der Ruhe zu pflegen; doch sah man ihn schon nach einer Stunde mit dem Hofmarschall im Garten lustwandeln und einen Pavillon aufsuchen, den er von seinen früheren Besuchen her erinnerte. Als er auf dem Wege dorthin in eine Kastanienallee einlenkte, erblickte er am Ende derselben eine Dame in himmelblauem Kleide, welche sich, als sie der Herren ansichtig wurde, hinter dem Gebüsche zu verbergen suchte.
„Ei, ei, was hält denn Frau Ellen hier für Nymphen versteckt, die wollen wir nicht ungesehen entwischen lassen!“ rief der König, die Schritte verdoppelnd. Und seine Ueberraschung, sein Erstaunen war nicht gering, als er in der feinen Dame Wiebeke Kruse wiedererkannte. Er reichte ihr freundlich die Hand, die Wiebeke ehrerbietig an ihre Lippen zog, und sprach dann, sie wohlgefällig betrachtend:
„Gelt, Wenzel, in dieser veränderten Gestalt hätten wir die kleine Wiebe, die wir in Bramstedt von der Waschbrücke holten, kaum wiedererkannt!“
„Die Veränderung besteht nur in den feinen Kleidern,“ versetzte Wiebeke mit Würde. „Dem Inneren nach bin ich so wenig verändert, daß ich, wenn es sein müßte, zu jeder Zeit nach der Waschbrücke zurückkehren und dort, wie ich glaube, meinen Platz nützlich ausfüllen könnte.“
„Immer eine schlagende Antwort in Bereitschaft,“ sagte der König lachend. „Wer hätte gedacht, daß wir dies Mädchen aus unserem Haushalte entfernen würden, weil es uns n i c h t antworten wollte!“
Als er merkte, daß Wiebeke sich durch diese Worte schmerzlich berührt fühlte, setzte er, zu Rothkirch gewandt, hinzu: „Geh‘ ein Weilchen hier auf und nieder und warte meiner, ich habe ein Wörtchen mit Wiebeke allein zu reden.“
Nachdem er mit dem jungen Mädchen in den Pavillon getreten war, fragte er:
„Welches Amt verwaltest Du in Frau Ellen’s Hause und welchen Gehalt beziehst Du?“
„Ich verwalte kein Amt, Frau Ellen betrachtet mich nur als Gast, weshalb ich auch keinen Gehalt beziehe, obwohl die gnädige Frau mich mit Wohlthaten überschüttet.“
‚ „Bist Du mit dieser Stellung zufrieden?“
„Wenn es nicht allzu undankbar schiene, würde ich mit Nein! antworten. Das Leben als vornehme Dame gefällt mir so gut, als wäre ich im seidenen Röckchen geboren, und dennoch sagt mir täglich eine Stimme, daß ich nicht im Müßiggange fortleben darf, so lange ich jung und kräftig genug bin, für mich selbst zu sorgen. Ich bin vielleicht zu stolz, um Gnadenbrod zu essen, wenn es auch überzuckert ist und warte nur einer passenden Gelegenheit um Frau Ellen dies zu verkünden.“
„Und nach Deiner Heimath willst Du nicht zurück?“
Wiebeke schüttelte verneinend den Kopf.
„Warum nicht?“
„Ew. Majestät müßte selbst auf dem Lande gelebt haben, um dies zu verstehen. Man hegt dort ein an Verachtung grenzendes Mißtrauen gegen alles Fremde. Ein Aufenthalt im benachbarten Dorfe beeinträchtigt schon das Vertrauen, eine jahrelange Abwesenheit in fremdem Lande aber entfremdet das Dorfskind so sehr, daß man es kaum wieder als solches aufnimmt. Ja, ich möchte behaupten, daß man einen Fehltritt, der unter den Augen des Dorfes begangen wurde, eher vergiebt und vergißt, als daß man einen aus der Fremde Heimkehrenden wieder als zu den Seinen gehörend betrachtet. Käme ich nach Föhrden zurück, so würden die Erwachsenen mir Erlebnisse andichten, von denen ich selbst nichts weiß, die Kinder würden mit Fingern auf mich zeigen, und meine Eltern würden es als einen Schimpf fühlen, daß ihre Tochter in’s Gerede gekommen sei, und lieber würde ich heimathlos umherirren, als unter solchen Verhältnissen in’s Vaterhaus zurückzukehren.“
Der König fühlte, daß sie Recht habe; aber er fühlte auch zugleich, daß sie auf seine Veranlassung die Ihrigen verlassen, daß er sie dadurch der Heimath beraubt habe und folglich verpflichtet sei, für ihre Zukunft zu sorgen.
„Wir sprechen uns noch vor meiner Abreise,“ sagte er, den Pavillon verlassend und zu Frau Ellen tretend, die mit dem Hofmarschall bereits einige Male die Allee auf- und abgeschritten war.
Wiebeke hatte nach dieser Unterredung ihre vorige Heiterkeit wiedergewonnen. Die Zeit bis zur Abreise des Königs waren Festtage für sie. Ihre scharfsinnigen, witzigen Bemerkungen, ihr lebhaftes unbefangenes Geplauder belustigten den König über die Maßen, und Frau Ellen’s geistvolle Unterhaltung erhöhte den Reiz der wenigen Mußestunden, die Christian IV. vergönnt waren.
Bevor König Christian Kjaerstrup verließ, entbot er Wiebeke zu sich. Als sie heiter und unbefangen bei ihm eintrat, betrachtete er sie eine Weile nachdenkend und begann, ihr einen Stuhl anweisend:
„Jetzt sage mir, Wiebeke, weshalb Du mir damals bei der Gräfin Munk nicht antworten wolltest.“
„In meinem Schweigen lag eine für Ihro Gnaden so demüthigende Antwort, daß ich sie unmöglich noch mit Worten bekräftigen konnte, da ich im Gegentheil alles darum gegeben haben würde, um die Mägde der Unwahrheit zeihen zu können.“
„Ist es wahr, daß Frau Kirstin den Rheingrafen zu jeder Tageszeit empfing, ihn in seiner Wohnung besuchte, daß die Leute in den Straßen ob ihres Betragens mit Fingern auf sie wiesen, daß sie mit ihm nach Schweden entfliehen und ihm von meinen…“
„Warum will Ew. Majestät mich zwingen, Einzelheiten zu berichten, die ich nicht einmal alle kenne,“ unterbrach ihn Wiebeke. „Als ich bei der Gräfin Munk in Dienst trat, befahl mir der König ihr treu ergeben zu sein. Gehört nicht zu den Pflichten treuer Diener auch Verschwiegenheit?“
„Wahrlich, Mädchen, Du beschämst Deine ehemalige Gebieterin an Edelmuth,“ rief der König, die Bauerntochter mit Bewunderung betrachtend.
Nach einer Pause fuhr er mit einemAnfluge von Scherz, aber bald in tiefen Ernst übergehend, fort:
„Ich wollte eigentlich eine ganz andere Frage an Dich richten, auf die ich jedoch reinen Bescheid haben will. Bedenke wohl, daß Deine verständigen Antworten Dir meine Gunst gewannen, Dein beharrliches Schweigen dahingegen meinen Mißmuth und Zorn erregten. Jetzt höre mich an! Du sagtest mir, daß Frau Ellen’s Großmuth Dich demüthige, daß Du Dir einen Wirkungskreis schaffen möchtest, in dem Du nützen kannst. Willst Du mir dienen?“
„Ich wüßte nicht, daß Ew. Majestät weiblicher Bedienung bedürfte,“ antwortete Wiebeke befremdet.
„Da muß ich mich also näher erklären. Es ist Dir nicht unbekannt, daß ich Frau Ellen’s Tochter aus herzlicher Liebe zu meiner Gemahlin erhob und so wahrhaftig, wie ich bisher in gottgefälliger Eintracht mit ihr lebte, auch an ihrer Seite mein Leben beschlossen haben würde, hätte nicht Frau Kirstin ihr Herz von mir abgewandt. Wo die Liebe mit dem Vertrauen entfloh, kommt sie nicht wieder, deshalb sind Christine Munk und ich für die Zukunft moralisch und vor Gott geschiedene Leute, wenn ich gleich an ihrer vielen Kinder willen keine weltlich gültige Scheidung beantragen will. Ohne den Umgang einer braven Frau, die mich aufrichtig lieb hält und in deren milden Nähe ich meine wenigen Mußestunden genieße, vermag ich nicht zu leben. Ich sehne mich für den Abend meines Lebens nach einer treuen Hand, die meine faltige Stirn glätte, die mit munterem Geplauder mir die Sorgen verscheuche, in kranken Tagen meiner in Liebe pflege. Sag‘, Wiebeke, willst Du diesen Platz an meiner Seite ausfüllen?“
Ein Wetterstrahl hätte Wiebeke Kruse nicht vernichtender treffen können, als diese urplötzliche, unerwartete Frage. Ihre schönen Augen starrten wie verwirrt auf den König, welcher gerührt sagte:
„Armes Kind, daß ich Dich so erschrecken würde, dachte ich nicht. Hast Du mich denn verstanden?“
„Ew. Majestät will Ihre Gemahlin verstoßen?“ fragte Wiebeke vorwurfsvoll.
„S i e hat m i ch verstoßen, deshalb habe ich fortan nichts mehr mit ihr gemein,“ antwortete der König streng. „Sag‘ jetzt ob Du mich verstanden und schau‘ nicht so wirr und bestürzt drein,“ fügte er sanft hinzu, indem er zu ihr trat und ihr leise die Wange streichelte. Er zwang sie ihn anzublicken und der Blick, den sie auf ihn richtete, drang ihm tief zu Herzen.
„Ich will nicht zu viel verlangen,“ sprach er leise. „Besinne Dich und gieb mir Antwort wenn ich wiederkehre. Leb‘ wohl, mein braves reinherziges Kind!“
Seine Lippen hatten leicht ihre Stirn berührt, er hatte das Zimmer verlassen – er war abgereist. Wiebeke saß noch immer wie erstarrt, und wieder und wieder klangen die Worte in ihrem Ohr, die sie so tief erschüttert hatten.
Frau Ellen merkte Wiebeke’s Veränderung, merkte auch, daß selbige durch die letzte Unterredung mit dem Könige veranlaßt war, doch quälte sie das junge Mädchen nicht mit Fragen, sondern wartete geduldig, bis Wiebeke freiwillig ihr Herz öffnen würde.
Darüber gingen nun freilich Tage hin, und wer weiß, ob sie jemals über sich vermocht hätte ihrer hohen Freudin eine Mittheilung zu machen, die sie um der eigenen Tochter willen empfindlich kränken mußte, hätte diese ihr nicht selbst die Hand dazu geboten.
Als Frau Ellen nämlich bald darauf ein Schreiben von dem Könige erhielt und laut vorlas, wie derselbe sie bat der Wiebeke einen besonderen Gruß zu vermelden und derselben auch ferner ihre mütterliche Gewogenheit zu erhalten, da ward Wiebeke wiederum von der zitternden Aufregung befallen, in der sie sich nach der Abreise des Königs befunden hatte.
„Fasse Dir ein Herz, Wiebe, und sage mir, was Dich drückt“, sprach Ellen freundlich. Vielleicht kann ich Dir helfen oder rathen“.
Wie ein Kind flüchtete Wiebeke sich nach dieser Aufforderung zu ihrer klugen gütigen Freundin, setzte sich auf einen Schemel zu ihren Füßen und begann zu erzählen, was der König zu ihr gesprochen. Als sie die Worte, die so tief in ihre Seele gedrungen waren, jetzt über die eigenen Lippen bringen sollte, ward sie von der Bedeutung derselben so tief erfaßt, daß es ihr schwer ward, vernehmbar zu sprechen.
Frau Ellen wechselte die Farbe und trocknete sich mehrmals die Stirn. Als Wiebeke schwieg, begann sie nach einer Pause:
„Daß es nichts Geringes war, was Dich aus Deiner besonnenen Ruhe brachte, konnte ich schon wissen, aber dies hätte ich doch nimmer gedacht. Die Sache will reiflich erwogen und überlegt sein, ehe man zu einem Entscheid kommen darf, denn solche Dinge redet der König nicht im Scherze. Jetzt wollen wir nicht weiter darüber sprechen, mein Kind, wir habenja noch Zeitbis zur Rückkehr des Königs.“
Gesprochen ward in den nächsten Tagen freilich nicht darüber, aber mit Wiebeke’s Gemütsruhe war es vorbei, und auch Frau Ellen’s Einsilbigkeit, ihr leises Singen, wenn sie allein im Zimmer oder draußen im Garten mit gemessenen Schritten einherging, deuteten an, daß die ganze Lebhaftigkeit ihres Geistes im Innern thätig sei.
Als die beiden Frauen eines Morgens still bei einander saßen, rief Frau Ellen plötzlich:
„Das Ding muß ein Ende nehmen, Wiebe. Du härmst Dich ab, daß Dir die Wangen hohl werden, und ich grüble mich dumm. Auch für mich ist die Sache wichtiger als Du denkst. Nach Jahrhunderten noch wird man erzählen, daß Du Dich in meinem Hause befandst, als der König Dir den Antrag machte, wird man urtheilen, ob ich Dir zum Rechten gerathen oder nicht. Nehme ich Rücksicht auf das Interesse meiner Tochter, so handle ich den Pflichten einer treuen Unterthanin zuwider, was man vielleicht der mütterlichen Liebe verzeihen würde; rathe ich im Interesse des Königs und des Landes, so handle ich, wie es einer loyalen Unterthanin geziemt, aber man wird mich als unnatürliche Mutter ausschreien – und dennoch thue ich das Letztere. An dem Tage, wo Christine, meiner Angst und meiner Thränen spottend, erklärte, sie sei alt genug um ihr Thun und Lassen zu verantworten, schieden sich unsere Wege. Sie vergaß, daß sie als Gemahlin eines Königs höhere Pflichten, größere Verantwortung habe, als andere Frauen, daß ihre Tugenden weiter leuchten und lauter gepriesen, aber auch daß ihre Fehler schärfer getadelt und tiefer ins Gedächtniß gegraben werden als die anderen. Ihre Aufgabe war es, den Tugenden Christian’s IV. die Beständigkeit einzureihen, doch hat sie als sie ihr Herz von ihm abwandte, dieser Aufgabe vergessen. Der König wird nie zu ihr zurückkehren, denn wo der Bruch eines so zarten Verhältnisses durch Thatsachen herbeigeführt wurde, ist an die Wiederherstellung desselben nicht zu denken. Wir müssen also die Angelegenheit von einem anderen Standpunkte aus erfassen. Der König sagt, daß er sein Leben nicht einsam, d. h. nicht ohne die Pflege einer liebenden Frau beschließen kann, – und darin spricht er die Wahrheit. Nun aber erheischt das Wohl des Landes, das Interesse der Gegenwart und der Zukunft, ja der einstmaligen Lebensgeschichte des Königs, daß der Platz an seiner Seite von einer treufesten, pflichtergebenen, warmherzigen Frau eingenommen werde, die den Abend seines Lebens verschönere um seiner selbst willen, nicht aber aus Eitelkeit oder Gewinnsucht. Wenn Du sein Begehren abwiesest, so würde er vielleicht eine Unwürdige zu sich erheben, die Spott und Schande über die glorreiche Vergangenheit Christian’s IV. würfe und eine Schmach für das Land würde. Niemand ist zu einer Lebensgefährtin des Königs passender, als Du. Aber Deine Stellung würde so dornenvoll sein, daß Du nur in Deinem eigenen Bewußtsein, in der dankbaren Zuneigung des Königs und in der Achtung einzelner Freunde spärliche Rosen pflücken würdest. Das bedenke wohl, mein Kind, bevor Du die geforderte Antwort ertheilst.“
Wiebeke hatte Frau Ellen angehört, ohne sie zu unterbrechen. „Mein Vater! – – mein Vater!“ stöhnte sie und verließ nach einer Weile das Zimmer.
XI.
Christian IV. war mittlerweile in Schleswig gelandet und hatte das Schloß Gottorp eingeschlossen, um durch diese Maßregel den Herzog zu zwingen, die kaiserlichen Truppen aus seinem Gebiete zu entfernen. Nachdem ein paar kaiserliche Compagnien, die auf die Nachricht vom Anrücken des dänischen Heeres zum Entsatze des Schlosses herbeieilten, vom General Holk zurückgeschlagen waren, willigte der Herzog ein, dem Verlangen des Königs zu willfahren, worauf dieser die kaum begonnene Belagerung sofort wieder aufhob und sich nach seinem Hauptquartiere zu Ohe zurückzog. An demselben Tage traf aus Lübeck die Botschaft ein, daß der Friede von dem dort tagenden Congresse unterzeichnet sei, und obwohl die noch in Zweifel stehenden Unterschriften Tilly’s und Wallenstein’s erst um vierzehn Tage später erfolgten, wurde die Freudenbotschaft doch im Lager bei Ohe und auf Gottorp bei Kanonendonner und munteren Fanfaren öffentlich verkündet.
Man hat es Christian IV. zum Vorwurfe gemacht, daß er bei dem Friedensschlusse mit dem Kaiser nur seinen eigenen Vortheil im Auge gehabt, zum besten seiner Glaubens und früheren Bundesgenossen aberkein Wörtchen eingelegt habe; doch darf man gerechterweise auch nicht vergessen, daß die abtrünnigen Bundesgenossen keine Schritte thaten, um in diesen Friedenstractat mit eingeschlossen zu werden.
Die Aussicht die lästigen Gäste bald abziehen zu sehen, belebte die Schleswig-Holsteiner mit neuer Hoffnung. Die Luft hallte wieder von Freude und Dankeshymnen, und alles blickte sehnsuchtsvoll einer ruhigen Zeit entgegen.
Eine der Hauptsorgen Christian’s war zunächst, den Abzug der feindlichen Truppen zu überwachen, um seine Unterthanen vor Unbill und etwaigen Uebergriffen der fremden Kriegsvölker möglichst zu schützen. Zu dem Zwecke stellte er seine eigenen Truppen so, daß sie die nach Süden rückenden kaiserlichen Regimenter stets im Auge behielten. Das Hauptquartier blieb noch einstweilen in Angeln, doch hielt der König sich meistens in Holstein auf, wo er die fremden Söldner aus seinem Heere verabschiedete. Erst im December kehrte er bleibend nach Kopenhagen zurück.
Im Herbste hatte er auf einer in Regierungsgeschäften unternommenen Reise auch Fühnen berührt und wiederum auf Kjaerstrup gerastet, wo sein Erscheinen für Wiebeke Kruse von wichtigen Folgen war.
Die junge Holsteinerin war längst zum klaren Verständniß ihrer Lage gekommen und hatte seitdem auch ihre innere Ruhe wiedergewonnen. Sie sagte sich, daß sie einerseits durch eine Verbindung, wie der König und Ellen Marsvin sie im Auge hatten, den Fluch ihres Vaters auf sich laden würde, während es andererseits in ihre Hand gegeben sei, dem Landesvater in Bezug auf sein Privatleben die Achtung seiner Unterthanen zu erhalten. Eine gottgefällige Lösung dieser Frage glaubte sie gefunden zu haben und wartete gelassen der Rückkehr des Königs, um sie seiner Entscheidung anheimzustellen.
Als der König sich mit Wiebeke Kruse in Frau Ellen’s Schreibzimmer allein befand und sie fragte, ob sie die Antwort für ihn fertig habe, erinnerte sie ihn an jenen Tag, als er, unter der großen Linde im Schloßgarten zu Bramstedt sitzend, ihrem Vater Hans Kruse aus Föhrden Gehör schenkte, der ihm die Verantwortung für das Wohlergehen seiner Lieblingstochter so dringend ans Herz legte, daß der König ihm bewegt die Hand gereicht und gelobt hatte Vaters Stelle an ihr zu vertreten und entweder in Dänemark für ihre Zukunft zu sorgen oder sie mit Ehren heimzuschicken. „Was würde Hans Kruse sagen, wenn er hörte, daß der König bei Lebzeiten seiner Gemahlin mich auffordert ihre Rechte, ihre Pflichten zu übernehmen?“ schloß Wiebeke ihre Erklärung.
„Hast Du ausgeredet?“ fragte der König.
„Nein!“
„So sprich weiter!“
„Ew. Majestät betrachtet sich vor den Augen des Höchsten als von der Gräfin Munk rechtmäßig geschieden, obwohl Sie es durch weltliche Gerichte nicht aussprechen lassen will. Wenn nun aus dieser Ursache meine Stellung niemals auf Billigung und Achtung der Welt Anspruch erheben darf, so kann sie doch vor dem Herrn geheiligt sein, indem sie durch die Hand eines seiner Diener auf Erden geweiht wird.“
„Ich verstehe Dich“, versetzte der König. „Und wenn dies nicht geschähe?“
„So würde ich ohne Bedenken zur Waschbrücke zurückkehren und, in dankbarer Erinnerung der Gnade und Huld meines Königs, als ehrliche Magd mein Brod verdienen.“
Der König erhob sich, verließ das Zimmer, und bald darauf sah man seinen Leibkutscher mit einem leeren Wagen vom Hofe fahren, in welchem er nach Verlauf einer Stunde den Ortsgeistlichen zurückbrachte. Der König schloß sich mit dem Pfarrer ein,und als er, nach einer langen Unterredung mit demselben, Wiebeke Kruse hereinrief, da errieth Frau Ellen, was drinnen,der Welt zum ewigen Geheimniß, vorgehe.
Als Wiebeke nach einer Weile an der Hand des Königs vor Ellen Marsvin trat, lag eine feierliche Ruhe auf ihrer Stirn. Sie wußte, daß sie nicht nach weltlich gültigen Formen dem Könige angetraut sei, aber das Opfer welches sie brachte, hatte göttliche Weihe erhalten, und sie betrachtete sich von Stunde an bis zu ihrem letzten Athemzuge als rechtmäßige Gattin Christian’s von Dänemark.
Als der König einige Tage darauf nach Kopenhagen abreiste, wünschte sie ihm zu folgen; doch hielten Christian und Frau Ellen für klüger, daß sie unter dem Schutze der gütigen Freundin auf Kjaerstrup bleibe, bis der König über den künftigen Aufenthalt der Gräfin Munk entschieden und die Einzelheiten ihrer Lebensstellung näher bestimmt habe.
Da wir Christine Munk’s Geschichte nur in so weit berühren, als sie mit der Entwickelung von Wiebeke Kruse’s merkwürdiger Lebensgeschichte verknüpft ist, so wollen wir nur noch anführen, daß der König ihre Mutter zwang, ihr die in Jütland belegenen Güter Boller und Rosenwold abzutreten, welches indessen nicht ohne abermaligen Freundschaftsbruch zwischen Christian IV. und Frau Ellen Marsvin erreicht wurde. Ueber die Versorgung der Kinder Christian’s wurde bereits in einem vorstehenden Capitel gesprochen. Nur über den einzigen am Leben gebliebenen Sohn, den mehrfach genannten Christian Waldemar, wollen wir noch eine kurze Mittheilung beifügen. Derselbe ward von dem deutschen Kaiser in den Grafenstand erhoben und führte den Titel eines Grafen von Schleswig-Holstein, den auch seine Schwestern annahmen, bis ihnen solches von Friedrich III. untersagt wurde. (Christine Munk war, obgleich sie von Zeitgenossen und nachweislich auch von Christian IV. bisweilen als Gräfin titulirt wurde, doch niemals officiell zu diesem Range erhoben worden.) Im Jahre 1643 ward Graf Christian Waldemar nebst einem glänzenden Gefolge nach Rußland gesandt, wo er sich mit der Großfürstin Irene vermählen sollte. Diese Verbindung scheiterte indessen an der Weigerung des Grafen, zur griechischen Kirche überzutreten. Nach dem Tode Christian’s IV. bekannte er sich zur Partei seines Schwagers Corsitz Ulfeldt, wodurch er die Ungnade seines Halbbruders, des regierenden Königs, auf sich zog und in schwedische Dienste trat. Er fand seinen Tod in einer Schlacht gegen die Polen 1656.
XII.
Wir übergehen den Zeitraum von mehreren Jahren als für den eigentlichen Verlauf unserer Erzählung von geringer Bedeutung, obschon derselbe für die Interessen des Landes und des Königs an wichtigen Ereignissen reich genug war. Zunächst brachten die langwierigen Streitigkeiten mit Hamburg dem Könige viel Verdruß. Auch die Landung Gustav Adolph’s auf deutschem Boden, durch welche der Religionskrieg in eine neue Phase trat, blieb nicht ohne Bedeutung für Christian IV. Waren ihm durch den Frieden zu Lübeck gewissermaßen die Hände gebunden, so daß er dem Könige von Schweden weder Geld noch Truppen zu Hülfe senden durfte, so fand er doch für nothwendig, durch Anlage neuer Festungen und Verstärkung der bereits vorhandenen, die Gränzen seines Reiches zu sichern.
Bei diesen von Klugheit und Vorsicht gebotenen Maßregeln stieß er nicht selten auf den Widerstand des Herzogs und des holsteinischen Adels, welche das eigenmächtige Verfahren des Königs in ihrem Lande ungern sahen, aber als zu ihrer eigenen Sicherheit erforderlich, dulden und durch Beiträge an Geld und Mannschaft fördern mußten.
Außer diesen Sorgen, welche den Regenten trafen, ward auch sein Herz als Sohn, Freund und Vater durch mehre Todesopfer in tiefe Betrübniß gebracht. Der erste derartige Schmerz traf ihn durch den Tod seiner Mutter, die er zärtlich geliebt und als Muster der Frauen hochgeehrt hatte. Ein Jahr darauf ward er durch die Todesbotschaft Gustav Adolph’s tief erschüttert, und wenige Wochen später ward ihm die Meldung, daß auch Friedrich von der Pfalz, der Exkönig von Böhmen, sein freudeloses Dasein beschlossen habe. Im Jahre 1663 starb Anna Catharina, die ihm von allen seinen Kindern an Körper und Geist am meisten glich, aus Gram um den plötzlichen Tod ihres Verlobten, und härter noch als dieser Verlust traf ihn die Kunde von dem Ableben seines jüngsten Prinzen, der sich in Deutschland aufhielt und als er während eines Waffenstillstandes längs einer Vorpostenkette ritt, um einen Begleiter Wallenstein’s zu begrüßen, von einem Soldaten erschossen ward.
Alle Sorgen, allen Kummer schüttete König Christian in das treue theilnehmende Herz seiner nunmehrigen Lebensgefährtin, die durch ihren scharfen klaren Verstand, ihre Besonnenheit und ihr warmes Herz zu einer Freundin Christian’s IV wie geschaffen war. Sie beschwichtigte seinen Zorn, sie verscheuchte seine trüben Gedanken, erheiterte ihn durch fröhliches Geplauder und pflegte seiner durch unaufhörliche Strapazen angegriffenen Gesundheit. Sie begleitete ihn auf allen Reisen zu Wasser und zu Lande, theilte manche Gefahr, manche ernste und manche frohe Stunde mit ihm. Im übrigen war Wiebeke Kruse’s Stellung nicht beneidenswerth. Standes- und andere weltliche Vorurtheile verschlossen ihr die Thür der adligen Gesellschaft. Niedrige Schmeichler und Glücksucher wußte sie fernzuhalten, und trotz der offenen Erklärung des Königs glaubten doch die Meisten, daß Wiebeke an Christine Munk’s Verstoßung Schuld sei. Unter den wenigen, welche ihr Achtung und Anerkennung zollten, war der Hofmarschall Wenzel Rothkirch, der sie seit jenem denkwürdigen Tage in Bramstedt beobachtet und schätzen gelernt hatte. Er bezeigte ihr alle Ehrerbietung, die er einer so würdigen Lebensgefährtin seines Königs schuldig zu sein glaubte, und den größten Beweis seiner Hochachtung gab er ihr bei seiner Vermählung mit Christine, der Tochter des Reichsrathes Reetz, indem er sie einlud, die Hochzeitfeier mit ihrer Gegenwart zu verherrlichen.
Eine andere, nicht minder große Freude hatte Wiebeke erfahren, als der König im Maimonat 1631 das adelige Gut Bramstedt von Arndt Stedingk’s Wittwe ankaufte. Von früher Kindheit an hatte sie das Schloß Bramstedt als heimathliches Kleinod anstaunen gelernt, und eben deshalb war ihr der Gedanke, es im Besitze ihres Herren und Königs zu wissen, unendlich werth. Nur Eins trübte diese Freude, nämlich die heimliche Furcht, daß der König ihr dort ihren Aufenthalt anweisen könne für die Zeit, die er bei seinen jährlichen Reisen nach den Herzogthümern in Glückstadt, Kiel oder Rendsburg zubringen mußte. Bis jetzt war sie davon verschont geblieben und auch im Jahre 1633 war der König um Michaelis von Kiel zurück nach Kopenhagen gegangen ohne während seines Sommeraufenthaltes in Holstein seinen neuen Besitz in Augenschein genommen zu haben. Im October siedelte er mit seinem Hofstaate nach Skanderburg über, wo er den ganzen Winter residirte.
An einem Novembertage saß Wiebeke in ihrem Privatgemache vor dem wärmenden Kaminfeuer. Neben ihr spielte Ulrich Christian, ihr dreijähriges Söhnlein; auf den Knien wiegte sie ein halbjähriges Töchterchen, mit dem sie koste und plauderte und an dessen Lachen und Kreischen sie eine kindische Freude hatte. Es geschah nicht bloß dem Könige zu Liebe, daß Wiebeke die Pflege ihrer Kinder eigenhändig besorgte. Sie betrachtete es vielmehr als den größten Vorzug ihrer sorgenfreien Existenz, sich gänzlich ihren Kindern widmen zu können. Ihre sorgenfreie Existenz sagen wir, und doch sind gegen dieselbe Zweifel erhoben worden, indem man der Wiebeke nachsagte, daß sie wenig haushälterisch sei und nie mit der ihr zuständigen Summe ausreiche. Damit verhielt es sich folgendermaßen. Außer freier Bespeisung von der Tafel des Königs erhielt Wiebeke einen Jahresgehalt von 660 dänischen Thalern, wofür sie sich und ihre Kinder und Mägde kleiden und letztere besolden mußte, und wenn auch die genannte Summe für das siebenzehnte Jahrhundert unweit höher anzuschlagen ist, als für das neunzehnte, so darf man auch wiederum nicht vergessen, daß ihre mildthätige Hand sich oft und gern aufthat, und daß es ihr an Gelegenheit dazu niemals fehlte. Klagen über Mangel an Geld kamen nie über ihre Lippen. Verlangte der König bisweilen ein Sümmchen von ihr, so reichte sie ihm lachend die leere Börse, in die er dann ohne Vorwurf einige Goldstücke gleiten ließ, überzeugt, daß sie nur zu wohlthätigen Zwecken zu oft geöffnet worden sei. Auch diesmal war Wiebeke mit geringer Barschaft aus Holstein zurückgekommen. Sie tröstete sich damit, daß der Quartalsschluß nicht mehr fern sei, und vertraute im übrigen Dem, der die Vögel unter dem Himmel nährt und die Lilien auf dem Felde kleidet. Daher vermochte sie auch mit ungetrübtem Frohsinn mit den Kindern zu schäkern, ließ das Töchterlein tanzen und lachte des Söhnleins, welches auf einem Stecken im Zimmer einhertrabte und mit der Peitsche fuchtelte wie ein trunkener Courier, Von Zeit zu Zeit warf sie einen Blick auf die Uhr, denn die Stunde, wo der König morgens zu kommen pflegte, hatte längst geschlagen.
Als der König endlich die Thür öffnete und Wiebeke mit dem Kinde auf dem Arme ihm entgegeneilte, ihn an den Stuhl führte, der längst für ihn zurechtgerückt war, da sah man deutlich, wie wohl und behaglich er sich in ihrer Nähe fühlte.
„Sich‘ mich nur nicht so freundlich an!“ sagte der König, als er sich, nachdem er die Kleinen geliebkost hatte in dem bequemen Sessel niederließ. „Ich bringe Dir eine Nachricht, die Dein klares Auge rasch trüben wird.“
„Ist denn ein Unglück geschehen?“ fragte Wiebeke.
„Das eben nicht“, versetzte der König. „Aber was sagst Du, wenn ich Dir erzähle, daß ich Bramstedt verschenkt habe?“
„Wirklich?“
„Rathe einmal, an wen?“
„O, ich kann es mir denken,“ rief Wiebeke. „Ew. Majestät wird es der jungen Braut Sr. Hoheit des Prinzen Christian verehrt haben, und das macht mich nicht traurig; denn Ew. Majestät darf mir meine Aufrichtigkeit nicht verübeln: zehnmal lieber sehe ich den Besitz in die Hände unseres leutseligen, gnädigen Kronprinzen, als in die Hände des Prinzen Friedrich übergehen.“
Der König lächelte. „Bist Du denn so gewiß, das Rechte errathen zu haben?“ fragte er.
Wiebeke sah ihn unschlüssig an.
„Da muß ich Dir wohl Einsicht in die Schenkungsacte gewähren,“ sprach er, ihr ein gerolltes Pergament überreichend. „Lies mir die Urkunde einmal laut und vernehmlich vor.“
Wiebeke suchte die kleine Elisabeth ruhig zu halten, faßte mit der Rechten das Blatt und begann zu lesen, wie folgt:
„Wir Christian IV., von Gottes Gnaden König zu Dänemarken, Norwegen, der Wenden und Gothen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, Graf zu Oldenburg und Delmenhorst, thun kund hiermit, daß Wir der Ehrsamen Unserer Lieben Besonderen Wiebeke Kruse…..“ hier stockte sie. Noch einmal begann sie von vorn und fuhr dann mit fliegender, unsicherer Stimme fort: „aus besonderer Gnade Unser zu Bramstedt erblich erkauftes Gut sammt allen Pertinenzien und Zubehörung, selbiges für sich und ihre Erben künftiger Zeit zu nutzen, zu gebrauchen und zu besitzen, auch damit ihrer Gelegenheit nach zu schalten und walten, gnädigst gönnen und zukommen lassen wollen…..“ Weiter vermochte sie nicht zu lesen, die Stimme versagte, die Buchstaben schwammen in einander und der König nahm das Blatt aus ihrer Hand und las bis zum Schlusse den Königsbrief, laut welchem Wiebeke Kruse nicht allein als Herrin des Gutes Bramstedt, nebst dazu gehörigen Aeckern, Wiesen, Weiden und Hölzungen und Unterthanen, sondern auch der im gleichnamigen Flecken belegenen Mühle nebst dazu gehörenden werthvollen Ländereien eingesetzt ward.
Als König Christian geendet hatte, lag Wiebeke zu seinen Füßen. „Nun?“ fragte er mit erheuchelter Gleichgültigkeit.
„Unmöglich, Majestät, so viel Gnade habe ich nicht verdient,“ rief sie zitternd vor Erregung.
„Du hast mehr verdient, armes Kind,“ versetzte der König, sie emporhebend und wieder an ihren Stuhl führend. „Was Dir gebührt, vermag ich Dir leider nicht zu geben. Ein geringer Ersatz, nur ein Zeugniß meiner Liebe ist es, wenn ich Dich vor Mangel an zeitlichen Gütern sichern und, wenn Gott mich aus diesem Leben abrufen sollte, Dich davor geschützt wissen will, das Gnadenbrod meiner Söhne zu essen.“
Wiebeke empfand zu tief, um ihrem Herzen in Worten Luft zu machen. Sie hatte die Hand des Königs inbrünstig an ihre Lippen gepreßt und hielt sie noch fest umschlossen; aus ihren Augen stahl sich dann und wann eine Thräne über die glühende Wange.
„Künftigen Sommer sollst Du als Besitzerin dort Deinen Einzug halten,“ sprach der König. „Als Gutsherrin stehst Du über den Klatschereien Deiner früheren Bekannten, außer der Gemeinschaft, in welche sie Dich nicht als ihresgleichen wieder aufgenommen haben würden, wie Du mir einst selbst erzähltest……“
„Und was sie mir noch an Liebe und Achtung versagen, das sollen sie meinem Sohne schenken,“ rief Wiebeke begeistert, den Kleinen aufs Knie setzend. „Hörst Du, Ulrich, Du sollst als Besitzer von Bramstedt dem Orte neuen Glanz verleihen, Du sollst die Ländereien verbessern, Garten und Gebäude verschönern, sollst Dein Eigenthum schmücken wie eine Braut und das brave Völkchen lieb und werth halten wie Deine Kinder, damit unser Name noch in später Zeit von den Einwohnern gesegnet werde!“
Glückliche Wiebeke! Sie ahnte nicht, daß dem Sohne, dem sie diese Pflichten für die Zukunft auferlegte, ein kurzes Lebensziel gesteckt sei; nicht, daß die Tochter, die neben ihm auf ihren Knien saß, einst zum Besitze kommen und wiederum eine Tochter gewinnen werde, die durch ihre Härte, durch die despotische Grausamkeit ihres Gemahls den Fluch der Unterthanen auf sich laden und so viel Jammer und Elend über die Bramstedter Insassen bringen werde, daß sie noch heutigen Tages an den Folgen kranken.
XIII.
Neun Jahre sind vergangen, seitdem wir die Bramstedter Herren beim Morgenconvivium in der Apotheke besuchten, und tagtäglich hatte man sie seither dieser mit ächt nationaler Zähigkeit anklebenden Gewohnheit folgen sehen. Niemand fehlt in dem Kreise, wenn auch die Zeit ihre Runen mehr oder minder tief auf die glatte Stirn geritzt oder einzelne Fäden ihres Silbergespinstes in die Locken gemischt hat. Die Kriegsjahre haben auf diesem Orte nicht minder schwer gelastet, als auf dem übrigen Lande. Schwere Seufzer, bange Klagen und Vertröstungen auf bessere Zeiten hat man in dem Stübchen des Apothekers ausgetauscht, bis endlich der eintretende Friede die gebeugten Gemüther wieder emporrichtete.
Außer den allgemeinen Bekümmernissen hatten auch manche Localbegebnisse Stoff zu wechselnder Trauer und Freude gegeben. Als Arndt Stedingk mit Tode abging und seine Wittwe bald darauf das Gut zum Verkauf ausbot, sah man mit Zagen und Bangen dem neuen Herrn entgegen, was in einer Periode, wo das zeitliche Wohl der leibeigenen Unterthanen ganz in den Händen des Gebieters lag, sehr natürlich war. Großer Jubel, sowohl bei den Gutsuntergehörigen, als im Flecken, erregte die Kunde, daß König Christian von Dänemark das Gut für sich angekauft habe, an die sich die Hoffnung knüpfte, daß er dasselbe fortan zu seiner Sommerresidenz benutzen werde. Eine alljährliche Anwesenheit des Königs mußte eine Menge anderer vornehmen Gäste herbeiziehen, mußte eine Triebfeder zum Aufblühen des Marktfleckens werden, und schon spannen einige heiße Köpfe – wie sie keiner Gemeinde fehlen – zahllose Projecte: Anlage von Fabriken, Schiffahrt längs der Bramau in die Stör, Häuserbauten, um Wohnungen zu schaffen für die Edelleute und fremden Gäste, die das Hof lager verherrlichen würden, als den hochfliegenden Zukunftsschwärmern plötzlich die Flügel gelähmt wurden. Eine amtliche Bekanntmachung, die in der Sonntagsfrühe an die Kirchenthür genagelt und von der Kanzel gelesen wurde, verkündete den Bramstedtern, daß Christian von Dänemark das adelige Gut mit allem Zubehör seiner lieben getreuen Wiebeke Kruse und deren Erben zum Besitz und Eigenthum überantwortet habe. Damit waren die stolzesten Hoffnungen des Fleckens zertrümmert. Diese Schenkungsacte .schien zu bestätigen, was das Gerücht über das fernere Schicksal der Wiebeke Kruse geflüstert hatte und die ehrsamen Fleckensinsassen betrachteten es als einen Schimpf, daß das Schloß, welches seit undenklichen Zeiten in den Händen der Landesherren und des Adels gewesen war, jetzt in die Hände einer Bauerntochter übergehen, daß das Wohl und Wehe so zahlreicher Familien von den Launen einer ränkesüchtigen Magd abhängen sollte. Ein Glück war es für Wiebeke, daß sie nicht damals gleich einzog: die Erbitterung war zu groß, als daß ihr Demüthigungen mancher Art hätten erspart werden können.
Dies Mißvergnügen begann sich wieder zu regen, als im nächstfolgenden Frühjahre der Kirchspielvogt eines Morgens die Freunde in der Apotheke mit den Worten begrüßte:
„So, Ihr Herren, nun holt nur die Festkleider aus dem Schranke und bürstet den Federhut. In einigen Tagen wird die neue Gutsherrin ihren Einzug halten!“
„Nun, ich denke doch, daß darum kein vernünftiger Mann den Kopf aus der Thür stecken wird,“ meinte der Pfarrer.
„Ich werde zum wenigsten keine Ehrenpforte bauen,“ lachte der Postmeister.
„Darin mögen die Herren thun, wie ihnen beliebt,“ entgegnete der Kirchspielvogt. „Doch will ich als Freund daran erinnern, daß jede Beleidigung, die man Frau Wiebeke anthut, auch den König trifft, und wenn Ihr später auf Eure Suppliken um Ermäßigung der Contribution und sonstiger Lasten abschlägigen Bescheid erhaltet, da würdet Ihr gern, um die Gnade Sr. Majestät wieder zu erlangen, weit größere Opfer bringen, als es bei einem artigen Empfange der neuen Gutsherrin von Euch verlangt wird.“
„Der Kirchspielvogt hat Recht,“ entschied der Apotheker. „Vorgetan und nachbedacht, hat manchem schon groß Leid gebracht.“
„Nicht wahr?“ rief der Kirchspielvogt mit komischem Ernste. „Und wenn die reiche Frau Euch erst kennen lernt, da wird sie alle Specereien, statt aus Hamburg, direct von Euch beziehen, und das wirft mehr ab, als zu einem Festkleide für Frau und Tochter nöthig ist.“
„Ich habe niemals begreifen können, warum man der Frau so viel arges andichten will,“ begann jetzt der Doctor. „Hier hat Wiebeke Kruse keinem Leides gethan, und was sie künftig Gutes oder Böses unter ihren Untergebenen anrichten wird, muß erst die Zeit lehren. Warum sollen aber unsere Frauen und Töchter sich an dem Empfange betheiligen? Mir scheint es genügend, wenn wir uns zur Cour einstellen. Will Frau Wiebe die Damen des Fleckens sehen, so mag sie dieselben einladen.“
„Der letzten Ansicht trete ich bei,“ nickte der Pfarrer. Wenn wir Männer Rücksichten auf Se. Majestät zu nehmen haben, so gilt dies doch nicht für unsere Frauen.“
Nachdem die Herren sich über die Einzelheiten der Empfangsfeierlichkeiten berathen hatten, discutirten sie über die Veranlassung der diesjährigen Reise Christian’s IV., mit der es folgende Bewandtniß hatte.
Die niedersächsischen Fürsten, welche den König von Dänemark während seines deutschen Feldzuges so schmählich verließen, hatten längst eingesehen, daß im kaiserlichen Lager kein Heil für sie zu erwarten sei, weshalb sie sich dem Schwedenkönge anschlossen. Im Anfange des Jahres 1634 hielten die Protestanten in Halberstadt eine Versammlung, wo sie, behufs einer energischen Fortführung des Krieges und um ein rasches vortheilhaftes Ende desselben herbeizuführen, sich sämmtlich zu einer Beisteuer an Geld und Mannschaft verpflichteten, welche die Kräfte vieler Mitglieder des Bundes nahezu überstieg. Zugleich wurden Boten nach Dänemark gesandt, welche Christian IV., der den Kreistag nicht hatte beschicken wollen, überreden sollten, diesem Bündnisse beizutreten. Der König wollte die mit eigener Hand unterzeichneten Friedensbedingungen nicht treulos brechen, und fand größere Ehre darin, einen für seine Glaubensgenossen vorteilhaften Frieden zu vermitteln, wozu er auch ferner die Hand bot, übrigens aber sich neutral zu verhalten wünschte. Obwohl er wußte, daß dieser Beschluß die volle Billigung des Herzogs von Holstein haben würde, berief er doch, ehe er die officielle Antwort absandte, einen Landtag nach Kiel, wo er dem Herzoge und den Landesvertretern die Sache zur Begutachtung vorlegte. Zu diesem Zwecke verließ er schon im April Skanderburg und ging zunächst nach Glückstadt, von wo aus er seinen Geheimsecretair Günther mit Wiebeke und deren Kindern nach Bramstedt sandte und selbst nach Kiel weiterreiste.
Als der Wagen, der sie ihrer Heimat zuführte, dem Flecken näher und näher rollte, pochte ihr Herz in immer rascheren Schlägen. Kein Hochmuth drang in ihren schlichten Sinn, sie scheute sich den alten Bekannten als Gebieterin gegenüber zu treten, und war im Stillen froh, daß sie auf den Hof fahren konnte, ohne den Flecken zu berühren.
„Was ist das?“ rief Günther, als vor dem Torhause jenseit der Hudau ein lautes Peitschenknallen erscholl
„Das ist ein Gruß meiner Bramstedter!“ rief Wiebeke, durch diese Lieblingsmusik ihrer Kinderjahre electrisirt, den Kopf zum Fenster hinaussteckend und dem Kutscher zu halten befehlend. „Dank, Dank, Ihr Burschen!“ rief sie den sich um den Wagen drängenden Burschen zu. „Wenn Ihr, so lange ich hier bleibe, jeden Tag bei Sonnenauf- und untergange vor meinem Stubenfenster knallen wollt, so sollt Ihr nicht unbelohnt bleiben.“
Die Knaben warfen die Mützen in die Luft, schwenkten die Peitschen und ließen mit lautem „Hurrah!“ den Wagen durch das Thor rollen.
Dies Zeichen, daß die Bramstedter sich ihrer alten Liebhaberei und folglich wohl auch ihrer Person erinnerten, befreite sie von aller Scheu vor dem Wiedersehen ihrer früheren Bekannten. Freudetrunken ruhte ihr Auge auf jedem alten Baume, auf allen bekannten Gegenständen, und als sie vor der Freitreppe aus dem Wagen stieg und die Beamten und Fleckensvorsteher zu ihrem Empfange versammelt sah, da fühlte sie es zucken um Kinn und Mund, und ihre Augen schwammen in feuchtem Glanze.
Nachdem der Magistrat seine Bewillkommnungsrede geendet hatte, antwortete Wiebeke – und dies war die erste und einzige Rede, die sie in ihrem Leben und obendrein aus dem Stegreif hielt –:
„Des Herrn Wege sind wunderbar. Weit umher hat er mich geführt, große Gnade hat er mir erwiesen, und als er gewollt, daß ich als Herrin unter Euch trete, da hat sich mein Herz in Demuth vor seinem Willen gebeugt, aus tiefster Seele habe ich ihm gedankt, daß er das Schicksal der Bramstedter, deren ich stets in Liebe gedacht, in. meine Hände legte, habe um Kraft und Einsicht gefleht, daß mein Wirken und Walten den Gutsunterthanen zum Heil gereichen möge, damit man den Tag segne, an welchem der König mich für das Glück so vieler Menschen verantwortlich machte. – Ich bin noch fremd in meinem Hause und kann die Herren heute nicht zu Gast bitten,“ fuhr sie fort, „doch wird hoffentlich im Keller ein Becher Wein vorräthig sein, den wir auf das Wohl Sr. Majestät und des Fleckens miteinander leeren. In den nächsten. Tagen hoffe ich die Herren arthiger bewirthen zu können, und bitte mir dann auch die Ehre aus, die Damen begrüßen zu dürfen. Ich muß alle lieben Bekannten wiedersehen und werde mich bald wieder heimisch unter Euch
fühlen.“
Bei diesen Worten hatte sie die Runde im Kreise gemacht und jedem Einzelnen die Hand geschüttelt. Im Begriff am Arme des Kirchspielvogtes in die Halle zu treten, bemerkte sie hinter den übrigen das treuherzige Gesicht ihres früheren Brodherrn Jörgen Götsche. Froh überrascht eilte sie zu ihm hin, faßte seine beiden Hände und sah ihm so freundlich ins Auge, daß es dem Manne ganz weich ums Herz wurde.
„Wer hätte geahnt, Jörgen, daß ich unter so ganz anderen Verhältnissen wiederkommen würde,“ rief sie bewegt. „Grüße Deine Frau, ich werde sie besuchen; ich muß Euch alle alle wiedersehen,“ wiederholte sie und trat dann als Gebieterin über die Schwelle, über die ihr Fuß sich früher nur selten schüchtern und befangen gewagt hatte.
Als die Herren bald darauf den Hof verließen, gingen sie keineswegs direct nach Hause, gruppenweise sah man sie zusammenstehen, jeder mußte aussprechen wie sehr er durch Wiebeke’s Persönlichkeit bezaubert sei. Alle Bilder, die man von ihr entworfen, erblaßten vor ihrer wirklichen Erscheinung. Sie war weder die plumpe, bäuerische Figur, noch die hochmüthige, kostbar ausstaffirte Zierpuppe. Ihre herzgewinnende Freundlichkeit, ihre fremdartige, wohlklingende Sprache, ihr wunderbar klarer Blick hatten die Anwesenden so eingenommen, sie hatte sich so frei, so natürlich, mit so ruhiger Überlegenheit bewegt, daß man ihre Herkunft, ihre Vergangenheit vergessen haben würde, hätte sie nicht selbst daran erinnert.
Als Wiebeke Kruse am nächsten Morgen bei Sonnenaufgang durch das bestellte Concert der Bramstedter Kuhhirten geweckt wurde, sprang sie rasch aus dem Bette, stieß das Fenster auf und warf jedem ein Geldstück zu.
„Heute Geld, von morgen an ein Butterbrod für die Mühe,“ rief sie, ihnen freundlich zunickend, und schloß dann, von dem scharfen Nordost eisig angehaucht eilig das Fenster. Nachdem sie sich angekleidet hatte, nahm sie Abschied von dem Geheimsecretair Günther, welcher an demselben Tage in Kiel eintreffen sollte, und stieg dann, ohne Begleitung ihrer Kinder oder Mägde, in den früh bestellten Wagen und fuhr davon.
Durch Jörgen Götsche, den sie nach dem Befinden ihrer Eltern gefragt, hatte sie erfahren, daß man die Mutter vor einem Jahr ins Grab gesenkt, daß der Vater, ein mürrischer Graukopf, seinen Hof an den jetzt verheiratheten ältesten Sohn abgetreten habe, aber im Hause mit fortlebe.
Mit beklommenem Herzen erblickte sie nach einer raschen Fahrt die ersten Häuser des Dorfes Föhrden. Ganz wie an jenem Tage, wo Christian IV. sie der heimathlichen Sphäre entriß, sehnte sie sich nach ihrem Vater, obwohl sie seinen Anblick fürchtete.
In geringer Entfernung von dem väterlichen Gehöfte ließ sie den Kutscher halten und schlüpfte ungesehen durch die Pforte, welche den eingefriedigten Hof von der Landstraße schied.
„Wo ist Hans Kruse?“ fragte sie eine vor dem Hause beschäftigte Magd.
„Er ging eben durch die Seitenthür nach dem Kohlhofe,“ antwortete diese, die fremde Dame verwundert anstarrend.
Wiebeke ging an der Einfahrt vorüber, bog um das Haus, und neben dem Brunnen, unter dem bekannten Apfelbaume, dessen schwellende Blüthenknospen auf einen sommerwarmen Lufthauch warteten, um sich dem Sonnenlichte zu öffnen, traten Vater und Tochter sich gegenüber.
Der Alte stutzte. Beider Augen ruhten, wie gebannt, aufeinander, bis Wiebeke leise fragte: „Kennt Ihr mich nicht wieder, Vater?“
Beim Klange dieser Stimme kehrte Hans Kruse sich hastig um, ging mit verdoppelten Schritten dem Hause zu, die Thür krachend hinter sich zuschlagend. Wiebeke empfand ein stechendes Weh im Herzen. Langsam schritt sie dem Hause zu, wo ihr auf der Diele Bruder und Schwägerin entgegentraten. Nachdem sie dieselben begrüßt hatte und von ihnen in die Stube geführt worden war, fragte sie wieder: „Wo ist der Vater?“
„Er ist in seine Kammer gegangen,“ versetzte der Bruder.
„Geh‘ zu ihm, Hans, sag‘ ihm, daß er mich nicht fortgehen lassen dürfe, ohne mich gehört zu haben. Glaubt er denn, daß ich jemals gewagt hätte, ihm vor die Augen zu treten, wenn ich nicht mit reinem Gewissen den Blick zu ihm aufschlagen dürfte?“
Der junge Mann versuchte die Thür nach der angrenzenden Kammer zu öffnen. „Er ist drinnen,“ sagte er, „und wird jedes Deiner Worte vernommen haben. Geh‘ hinein und rede selbst mit ihm, damit kommst Du am weitesten.“
Wiebeke befolgte diesen Rath und trat zu dem Vater in die Kammer. Als Hans Kruse sie unbeachtet ließ, begann sie:
„Vater, als ich vor neun Jahren Lust verspürte, mich in der Welt umzusehen, fandet Ihr kein Unrecht darin, sonst hättet Ihr Eure Einwilligung nicht dazu gegeben. Wenn ich mich durch meinen Wandel Eurer Liebe unwerth gemacht hätte, so würde ich das Vaterhaus gemieden, nicht aber es sehnsüchtig aufgesucht haben. Hört mich an! So gut wie der liebe Gott die Beichte seiner Kinder vernimmt, so seid auch Ihr schuldig, anzuhören, was ich von der Zeit an, wo ich die Heimath verließ, erfahren habe.“ Hierauf begann sie ihre Erlebnisse ausführlich zu erzählen, bis zu dem Tage ihrer Rückkehr nach Bramstedt.
„Und das nennst Du einen gottgefälligen Lebenswandel?“ hohnlachte Hans Kruse? „Ein Mann, der ein zweites Weib nimmt, ohne von dem ersten gerichtlich geschieden zu sein, ist ein Schurke, und wenn er zehnmal König oder Kaiser wäre! Warum kamst Du nicht nach Hause, als Du bei der Gräfin Munk aus dem Dienste tratst? Müßiggang ist aller Laster Anfang. Hättest Du Dich nicht wie eine Tagediebin mit der dänischen Edelfrau umhergetrieben, so wärest Du niemals in so sündhafte Grillen verfallen. Wäre Hans Kruse’s Fleisch und Blut in Dir lebendig, da hättest Du Dich aufgemacht, und hättest Du von Thür zu Thür Dich bis nach Hause betteln sollen. Mit Freuden würde ich Dir da die Arme geöffnet haben; doch mit dem vornehmen Gesindel, dem Du jetzt angehörest, habe ich nichts zu schaffen.“
Nachdem er eine Weile geschwiegen hatte, trat er ans Fenster, klopfte seine Pfeife aus, stopfte neues Kraut hinein, zündete sie an, – kurz, er that als ob er die Anwesenheit seiner Tochter ganz vergäße.
„Vater,“ sprach Wiebeke endlich, den gesenkten Kopf mit Selbstbewußtsein aufrichtend und dicht vor den Alten hintretend, „ist dies Euer letztes Wort an Eure Tochter, so verzeihe Euch Gott, vor dem Ihr es dereinst verantworten sollt.“
Danach ging sie zu dem Bruder, der sie mit mehr Neugierde als Herzlichkeit aufgenommen hatte, und fragte: „Ist Clas Soodt noch am Leben?“
„Den begruben wir, als die Wallensteiner hier lagen und wir das Haus bis unters Dach voll von fremden Soldaten hatten,“ erwiderte der junge Bauer.
Wiebeke ließ aus ihrem Wagen ein Päckchen holen, aus dem sie Zuckerbrod und Kleidungsstücke als Geschenke an die Schwägerin und deren Kinder austheilte, lud die Verwandten ein, sie in Bramstedt zu besuchen, und verließ dann wehmüthig das väterliche Gehöft, wohl einsehend, daß sie von dem Bruder keine Fürsprache bei dem Vater zu hoffen habe.
Als Wiebeke heimkam und, bevor sie ins Haus trat, noch einen Gang durch den Garten machte, trat ihr an der Au eine Frau entgegen, in der sie nach kurzem Besinnen die Zigeunerin erkannte, die sie seit Hameln nicht wieder gesehen hatte.
„Nicht wahr, edle Frau, meine Prophezeiungen haben sich an Euch erfüllt: durch einen alten Mann seid Ihr endlich zu Gelde gekommen und in den Besitz eines stattlichen Hauses.“
„Ihr habt Recht, Eure Worte haben tiefe Bedeutung gehabt,“ entgegnete Wiebeke. „Jetzt sagt mir, liebe Frau, ob Ihr einen Wunsch habt, den ich erfüllen kann.“
„Einen solchen Wunsch habe ich lange gehegt, und wenn Ihr ihn nicht zu unbescheiden findet, könnt Ihr ihn jetzt auch erfüllen, indem Ihr mir von dem vielen Lande, daß Ihr besitzt, einen Fußbreit gönnen wollt, wo meine vom Wanderleben müden Beine ausruhen können, bis ich dereinst meinen Kopf für immer niederlege.“
„Den sollt Ihr haben,“ versprach Wiebeke. Nur kann ich aus Gründen, die Ihr so gut kennt wie ich, Euch hier nicht beherbergen. Haltet Euch einige Tage in der Nähe des Fleckens auf und kommt dann wieder, um Bescheid zu holen.“
Ehe noch Wiebeke es verhindern konnte, hatte die Fremde den Saum ihres Kleides geküßt und war hinter den Bäumen verschwunden. Noch an demselben Tage ließ sie den Kirchspielvogt zu sich kommen, dem sie die Angelegenheit vortrug Der alte Herr machte ein bedenkliches Gesicht.
„Ihr wißt, gnädige Frau“, begann er, „daß dieser heimathlose Volkstamm überall mit Mißtrauen angesehen wird. Wolltet Ihr nun gleich im Anfange Eurer Herrschaft einem solchen Heidenweibe mitten unter den ehrsamen Fleckensinsassen eine Wohnung anweisen, so würdet Ihr damit sogleich großes Ärgernis geben.“
Dies leuchtete Wiebeke ein. Ihr Versprechen wollte sie indessen nicht zurücknehmen und fragte, das kluge Auge auf den Ortsbeamten richtend, nach kurzem Bedenken: „Glaubt Ihr, daß ich auch dann mit den guten Bramstedtern in Conflict gerathen würde, wenn ich Ihr vor dem Thore ein Häuschen mit Gartenland anwiese?“
„Dazu hätten sie jedenfalls keine Ursache“, entschied der Beamte. „Nur müßten wir uns davor sichern, daß dadurch nicht der Grund zu einer ganzen Zigeunercolonie gelegt würde.“
„Nichts leichter als das“, erwiderte Wiebeke. „Man kann der Frau einfach die Bedingung stellen, daß sie, in so fern sie hier eine Freistätte zu behalten wünscht, von ihrer Sippe nicht mehr als einen zur Zeit und nicht länger als vier bis sechs Wochen beherbergen darf.“
Der Kirchspielvogt hatte im Laufe des Gespräches mehrmals Gelegenheit gehabt, die Klugheit und den Scharfsinn der neuen Gutsherrin zu bewundern, und obschon er als Fleckensbehörde nicht eigentlich mit den gutsherrschaftlichen Geschäften zu thun hatte, versprach er ihr doch, den Bau und die Einrichtung eines zweckmäßigen Häuschens leiten zu wollen.
Als Wiebeke dem Zigeunerweibe in Gegenwart des Kirchspielvogtes ihren Beschluß in Betreff ihrer Ansiedlung kund that, brach dasselbe in heiße Tränen aus.
„Der Gott, zu dem Ihr betet, möge Euch tausendfach vergelten, was Ihr an mir thut“, rief sie schluchzend. „Ihr könnt mir nimmermehr nachfühlen, wie es schmeckt, wenn der unstäte Fuß auf eigenem Grund und Boden ausruhen darf!“
Diese Worte klangen bedeutsamer in Wiebeke’s Herzen wieder, als die Zigeunerin ahnte. „Eines mußt Du mir jedoch geloben“, sagte sie lächelnd. „Du darfst hier weder Wahrsagerkünste, noch Wunderkuren treiben. Wenn die Leute kommen und Krankheit an Menschen und Vieh von Dir geheilt haben wollen oder wenn sie klagen, daß die Kuh keine Milch, die Milch keine Butter bringt, wenn einer sich an seinem Feinde rächen oder ihn sich zum Freunde machen will: so lache sie aus und heiße sie ihr Anliegen zu dem Herrn Pfarrer tragen. Lässest Du Dich ein- oder zweimal zur Hülfe bewegen, so wirst Du bald erleben, daß Dein Häuschen als Hexennest verschrien wird.“
Der Kirchspielvogt stimmte ein, ermahnte die Frau zu Vorsicht und friedfertigem Verkehr, und diese gelobte mit Herz und Mund, des guten Rathes eingedenk zu sein.
So geschah es, daß die Zigeunerin, die Wiebeke Kruse von ihrer Geburt an beobachtet und in Hameln, ihrer Meinung nach, König Christian IV. das Leben erhalten hatte, jetzt durch die Güte beider in Bramstedt einen Zufluchtsort fand, wo sie bis an ihr letztes Stündlein ein ruhiges stilles Leben führte. Das Häuschen vererbte sich von Kind auf Kind, und noch vor einigen Decennien wohnte vor dem Thore eine „Tatersche“ mit ihrer Tochter.
Die wenigen Wochen, welche Wiebeke Kruse in diesem Jahre in Bramstedt verweilte, entschwanden ihr ungemein schnell. Kein Tag verging, an dem sie nicht mit den Einwohnern in Berührung gekommen wäre. Waren die Eltern nicht bei ihr zu Gaste, so kamen die Kinder, oder sie besuchte selbst ohne Ceremonie die einzelnen Familien. Diese Zerstreuungen füllten indessen nur ihre Mußestunden. Die meiste Zeit hatte sie mit dem Gutsinspector oder mit dem Justitiar zu reden, indem ihre Fragen bis in die kleinsten Einzelheiten der Verwaltung drangen. Besonders angelegen ließ sie es sich sein, die Lebensumstände ihrer Untergebenen kennen zu lernen. Wo sie eine Thräne trocknen, einer Noth abhelfen konnte, that sie es mit Freuden, und ihre Sachkenntniß, ihre Großmuth und Menschenliebe als Gutsherrin, ihre bezaubernde Liebenswürdigkeit im Umgange gewannen ihr alle Herzen, so daß man dieselbe Frau, deren Ankunft man mit so wenig Wohlwollen entgegengesehen hatte, mit allgemeinem, aufrichtigem Bedauern scheiden sah.
Am Abend vor ihrer Abreise, als sie die Kinder zu Bette gelegt, den Peitschenvirtuosen ihr Abschiedsgeschenk gereicht hatte und einsam am Fenster saß, einsam mit ihren Gedanken, die durch alle Freude wie eine leise Klage hindurchgeklungen, die ihrem Gesichte einen Zug von Wehmuth verliehen hatten, den selbst das frohe Lächeln nicht verwischen konnte, – da meldete ein Diener, daß zwei Männer um Gehör bäten.
Wiebeke befahl sie hereinzuführen und als sie den Blick neugierig auf die Thür richtete, gewahrte sie Jörgen Götsche, der den alten Hans Kruse sachte ins Zimmer schob. Freudig überrascht, eilte Wiebeke dem Vater entgegen und schlang beide Arme um seinen Hals.
„Ich wußte, daß Ihr mich nicht so reisen lassen würdet“, sagte sie leise.
„Von selbst wäre ich nicht gekommen, wenn Jörgen Götsche mich nicht hergenarrt hätte“, erklärte Hans Kruse trocken.
„Du wirst es mir dereinst danken“, fiel Jörgen Götsche ein, „denn so wärest Du nimmer mit Ruhe in die Grube gefahren, wenn Du nicht Deine brave Tochter gesegnet und Dich mit Ihr ausgesöhnt hättest.“
„An dem Segen eines Bauern ist ihr wenig gelegen“, spöttelte Hans Kruse.
„Versündigt Euch nicht, Vater“, sprach Wiebeke ernst. „Wo ich weilte, habe ich stets die Lehren meines himmlischen und meines irdischen Vaters vor Augen und im Herzen getragen, – oft, sehr oft habe ich sehnsuchtsvoll Eurer gedacht, und noch zu dieser Stunde gilt mir Eure Liebe, Euer Segen höher als die Gnade des Königs.“
„So entsage dem geborgten Glanze und folge mir“, warf der Vater ein.
„Da wäre ich ein undankbares, herzloses Geschöpf; dann erst hättet Ihr Recht, mir Eure Achtung und Liebe zu entziehen. Aber mein Vater sollte mich eines solchen Treuebruches nicht für fähig halten“, entgegnete Wiebeke mit Würde.
„Ich weiß nichts von der vornehmen Welt und es ist möglich, daß die Tugend dort absonderliche Nebenwege wandelt“, versetzte Hans Kruse. „Bist Du glücklich und zufrieden, so will ich Dein Glück nicht stören. Sei brav vor dem Herrn, Wiebe, er sieht Deine innersten Gedanken und kennt alle Deine Werke. Ich bin nur gekommen, damit Du nicht mit Grillen an Deine Heimath zurückdenkest. Jetzt reise mit Gott!“
„Wie weit ich reise, wie lange ich lebe, so bleibe ich doch stets Hans Kruse’s Tochter aus Föhrden, die einen ebenso festen und, walt‘ es Gott, auch einen ebenso biederen frommen Sinn hat, als ihr Vater,“ fügte Wiebeke gerührt hinzu.
Als Hans Kruse nach mehrstündigem Aufenthalte von seiner Tochter Abschied nahm, da sagte zwar Jörgen Götsche kein Wort, aber er wischte sich mehrmals mit dem Rockärmel die Augen aus und schlich sich fort, ohne Wiebeke die Hand gereicht zu haben.
Im Maimonat trat Wiebeke in Begleitung des Königs die Rückreise nach Dänemark an. Nach Mitsommer hielt Christian IV. sich bleibend in Kopenhagen auf, wo die letzten großartigen Vorbereitungen zur Vermählungsfeier des Kronprinzen mit Magdalena Sybilla von Sachsen betrieben wurden. Von diesem im October mit vieler Pracht gefeierten Feste geben nicht allein dänische, sondern auch französische Geschichtsbücher ausführliche Berichte, die wegen der darin enthaltenen Schilderungen derzeit üblicher Sitten und Festbräuche von hohem Interesse sind. Andere noch vorhandene Schriftstücke zeugen noch heute davon, daß Christian IV. die Anordnungen dieser Feier nicht nur ihren Hauptzügen nach entwarf, sondern bis in die kleinsten Einzelheiten selbst bestimmte. Die Costüme und Decorationen der theatralischen Vorstellungen, die Übungen im Ringelrennen und in anderen Turnierspielen, die Tanzstunden der jungen Edelleute zu dem „Ballet“, die Wohnungen für die geladenen Gäste, sowie die Quartiere für die Dienerschaft bei den Bürgern der Stadt. Quantum und Qualität der Speise und des Getränkes, welches täglich für Königs Rechnung verabreicht werden sollte: alles war von ihm vorher bedacht und festgesetzt, damit die Feier sich zu allgemeinem Wohlgefallen und ohne Störung abwickle. Aber Vorsicht und Fürsorge ungeachtet schrillte doch ein Mißton durch die Harmonie der glänzenden Gesellschaft, den man nicht in Einklang zu bringen, noch zu übertönen vermochte. König Christian hatte nämlich die Einladungen zu der Vermählung seines Sohnes auf alle europäischen Höfe ausgedehnt, von denen die meisten sich durch glänzende Gesandtschaften vertreten ließen. Unter diesen Vertretern so vieler gekrönter Häupter entspann sich ein Rangstreit, welcher bald einen so hohen Grad von Erbitterung erreichte, daß der König in Folge dessen am ersten Hochzeittage nicht an der Tafel erschien, daß der spanische Gesandte inmitten der Feiertage unter nichtigem Vorwande nach Deutschland abreiste und der schwedische unter dem Vorgeben, daß die Hoftrauerum Gustav Adolph ihm nicht gestatte öffentlich zu erscheinen, in seinen Gemächern zu speisen verlangte; aller Zänkereien und Sticheleien unter den übrigen nicht zu gedenken. Die Jugend aber und das Volk ließen sich durch diese thörichten Zerwürfnisse in ihrem Vergnügen nicht stören. Die Königssäle, die Marktplätze, wo das Volk bewirthet wurde, die ganze Stadt hallten wieder von der lauten Festfreude aus- und inländischer Gäste, eigener und fremder Unterthanen.
Daß Wiebeke Kruse bei dieser Gelegenheit nicht bei Hofe erscheinen konnte, ist einleuchtend; doch empfing sie in ihrer Wohnung zahlreichen Besuch fremder und einheimischer Gäste, die alle neugierig waren, eine Frau zu sehen, welche die treue Anhänglichkeit des Königs so zu fesseln, einen so wohlthätigen Einfluß auf ihn zu üben verstand. Wiebeke hatte in der Hauptstadt ihre Freunde und ihre Feinde. Zu den erstgenannten gehörte Prinz Christian, der ihr schon manchen Beweis seiner Gewogenheit gegeben hatte und eben die Tugenden an ihr schätzte, welche er bei der Gräfin Munk vermißt hatte. Zu ihren offenbaren Gegnern gehörte Prinz Friedrich, der keine Gelegenheit verabsäumte sie zu kränken und zu demüthigen und sie stets mit schroffer, hoffärtiger Kälte behandelte.
Am Tage vor seiner Vermählung begab sich der Kronprinz in aller Frühe nach Rosenburg, wo Wiebeke sich damals aufhielt.
„Mich verlangt danach, Euch heute einen Beweis meiner Hochschätzung zu geben, Wiebe,“ sprach er, nachdem er sie und die Kinder begrüßt hatte, „deshalb sollt Ihr zuerst aus meiner eigenen Hand eine jener kleinen Erinnerungsmarken empfangen, die man bei solchen Familienfesten, wie ich es morgen begehe, unter seine Freunde zu vertheilen pflegt.‘ Glaubt nicht, daß ich Eure treue Liebe für den König, das Gute, das Ihr in der Stille wirkt, nicht lange nach Verdienst geschätzt habe, daß ich nicht beklage Eurem segensreichen Walten nicht die öffentliche Anerkennung schaffen zu können, die Euch gebührt, – die Hände der Fürsten sind oft fester gebunden, als andere. Auch unser Auge reicht nicht so weit, wie unser gutes Wollen, daher bitte ich Euch, Wiebe, diesen Ring, den ich Euch heute schenke, wohl zu bewahren. Sollte man Euch in späteren Jahren oder bei Abwesenheit des Königs Unrecht thun, bedürft Ihr jemals eines Vertheidigers oder der Hülfe eines Freundes, so sendet mir diesen Ring, und ich gelobe bei meinem fürstlichen Worte, daß Euch sofort Recht, Schutz und Hülfe werden soll. – Betet für mich, Wiebe, betet, daß mir in der jungen Braut, die ich so wenig kenne, eine Lebensgefährtin gegeben werde, gleich meiner Mutter Anna Catharina, so reich an häuslichen Tugenden, so musterhaft als Gattin und Mutter!“ –
Wiebeke betete aus dem Grunde ihres Herzens für das Glück des liebenswürdigen Prinzen, sie bewahrte sorgsam den kostbaren Armring; aber als die Zeit kam, wo sie eines Freundes, eines Beschützers bedurfte, da ruhte Prinz Christian von Dänemark längst in der Gruft seiner Väter.
XIV.
Jahre vergingen. Christian IV. wurde alt und noch immer war es ihm nicht gelungen den Frieden zwischen den streitenden Parteien zu vermitteln und dem armen, verwüsteten Deutschland Ruhe zu schaffen. Das Weihnachtsfest, welches sämmtliche Kinder um den betagten Vater zu versammeln pflegte, sollte im Jahre 1644 auf Friedrichsburg gefeiert werden, wo der König seit dem Herbst residirte. Wiebeke zählte sehnend die Tage bis zur Ankunft ihrer Kinder, denn ihr Sohn Ulrich Christian besuchte seit mehreren Jahren die Schule zu Soröe, und ihre Tochter wurde bei einer adeligen Familie auf dem Lande erzogen. Mit hausmütterlicher Geschäftigkeit ordnete sie die Weihnachtsgaben für Kinder, Freunde und Dienerschaft, als sie eines Tages durch den Eintritt des Königs überrascht wurde, der einen blonden, wohlgenährten Herrn von mittleren Jahren zu ihr führte.
„Ei, ei, Herr Amtmann, was verschafft uns denn mitten im Winter das Vergnügen, Euch hier zu sehen?“ rief Wiebeke, dem Fremden freundlich die Hand zum Gruße reichend.
„Zum Vergnügen verläßt man sein Haus nicht so nahe vor Weihnacht,“ antwortete der König. „Buchwaldt ist auf der Flucht: die Schweden sind ihm auf den Fersen.“
„Wie soll ich das verstehen?“
„Leider im buchstäblichen Sinne,“ berichtete der Amtmann von Segeberg. „Die Schweden sind wie hungrige Wölfe in’s Land gefallen und werden zur Stunde wahrscheinlich in Schleswig sein.“
„Meine armen Bramstedter!“ klagte Wiebeke. „Aber was kann die Schweden zu so feindlicher Demonstration veranlassen?“
„Das arme Deutschland ist so ausgesogen, daß die kriegführenden Parteien weder Mann noch Roß zu sättigen wissen, weshalb der Vortheil in einem gut verproviantirten Lande Winterquartiere zu gewinnen, ihnen höher gilt als der Ruhm einer gewonnenen Schlacht.“
„Die Ursache steckt tiefer,“ berichtigte der König diese Bemerkung Buchwaldt’s. „Wir hätten längst Frieden gehabt, wenn nicht der schwedische Reichskanzler, der hochstrebenden Pläne seines seligen Königs eingedenk, im Zwiespalte und in der Zerrüttung des deutschen Reiches das fördersamste Mittel sähe, festen Fuß diesseit der Ostsee zu fassen. Er weiß, daß wir bei unseren Friedensvermittelungen seine Projecte nicht begünstigen, und suchte schon lange nach einem Vorwande, seine Truppen in unser Gebiet zu schieben.“
„Und was dient ihm jetzt als Vorwand?“ fragte Wiebeke.
„Die Gastfreiheit, welche ich der Wittwe Gustav Adolph’s erzeige, und die Schärfung des Sundzolles. Es ist allerdings wahr, daß Corsitz Ulfeldt die Handhabung der neuen Zollgesetze etwas auf die Spitze getrieben hat, doch würde ich vor dem angemaßten Herrscherton Axel Oxenstierna’s niemals ein Segel reffen.“
„Mir ist niemals genau bekannt geworden, ob die verwittwete Königin von Schweden Ew. Majestät Schutz angerufen hat oder von Hochderselben zu Gast geladen wurde,“ bemerkte Casper v. Buchwaldt.
„Das laßt Euch von Frau Wiebeke erzählen,“ rief der König aufstehend. „Ich muß meine Befehle zur Abreise nach Kopenhagen ertheilen.“
„Der Reichskanzler trat schon bei Lebzeiten Gustav Adolph’s feindselig gegen die Königin auf,“ erzählte Wiebeke. „Nach dem Tode des Königs wurde sein despotisches Verfahren ihr unerträglich, und als er die junge Königin Christine unter kränkendem Vorwande von der Mutter entfernte, da erklärte diese Schweden verlassen zu wollen. Der Reichskanzler widersetzte sich diesem Wunsche auf’s entschiedenste und von der Stunde an ward Maria Eleonora gleich einer Gefangenen bewacht. Nach vielen vergeblichen Versuchen gelang es ihr einen dänischen Schiffer für ihre Pläne zu gewinnen, und so begab sie sich, als sie einst im Schloßparke zu Gripsholm, nur von einer Hofdame begleitet, spazieren ging, wie zum Scherz an Bord der dänischen Schute und verließ als Flüchtling das Land, wo sie vor zwanzig Jahren als Königin eingezogen war.“
„So weit ist mir die Geschichte bekannt,“ fiel Buchwaldt ein, „nur die wahre Veranlassung zu ihrer Landung in Dänemark ist mir niemals klar geworden.“
„Das Fahrzeug, welches sie nach der Pommerschen Küste bringen sollte, wurde durch Sturm nach den dänischen Inseln verschlagen, wo die arme Frau an’s Land stieg und den König um gastfreie Aufnahme bat. Se. Majestät gab nur widerstrebend seine Einwilligung. Wohnung, Haushalt, ja die Kleidung hat sie, weil Schweden und Brandenburg jede Unterstützung verweigerten, von König Christian empfangen, und als dieser neulich seine Zwillingstöchter vermählte und die Wittwe Gustav Adolph’s Mutterstelle bei den Bräuten vertrat, hat sie darüber von Oxenstierna einen kränkenden Verweis erhalten.“
„Wohnt sie noch auf Ibstrup?“ fragte der Amtmann.
„Sie ist jetzt auf Gottorp zum Besuch. Auch sind Aussichten da, daß der Markgraf von Brandenburg ihr endlich in Köslin einen Wohnsitz anweisen wird. – Aber jetzt erzählt mir von meinen Bramstedtern, Herr Amtmann. War der Flecken bei Eurer Durchreise schon von Schweden besetzt?“
„Das könnt Ihr unterwegs besprechen,“ rief der wieder eintretende König dazwischen. Ich reise binnen einer Stunde und vermuthe, daß Du mich begleiten willst, Wiebe. Der Amtmann fährt mit uns nach Kopenhagen.“
Wiebeke nickte bejahend und ging um sich reisefertig zu machen, in ihr Zimmer. Alle Weihnachtfreuden waren für dies Jahr vereitelt.
——————
Die Beschuldigung, daß die dänischen Gesandten bei dem Friedenscongresse in Osnabrück zum Schaden der Schweden heimlich mit dem Kaiser unterhandelt hätten und die Schärfung des Sundzolles dienten in der That diesem plötzlichen feindlichen Ueberfalle zum Vorwande. „Der Krieg selbst war die Kriegserklärung,“ sagt Schiller in seiner Beschreibung dieses Feldzuges. – General Torstenson war in Mähren, als er aus Stockholm den Befehl erhielt, nach dem Norden aufzubrechen und in Holstein einzurücken. Der kluge Feldherr wußte seine wahre Absicht so geschickt zu maskiren, daß weder Freund noch Feind das wahre Ziel seines Marsches zu errathen vermochte. Zweimal ließ er an verschiedenen Puncten eine Brücke über die Elbe schlagen, ohne den Fluß zu passiren, bis er im December Havelberg erreichte und dort seinen erstaunten Officieren die willkommene mittheilung machte, daß sie den Weihnachtbraten im gelobten Lande Holstein essen würden. Unaufhaltsam drangen die Schweden vor; nur Glückstadt und Crempe hielten sich. Am 18. December befand sich das Hauptquartier schon in Hadersleben. Der Plan der schwedischen Regierung war folgender: Lennart Torstenson sollte, nachdem er das Festland eingenommen, nach den Inseln übergehen und sich dort mit einem von Schonen herüberkommenden zweiten Heere vereinigen. Auf diese Weise würde das ganze dänische Reich in schwedischen Händen und König Christian gezwungen sein, die härtesten Forderungen von Seiten Oxenstierna’s gutzuheißen. Christian IV. errieth diesen Plan. Die schonische Armee ließ sich nicht blicken, und die wiederholten Versuche Torstenson’s, auf Fühnen zu landen, wurden stets vereitelt.
Wir wollen jedoch dem Gange unserer Erzählung nicht vorgreifen.
In Kopenhagen angekommen, berief der 67jährige König sogleich seine Räthe und schilderte mit jugendlichem Feuer die Gefahr des Landes und daß in raschem, einmüthigem Handeln das einzige Mittel zur Rettung liege. Man begann nach Kräften zu rüsten und sich nach fremder Hülfe umzusehen. Der Kaiser ward ersucht ein Hülfscorps zum Entsatze des bedrängten Dänemarks nach dem Norden zu senden; mehre Schiffe gingen in See um das nöthige Kriegsmaterial herbeizuholen, und da der Staatsschatz durch die langjährigen Kriegsrüstungen und kostbaren Bauten erschöpft war, ließ König Christian von dem kostbaren Silbergeräthe zu Friedrichsburg einschmelzen und daraus Geld prägen. Noch im December ging er nach Fühnen, wo er bis Ende Februar blieb, um die Küstenvertheidigung selbst zu betreiben. Im März ließ er die Flotte und für seine eigene Person das Linienschiff „Die Dreifaltigkeit“ ausrüsten, auf welchem auch für Wiebeke Kruse eine besondere Kajüte eingerichtet wurde.
Im April lief die Flotte aus und stieß in der Lister Tiefe auf ein Geschwader, welches Louis de Geer für schwedische Rechnung in Holland ausgerüstet hatte. Der Kampf, welcher sich zwischen den Schiffen entspann und sich am nächsten Tage wiederholte, blieb ohne entscheidenden Vortheil für beide Parteien. Das Schiff des Königs ging zu tief um de Geer verfolgen zu können, der einen holländischen Hafen aufsuchen mußte, um seine beschädigten Schiffe ausbessern zu lassen. König Christian segelte einstweilen nach Kopenhagen um sich zu einer neuen Besprechung auf blauer See mit dem Nachbar vorzubereiten.
Nachdem die Schiffe, welche die Wiederkehr des holländischen Geschwaders hindern sollten, ausgelaufen waren und auch der König wieder unter Segel zu gehen im Begriff stand, sagte er eines Abends zu Wiebeke:
Wenn ich sterben sollte, so wird der Kronprinz an statt meiner dafür sorgen, daß Ulrich und Elisabeth stan desgemäß erzogen und versorgt werden. In seinem Schutze wirst auch Du vor böswilligen Angriffen Dir übelgesinnter Leute sicher sein.“
„Welche Gedanken! Mit so trüben Ahnungen seid Ihr niemals dem Feinde entgegen gegangen, mein König!“
„Einmal muß das erste Mal kommen,“ versetzte Christian IV. mit trübem Lächeln. „Ich wünsche auch, daß Du mich diesmal nicht begleitest, sondern meine Rückkehr hier abwartest. Du hast bei Sylt erfahren, daß die Greuel einer Seeschlacht nicht für Frauennerven taugen. Deine Wange erblaßte und Entsetzen sprach aus Deinen Zügen, wenn auch die Lippe stumm blieb.“
„Einen so grausamen Befehl kann Ew. Majestät nicht im Ernste aussprechen,“ rief Wiebeke. „Tausendfältige Qualen würde ich leiden, müßte ich hier zurückbleiben und meinen Herrn in steter Lebensgefahr wissen. Eure Jahre lang mir gnädig bewahrte Liebe giebt mir das Recht die schweren, wie die frohen Stunden mit Euch zu theilen.“
„So thue, wie Du willst,“ sprach der König gerührt. „Deiner selbst, Deiner Kinder willen durfte ich Dein Leben nicht abermals in Gefahr bringen, aber…. Du hast Recht, wir stehen überall in Gottes Hand.“
Christian IV. kannte keine Furcht. Mit unerschütterlicher Ruhe hatte man ihn im dichten Kugelregen den Gang der Schlacht beobachten oder an der Spitze seiner Getreuen sich in das wildeste Schlachtgetümmel stürzen sehen, wo er sein Leben tausendfältiger Gefahr bloßstellte. „Ihm fehlt zu einem vollkommenen Feldherrn nichts als das Glück,“ hatte Tilly einst über ihn geäußert. Desto mehr beunruhigte es seine Freunde als er diesmal mit düsterer Vorahnung, gleich einem Sterbenden, sein Haus bestellte. Dem Kronprinzen übergab er feierlich Scepter und Krone, ernannte ihn zum Vormund der übrigen Kinder, traf manche Bestimmung in Privatsachen und ließ sich, bevor er an Bord ging, das Abendmahl reichen.
Mit trübem Herzen sah man den geliebten König scheiden, dem noch kurz vor seiner Abfahrt die Kunde gebracht war, daß Fehmarn von den Schweden genommen sei, – ein Verlust, dem er gerade hatte vorbeugen wollen.
Die Flotte, mit welcher König Christian diesmal auslief, bestand aus 9 Schiffen ersten Ranges, aus 20 Schiffen zweiten Ranges und 11 Fregatten und Galeeren. Sie war in drei Geschwader getheilt, von denen das erste unter dem Befehle des Reichsadmirals Jörgen Wind stand, das zweite unter dem Admiral Peter Galt, das dritte unter dem Könige, dem der Viceadmiral Pros Mundt folgte.
Am 30. Juni war die Flotte ausgelaufen, und schon am 1. Juli traf sie zwischen Laaland und Falster mit dem 46 Schiffe starken Feinde zusammen. Der Kampf dauerte zehn Stunden, indem er viermal erneuert wurde. Zuerst sah sich das Admiralschiff umringt und Jörgen Wind ward von einer Kugel am Knie verwundet, woran er nach einigen Tagen starb. Bei dem zweiten Angriffe Flemming’s kämpfte „die Dreifaltigkeit“ lange allein gegen die feindliche Übermacht, weil die anderen Schiffe in Lee lagen und den König nicht nach Gebühr unterstützten. Auch hier sah man Christian IV., wie in der Schlacht bei Sylt, mit gezogener Waffe auf der Schanzbrücke selbst das Commando führen. Die frische Seeluft hatte alle trüben Gedanken längst verscheucht und die Heiterkeit des Königs, sein persönlicher Muth feuerten die Mannschaften zu heldenmüthiger Todesverachtung an.
Da geschah es, daß eine feindliche Kugel den Zündlochdeckel einer Kanone traf, welche der König gerade mit eigener Hand richtete, so daß Holz- und Eisensplitter umherflogen. Die Kugel selbst traf Eiler Ulfeldt, welcher neben dem Könige stand; der Zündlochdeckel zerschmetterte Knuth Ulfeldt’s Arm, und mit diesen beiden stürzte auch Christian IV. zu Boden.
„Der König ist getroffen,“ scholl es wehklagend übers Deck, und dieser Ruf traf auch Wiebeke’s Ohr, welche in qualvoller Angst in ihrer Kajüte den Vorgängen auf dem Verdeck gelauscht hatte. Das Verbot des Königs vergessend, stürzte sie die Treppe hinan und bahnte sich einen Weg über Verwundete und Tote, bis sie den Ort erreichte, wo der König, den über ihm liegenden todten Körper Ulfeldt’s wegstoßend, sich zur Freude der Seinen wieder erhob. Sein von Blut triefendes Gesicht hinderte ihn zu sehen, was um ihn vorging; auch konnte er über die erhaltene Verwundung keine Auskunft geben. Bald genug erkannten die Ärzte, daß das rechte Auge verloren, das linke leicht beschädigt sei und daß ein anderer Splitter ihm zwei Zähne ausgeschlagen habe. Als er die allgemeine Bestürzung wahrnahm, sprach er laut: „Worüber jammert Ihr, Kinder? Habe ich auch eine Schramme bekommen, so hat Gott mir doch das Leben gelassen und Kraft und Muth Euch zur Seite zu stehen, so lange ein Jeder seine Schuldigkeit thut!“ Vor den Augen der Soldaten ließ er sich dann verbinden und blieb auf dem Verdeck, bis ein aufkommender Wind die Schiffe trennte und somit den Streit endigte.
Als Christian IV. allen Pflichten des Königs und Feldherrn genügt hatte und endlich Mensch sein, d. h. sich seinen körperlichen Schmerzen hingeben, seine Wunden pflegen durfte, da sagte er, nachdem Wiebeke, welche nasse Polster auf sein glühendes Gesicht legte, eine Weile stumm an seinem Lager gesessen hatte:
„Weißt Du auch, daß Du heute zum ersten Mal ungehorsam gewesen bist?“
„Ich weiß es,“ antwortete Wiebeke.
„Du glaubtest wohl meine zerschossenen Augen würden Dich nicht sehen und ich würde Deine Anwesenheit gar nicht bemerken?“
„Nein, Majestät,“ versetzte Wiebeke ernst. „Als ich aufs Verdeck eilte, wußte ich nicht wie groß das Unglück sei, von dem wir in der Person unseres Königs betroffen waren. Als ich Euch verwundet und zugleich so groß und standhaft vor mir sah, da hätte keine menschliche Gewalt, selbst nicht der Befehl aus Eurem eigenen Munde mich bewegen können, meinen König zu verlassen.“
„Du glaubst wohl, ich sah nicht, wie der Schreck Deine Züge erstarren machte, so daß Dein Antlitz wie aus Stein gemeißelt schien!“
„Mein König thäte besser nicht mehr zu reden und ein wenig zu schlummern. Wer weiß, wie sehr er morgen seine Kräfte nöthig haben wird.“
„Du bist zum Weibe eines Helden geboren, Wiebe,“ rief König Christian, „und Du verdienst besser, die Krone zu tragen, als manche geborene Fürstin!“
„Der Hofmarschall Rothkirsch sagte einst bei einer ähnlichen Äußerung Ew. Majestät, daß jedes tugendhafte, pflichtergebene Weib eine Krone trage, obwohl dieselbe nur dem allsehenden Gotte wahrnehmbar sei.“
„Der Wenzel ist ein Schwärmer,“ versetzte der König. „Wenn er Dich heute gesehen hätte, wie Du ohne Furcht beim Krachen der Geschütze im Pulverdampfe standest, ohne Klagen zwischen den Verwundeten einherwandeltest, Hülfe und Erquickung spendend, da hätte er Dir vielleicht eine auch dem sterblichen Auge sichtbare Krone gewünscht.“
„Ein besserer Wunsch wäre die Erhaltung Eurer Augen“, versetzte Wiebeke.
„Ich habe ja eins behalten. Und klingt es nicht viel schöner, wenn man in späterer Zeit von Christian IV. erzählt, er habe das Auge in der Schlacht eingebüßt, als wenn man von Johann dem Einäugigen hört, der Hofnarr habe es ihm bei Tische mit einem Knochen ausgeworfen?“
„Ew. Majestät scherzt über das eigene Unglück,“ sagte Wiebeke wehmüthig und ward dann still und einsylbig, um dem König etwas Ruhe zu gönnen; doch dauerte es lange, bis ein sanfter Schlummer seinem erschütterten Körper Ruhe brachte.
Am folgenden Tage ergab es sich, daß das Schiff des Reichsadmirals so stark beschädigt war, daß es mit den Verwundeten nach Kopenhagen zurückgesandt werden mußte. Der König steuerte gleichfalls nordwärts, weil ein Gerücht die Annäherung des holländisch-schwedischen Geschwaders verkündete. Die beiden anderen Abtheilungen der dänischen Flotte sollten unter Peter Galt in der Ostsee kreuzen und den Feind aufsuchen. Da erfuhr man, daß die ganze schwedische Flotte in den Kieler Hafen eingelaufen sei. Christian IV. frohlockte über diese Nachricht, die ihm mit der Vernichtung der schwedischen Flotte gleichbedeutend schien. Er befahl dem Admiral Galt, den Einlauf des Hafens zu sperren und jedem Versuche des Feindes, die Durchfahrt zu erzwingen, mit allen Kräften entgegenzutreten. An den Küsten ließ er die Schanzen besetzen und so oft die Schiffe sich dem Lande näherten, ein heftiges Feuer aus den Batterien auf sie richten. Alle Zufuhr von Proviant war den Schweden abgeschnitten, die obendrein den Tod Claus Flemming’s, ihres beliebten tapfren Admirals, zu beklagen hatten; kurz die ganze Flotte schien unvermeidlich verloren – als sie eines Abends bei einer frischen Kühlte auszulaufen versuchte und, unbelästigt von den Dänen, die offene See gewann.
Christian IV. ward durch diese Nachricht so schmerzlich betroffen, so entrüstet, daß der bejahrte Admiral Peter Galt seine Fahrlässigkeit mit dem Tode büßen mußte. Noch größerer Kummer stand dem König bevor. Als er im Herbste, nachdem er lange an der holsteinischen Küste dem Feinde zum Schaden gekreuzt hatte, von Kopenhagen nach Schonen hinübergegangen war, empfing er dort die Unglücksbotschaft, daß nach der Statt gehabten Vereinigung der holländischen und schwedischen Flotte beide gemeinschaftlich die dänische aufgesucht und zu einem Gefechte gezwungen hatten, welches unglücklich für Dänemark ausgefallen war. Die Schiffe waren theils vernichtet, theils den Schweden in die Hände gefallen. Der Admiral Pros Mundt hatte die Vernichtung der ihm anvertrauten Seemacht nicht überlebt, und so war die dänische Flotte von dem Schicksale getroffen, welches Christian IV. vor wenigen Monden über die schwedische verhängt zu haben gemeint hatte.
————————-
In Holstein hatte die Besatzung von Glückstadt und Crempe häufige Ausfälle gemacht und den Schweden manchen empfindlichen Schaden zugefügt. Auch die Bauern rotteten sich nicht selten in bewaffneten Scharen zusammen, wenn es galt einen feindlichen Transport an Vieh oder Proviant aufzufangen.
So glückte es einem jungen Bauern aus Schmalfeldt, Namens Hans Prunz, welcher in Erfahrung gebracht hatte, daß der schwedische Oberst Slebusch mit 400 Ochsen von Altona über Ulzburg kommen werde, eine befreundete Schar um sich zu sammeln, mit der er sich im Westerwohld in Hinterhalt legte, um dem Feinde aufzulauern. Als derselbe ahnungslos die breite Straße zwischen Ulzburg und Kaltenkirchen daherkam, fielen die Schmalfelder über ihn her, trieben nach kurzem Gefechte den Obersten mit seinen 50 Reitern in die Flucht und führten die erbeuteten Ochsen nebst einer beträchtlichen Menge anderer Waaren und Kostbarkeiten im Triumph nach Kaltenkirchen.
Trotz zahlreicher ähnlicher Scharmützel vermochte man dem Feinde doch keinen fühlbaren Verlust zu verursachen. Der deutsche Kaiser konnte das bedenkliche Anwachsen der schwedischen Macht und die Unterdrückung der Dänen nicht gleichgültig ansehen und sandte deshalb im Juli unter Gallas Befehl ein Heer von 10000 Mann nach Holstein, wo dasselbe erschien, als die schwedische Flotte im Kieler Hafen blockirt lag und Graf Torstenson das Gros seiner Armee in Nordschleswig zusammengezogen hatte. Zu General Gallas stießen die mittlerweile geworbenen dänischen Truppen und der Erzbischof Friedrich von Bremen (der Sohn Christian’s IV.) mit 3000 Mann.
Torstenson, dem durch diese ansehnliche Heeresmacht der Rückzug abgeschnitten war, wandte sich an den in schwedischen Diensten stehenden General Königsmark mit dem Begehren, den kaiserlichen Truppen nachzurücken, um dieselben von Norden und Süden zugleich anzugreifen, und zu fangen oder zu vernichten. Königsmark sah sich aus Mangel an Leuten nicht im Stande diesem Wunsche nachzukommen, sondern verlangte statt dessen daß man ihm einige Regimenter zur Hülfe sende. Lennart Torstenson sah sich auf seine eigene Klugheit angewiesen und, Dank seiner bewundernswerthen Geschicklichkeit und der Achtlosigkeit und Unthätigkeit des kaiserlichen Generalissimus, gelang es ihm sich unbelästigt nach Holstein und bis an die Elbe zurückzuziehen. Erst da setzten die kaiserlichen und dänischen Truppen ihm nach, und die erstgenannten verfolgten ihn bis nach Magdeburg, wodurch die Herzogthümer sich unverhofft von der drückenden Kriegslast befreit sahen. Friede war damit zwar noch nicht; die zurückgebliebenen Schweden richteten noch ein ganzes Jahr lang viel Unheil an; in vielen Gefechten zu Wasser und zu Lande floß das Blut des nach Frieden sich sehnenden Volkes, bis dieser endlich im August 1645 zu Brömsebro geschlossen wurde, wenngleich unter Bedingungen, die für Dänemark sehr hart und schmerzlich waren.
XV
König Christian IV. hatte während seiner langjährigen Regierung wenig Ruhe genossen, und selbst in seinen letzten Regierungsjahren blieb er von Sorgen und Leid mannichfachster Art nicht verschont. Nach dem Frieden von Brömsebro ließ er es sein Hauptstreben sein die tiefen Wunden zu heilen, welche die oft wiederholte Kriegsnoth seinen Landen geschlagen hatte. Er suchte die zerrütteten Finanzen zu bessern und sein Reich durch zwecksmäßige Vertheidigungsanstalten zu Wasser und zu Lande vor einem plötzlichen feindlichen Überfalle zu schützen.
War er schon seit dem letzten Kriege, vielleicht auch durch den Verlust des Auges, merkbar gealtert, so schlug ihm das Jahr 1647 eine Wunde, von welcher er sich nicht wieder erholte. Der Gesundheitszustand des Kronprinzen hatte ihm seit einigen Jahren gerechte Besorgnisse eingeflößt. Nach einem überstandenen schweren Krankenlager blieb derselbe in einem Zustande von Entkräftung, welchen die Ärzte nur durch den Gebrauch eines deutschen Bades heben zu können glaubten. Der Prinz erreichte jedoch den bestimmten Curort nicht mehr, sondern erlag seinen Leiden in einem kleinen Orte unweit Dresdens, wohin der Kurfürst und die Kurfürstin von Sachsen eilten, um ihrer Tochter in den trüben Tagen tröstend zur Seite zu stehen. Die Leiche ward in Dresden mit großer Pracht beigesetzt und im September nach Kopenhagen geführt, wo der König seinen erwählten Nachfolger mit außergewöhnlichen Ehren in der königlichen Gruft zu Rothschildt bestatten ließ.
Von dem Tage an schwanden auch die Kräfte des Königs mehr und mehr. Er fühlte sich nicht im Stande, dem im Januar 1648 in Kiel zusammentretenden Landtage persönlich beizuwohnen, und hielt sich größtentheils zu Friedrichsburg auf. Regierungsgeschäfte und Privatangelegenheiten verschiedenster Art füllten seine Tageszeit aus; seine Erholungsstunden brachte er mit Wiebeke zu, welche immer gleich liebevoll für seine Pflege und Erheiterung sorgte, und bei der auch sein Schmerz über den Tod des Lieblingssohnes innigeres Verständniß gefunden hatte, als bei dessen nächsten Blutsverwandten.
„Laß uns einmal nachdenken, was für Feinde Du haben kannst, Wiebe,“ sprach Christian eines Tages, als er sich nach Entfernung der Hofcavaliere mit ihr allein befand.
Den Namen des nunmehrigen Kronprinzen Friedrich, der sich ihr unwillkürlich aufdrängte, verschweigend, sagte sie: „Die Anhänglichkeit, welche die Töchter der Gräfin Munk mir früher bezeigten, ist zwar seit ihrer Vermählung erkaltet, doch glaube ich nicht, daß sie mir feind sind.“
„Und Ellen Marswin?“
„Frau Ellen hat mir allerdings seit ihrem letzten Proceß mit Ew. Majestät ihre Freundschaft entzogen, doch möchte ich auch sie nicht für meine persönliche Feindin halten; viel eher kann ich die alte Dorthe als solche betrachten.“
„Dann ist es Frau Kirstin, die in Jütland Langeweile verspürt und sich irgend einen Zeitvertreib schaffen will,“ rief der König. „Wie tief und wie lange sie ihren Rheingrafen betrauert hat, *)( der Rheingraf Ludwig Otto v. Solms war im Jahre
1634 in Deutschland gestorben, Anm. J.M.) weiß ich nicht. So lange die schwedischen Officiere als ungebetene Gäste in Jütland weilten, hat sie nach Kräften für deren Zerstreuung gesorgt, jetzt muß sie auf neue Kurzweil sinnen.“
„Ich verstehe nicht, warum Ew. Majestät Frau Kirstins Langeweile mit ihrer Feindschaft für mich in Zusammenhang bringen will.“
„Das will ich Dir sagen. Deine Feinde, einerlei, wer und wo sie seien, haben ihre Mußestunden dazu benutzt, eine Anklage auf Dich zu wälzen, welche in den Händen eines bestochenen oder unwissenden Richters schlimm genug für Dich ausfallen könnte.“
„Und wessen klagt man mich an?“
„Nachweislich betriebener Hexenkünste.“
Wiebeke erblaßte. Diese Anschuldigung, die uns heut zu Tage höchstens ein Lächeln abnöthigt, war zu einer Zeit, wo die Hexenprocesse noch an der Tagesordnung waren, sehr ernster Natur, indem sie nicht selten persönlicher Feindschaft als Mittel diente, durch gerichtliche Bestrafung der unschuldig Angeklagten ihrem Rachedurst Befriedigung zu verschaffen.
„Die Anklägerin, ein altes Weib, behauptet mit Zeugen nachweisen zu können, daß Du Dir von einer Hexe ein Zaubermittel verschafft und bei mir angewandt habest, welches meine Liebe von Frau Kirstin ab und Dir zugewandt. Nachdem das Mittel sich wirksam erwiesen, habest Du die Hexe reich belohnt, indem Du ihr in Bramstedt ein Haus geschenkt und festen Wohnort angewiesen.“
„Diese Anschuldigung ist um so verfänglicher, da sie eng mit der Wahrheit zusammenhängt,“ sprach Wiebeke. „Ich erzählte Ew. Majestät einmal, daß mir, als ich noch in den Windeln lag, von einem Zigeunerweibe ein wechselvolles, seltsames Leben prophezeiet worden. Es ist Euch ferner nicht unbekannt geblieben, daß dasselbe Weib mir abermals begegnete, als wir in Hameln mehre Nächte trostlos an Eurem Lager durchwacht hatten, und daß sie mir aus persönlichem Interesse für Ew. Majestät ein Mittel einhändigte, welches Euch ins Bewußtsein zurückrufen werde, und das, nachdem die Ärzte es für unschädlich erklärt hatten, mit Frau Kirstin’s Genehmigung angewandt wurde. Daß es nicht die von meiner Anklägerin angegebene Wirkung auf Ew. Majestät übte, weiß Ew. Majestät ebenso gut, ja besser als ich. Wahr ist es, daß diese Zigeunerin mich bei meinem ersten Besuche in Bramstedt um eine Zufluchtstätte bat, die ich ihr, Dank der Gnade und Großmuth meines Königs, gewähren konnte. Es geschah übrigens mit der Bewilligung des Magistrats; ja, der Kirchspielvogt übernahm, um sich mir gefällig zu erweisen, selbst die Leitung des Baues.
„So kann die einfachste Sache, ja, eine gute That durch böse Zungen zum strafwürdigen Verbrechen gestempelt werden,“ rief der König. Danken wir Gott, mein Kind, daß diese Anfeindung ans Licht trat, so lange meine Augen noch über Dich wachen, so lange meine Hand Dich vor den Anschlägen Deiner Feinde schützen kann. – Du hast Recht, die alte Dorthe ist Dir niemals hold gewesen. Sie war es, welche Christine’s Gunst von Dir abwandte, und noch weniger als die Gewogenheit ihrer Herrin wird sie Dir einen Platz gönnen, auf dem vor Dir Christine Munk so manches Jahr Ehre und Ansehen genossen hatte.“
Auch bei den ferneren Verhören der Alten war der König gegenwärtig, wo es sich denn auch wirklich herausstellte, daß sie das gedungene Werkzeug anderer sei. Auf Wiebeke’s Fürbitte ward nun zwar die Strafe der einfältigen Frau um vieles gemildert; doch ließ der König, welcher die Sache mit großem Ernste behandelte, ein beglaubigtes Protocoll von derselben aufnehmen und fertigte darauf ein eigenhändiges Schreiben nach Boller, in welchem er Frau Christine sammt ihren Verwandten, Freunden und Dienern unter Androhung schärfster Ahndung verbot, jemals wieder einen Versuch zu wagen, unschuldige Menschen vor dem weltlichen Richter anzuschwärzen.
Christian IV. hatte in den letzten Jahren an Schwindel und Verdauungschwäche gelitten und oft halb im Scherze, halb im Ernste geäußert, daß er die Gebrechen des Alters, die Vorboten des Todes zu spüren beginne. Sein rasches, lebhaftes Wesen, seine täglichen Spaziergänge und geistigen Arbeiten täuschten seine Umgebung lange über den Zustand seiner Gesundheit, und erst als im Februar sich eine große Mattigkeit und Schlaflosigkeit zu den anderen Übeln gesellte, ward die Besorgniß der Ärzte geweckt, welche alles aufboten, um das Leben des geliebten Fürsten noch um einige Jahre zu verlängern. Strapazen, Sorgen, Gemüthsbewegung und rastlose Thätigkeit hatten endlich auch diese eisenfeste Gesundheit untergraben, diesem thatenreichen Leben ein Ziel gesetzt.
Der König selbst war sich seines Zustandes sehr wohl bewußt. Am 21. Februar ließ er sich in einem mit acht Pferden bespannten Schlitten von Friedrichsburg nach Rosenburg bringen. Wiebeke Kruse bereitete sich zu dieser Reise mit schwerem Herzen. Sie verließ den alten Herrn nicht mehr; doch als dieser in Rosenburg neu gestärkt schien und sich noch täglich alle einlaufenden Briefe und Bittschriften vorlegen ließ, ja selbige zum Theil selbst beantwortete, da schöpfte sie neue Hoffnung, die sie auch dem Könige einzuflößen suchte.
Der schwache Hoffnungsschimmer verlosch indessen nur allzu rasch. Am 26. Februar fühlte Christian IV. sich so schwach, daß er das Bett nicht verlassen konnte. Eleonore Ulfeldt, die Lieblingstochter, die ihn täglich besucht hatte, erschien am Abend mit ihrem Gemahle und verlangte von Wiebeke, sie möge sich zurückziehen, da sie selbst mit dem Reichshofmeister bei dem Könige wachen wolle.
„Sr. Majestät ist zu sehr an meine Pflege gewöhnt,“ wagte Wiebeke verletzt einzuwenden.
„Ich glaube nicht, daß der König die Hand seiner Tochter minder sanft und liebreich finden wird, als die Deine,“ erwiderte Eleonore.
„Geh‘, liebe Wiebe, Du hast so lange mit und bei mir gewacht, daß Du wohl eine Nacht ungestörten Schlafes nöthig hast,“ sprach der König, ihr freundlich die Wange streichelnd.
Durch den bittenden Blick, durch die sanfte immer noch so klangvolle Stimme bezwungen, vermochte Wiebeke nicht, seinem Wunsche zu widerstreben; doch verließ sie mit tiefem Schmerze das Zimmer, wo sie allein das Recht hatte, zu wachen, und doch dies Recht nicht geltend machen durfte.
Als sie sich nach durchwachter Nacht früh Morgens wieder ins Krankenzimmer begab, sprach der König zu Tochter und Schwiegersohn: „Jetzt mögt Ihr einstweilen gehen und der Ruhe pflegen. Ihr seid es nicht gewohnt, den Schlaf zu entbehren, wie meine arme Wiebe. Ich möchte noch eine Stunde mit ihr allein bleiben. Wenn heute Mittag der Hofprediger kommt, wünsche ich Euch alle um mich versammelt zu sehen.“
Nachdem Corfitz Ulfeldt mit seiner Gemahlin fortgegangen war und die im Nebenzimmer wachenden Ärzte und Hofherren sich dahin zurückgezogen hatten, begann König Christian, Wiebeke’s Hand fassend:
„Ich werde nicht lange mehr bei Dir weilen, mein liebes Kind… Ein Trost bleibt mir, daß für Deine Zukunft gesorgt ist, auch habe ich Dich dem Schutze des künftigen Königs empfohlen. – – – Mein Wunsch ist,“ fuhr er nach einer Pause fort, „daß Du Deinen bleibenden Aufenthalt in Kopenhagen nehmest, bis Deine Kinder ihr eigenes Nest bauen; später wirst Du vielleicht angenehmer in Bramstedt wohnen. An Ulrich Christian wirst Du Freude haben. Er gleicht in vielen Dingen seinem Halbbruder, dem seligen Prinzen Ulrich: er liebt das Kriegshandwerk, er ist tapfer und gut geschult, ein braver, liebenswürdiger Jüngling, der dereinst als ruhmgekrönter Kriegsmann zu Dir heimkehren wird. Elisabeth wird hoffentlich die Tugenden ihrer Mutter erben und an Claus Ahlefeldt’s Hand glücklich durchs Leben gehen. Ihr Verlöbniß soll jedoch erst nach einigen Jahren Statt finden.“
Seitdem Wiebeke Kruse wußte, daß ihr Freund nur noch wenige Stunden unter den Lebenden weilen werde, war sie schweigsam und scheinbar theilnahmlos geworden. Auch jetzt drückte sie stumm des Königs Hand, nur aus ihren Augen sprach unverhohlen der Schmerz, dem ihre Seele fast erlag.
„Du darfst nicht trauern über meinenHingang,“ sprach der König weich. „Wir sehen auch hier die Weisheit und ewige Güte des Herrn, indem er mich abruft, bevor meine Hand zu schwach wird, das Staatsruder zu lenken. Du, meine treue Wiebeke, bist vielleicht die einzige, die nicht mit den übrigen rufen wird: „Der König ist todt, – es lebe der König!“ Für Dich stirbt König Christian, für die übrigen ersteht Friedrich III., auf dem die Hoffnung des Landes, wie des einzelnen Staatsbürgers zuversichtlich ruht. Du wirst mir ein stilles Andenken weihen in dem schönen Bewußtsein, daß Du achtzehn Jahre lang Lust und Leid mit mir getheilt, mein Alter versüßt hast und daß mein letztes Wort, mein letzter Gedanke an Dich ein Dank, ein Segenswunsch war.“ – –
Dies war die letzte trauliche Unterredung, welche König Christian IV. mit Wiebeke Kruse hielt. Bald darauf traten der Reichskanzler, der Reichshofmeister und die Töchter der Gräfin Munk: Eleonore und Hedwig an das Lager des hohen Kranken, und um 1 Uhr erschien auch der Hofprädicant Lauritz Jacobson.
„Hier liege ich wie ein Gefangener des Herrn,“ rief der König ihm entgegen und reichte ihm die Hand zum Gruße.
„Gott pflegt seine Kinder mit Krankheiten und sonstigen Leiden zu behaften, um sie desto näher zu sich zu ziehen,“ sprach der Prediger, „und möchte ich deshalb Ew. Majestät ermahnen, Euren Sinn unablässig dem Herrn zuzuwenden, obschon ich weiß, daß Ihr Gott und Jesum Christum allezeit im Herzen getragen habt.“
„Ne dubites….. zweifelt nicht daran,“ erwiderte der König. Darauf lag er eine Weile still, als schlummere er, und forderte dann den Prediger auf, ihm ferner von‘ der Güte und Barmherzigkeit Gottes zu erzählen. Nach einer längeren Rede, die mit Gebeten der Anwesenden abwechselte, trat Eleonore an das Lager ihres Vaters und fragte, ob er wünsche, daß sie ein geistliches Lied vor ihm sängen. Christian, welcher stets großes Gefallen am Kirchengesange gehabt hatte, bejahte und lauschte mit Vergnügen dem Gesange, den seine Töchter anstimmten und in welchen alle Anwesenden einfielen.
Wiebeke Kruse war eine gottesfürchtige, fromme Christin und fleißige Kirchengängerin, aber dies viele laute Reden, Beten und Singen am Sterbebette verletzte sie. Viel lieber hätte sie ihre Kammer aufgesucht, hätte dort in aller Stille ihr Herz zu Gott erhoben und für den scheidenden Freund gebetet, hätte nicht der Wunsch, ihn anzublicken und so lange wie möglich seine liebe Stimme zu hören, sie in seiner Nähe zurückgehalten. Erst nachdem dem Könige das Abendmahl gereicht worden und alle Anwesenden sich in die Nebengemächer zurückgezogen, verließ sie die Räume, wo sie von keinem vermißt ward.
Wir wollen den Töchtern der Gräfin Munk damit keinen Vorwurf machen. Als Dienerin ihrer Mutter hatten sie Wiebeke Kruse kennen gelernt und lieb gewonnen. Als sie aber erlebten,daß sie an die Stelle der Mutter trat, die von dem Könige verstoßen und in der Blüthe ihrer Jahre nach Jütland verwiesen war, da wandten sie ihre Herzen von ihr ab. Und wenn sie auch später auf den Wunsch des Königs mit ihr verkehrten und ihre Verdienste anerkannten, so gehorchten sie nach ihrer Vermählung doch gern ihren Ehemännern, als dieselben ihnen den Umgang mit Wiebeke als unpassend verboten. Als Wiebeke aber am folgenden Morgen in das Krankenzimmer trat, ein Bild des Schmerzes und der Ergebung in den Willen des Höchsten, da regte sich das Mitgefühl, welches die Frauen, selbst wenn sie sich nicht lieben, so leicht zu einander führt, in Eleonore’s und Hedwig’s Herzen und trieb sie, ihr freundlich entgegenzutreten und tröstenden Zuspruch an sie zu richten. Wiebeke, deren Gedanken einzig und allein bei dem Sterbenden weilten, antwortete zerstreut; aber diese Zerstreutheit erschien als Kälte oder Hochmuth, die Damen wandten sich verletzt ab – es war das letzte Zeichen von Wohlwollen, welches sie Wiebeke Kruse erzeigt hatten.
Von Stunde zu Stunde erwartete man den letzten Seufzer des Königs. Er sprach wenig mehr, doch verlangte er um Mittag noch einmal aus dem Bette. Von den Aerzten und dem Kammerdiener unterstützt, hielt er sich aufrecht und saß eine halbe Stunde in seinem Armstuhle. „Jetzt gilt’s!“ hörte man ihn sagen. Bald danach ward er ohnmächtig und mußte in’s Bett getragen werden. Erst um 5 Uhr schloß er die Augen, ein tiefer Athemzug und Christian IV – war todt.
———————
Tiefe Stille herrschte um den entschlafenen König. Wiebeke saß noch im Gebet versunken in einem Winkel des Zimmers, als der Cabinetssecretair Otto Krag zu ihr trat und leise sprach:
„Der Reichskanzler läßt Euch bitten, Euch in Eure Gemächer zurückzuziehen.“
Wiebeke, die aller Anwesenden vergessen hatte, sah ihn staunend an.
Nach einer Pause, gleichsam als scheue er sich, den grausamen Befehl auszusprechen, fuhr er fort:
„Der Herr Reichskanzler ersucht Euch, kraft eines früheren Befehles des Königs Friedrich III., das Schloß Rosenburg in der Frühe zu verlassen und Euch deshalb nach einer anderen Wohnung umzusehen.“
Wiebeke erhob sich mechanisch, ein eisiger Schauer durchrieselte sie, dann schritt sie mit erhobenem Kopfe langsam aus dem Zimmer, durch die Corridore, bis in ihr eigenes Gemach, wo sie erschöpft in einen Stuhl sank.
Dort saß sie, unzugänglich für allen Zuspruch, ohne Verständniß für alle Fragen, bis man sie am folgenden Tage nach einer in aller Eile gemietheten Wohnung führte.
Man hatte nicht gewartet, bis sie ein Zeichen gebe, daß sie verstehe, was man von ihr forderte, sondern ihren Frauen befohlen, den Umzug binnen gesetzter Frist zu bewerkstelligen, Auch ihren Haushalt hob man auf, entfernte ihre Dienerschaft bis auf eine Kammerjungfer, welche ihr lange Zeit gedient hatte und jetzt erklärte, sich nicht von ihrer Gebieterin trennen zu wollen.
So sah Wiebeke sich verlassen von der Welt, die sich noch gestern vor ihr geneigt hatte, fern von allen Freunden, die ein unglücklicher Zufall alle abwesend sein ließ. Ihr Sohn hatte Neujahr seine erste Reise in’s Ausland angetreten; ihre Tochter wohnte mit den Pflegeeltern auf dem Lande; Günther, der frühere Geheimsecretair, war auf Reisen, und Wenzel Rothkirch wohnte seit Jahren in Korsör.
Nur der Kammerdiener Christian’s IV., welcher der treuen Lebensgefährtin stets die tiefste Verehrung gezollt hatte, suchte sie oftmals in ihrer kleinen Wohnung auf, und immer fand er sie in derselben Weise: in tiefem Trauerkleide, die Hände gefaltet, den Kopf tief auf die Brust gesenkt. Selten kam ein Wort über ihre Lippen, nur ihre immer noch schönen glanzvollen Augen blickten dankbar auf die beiden treuen Wesen, die sie in ihrem Unglücke nicht verlassen hatten.
Nur einmal sah man sie aus dieser Apathie heraustreten, nämlich als Wenzel Rothkirch, welcher zum Leichenbegängniß seines Königs nach Kopenhagen gekommen war, Wiebeke’s Aufenthaltsort erfragt hatte und eines Tages mit seiner Gemahlin bei ihr eintrat. Da strich sie die ergrauten Locken aus der Stirn, da röthete sich die bleiche, eingefallene Wange, da streckte sie beiden mit feuchtem Auge die Hände entgegen.
„Kommt mit uns!“ bat Rothkirch’s Gattin, nachdem sie ein Stündchen miteinander geredet hatten. „Ihr werdet bei uns, durch unsere Pflege gesunden und sollt so viel Ruhe haben, wie Ihr wollt.“
„Ihr liebt ja das Landleben. Die freie schöne Luft wird Euch stärken,“ fügte Wenzel hinzu.
Wiebeke schüttelte langsam den Kopf. „Wenn ich gesunden könnte, so würden diese Worte meiner Freunde ein unfehlbares Heilmittel sein“, sprach sie leise. „Laßt mich hier bleiben, meine Tage sind gezählt. Mit dem Tode des Königs lösten sich die Bande, die mich an’s Leben fesseln; durch den Befehl seines Sohnes, der mir durch Otto Krag überbracht wurde, ward mir eine Wunde geschlagen, die nimmer wieder heilt. – Man wartet auch schon auf meinen Tod. Wöchentlich schickt man wenigstens einmal und erkundigt sich, ab ich noch lebe, was meine treue Jungfer auf den gottlosen Gedanken geleitet hat, man habe mir Gift beigebracht. Aber weshalb sollte Friedrich III. ein so sündhaftes Mittel wählen, sich meiner zu entledigen, da er, um dies zu erreichen, mich ja nur nach Bramstedt zu verweisen brauchte.“
Alle Versuche des liebenswürdigen Ehepaares, Wiebeke zu überreden, sie nach Korsör zu begleiten, blieben fruchtlos, und nach diesem Besuche sank die allzu hart betroffene Frau in ihren vorigen Zustand zurück.
XVI.
Von allen Monaten war der Mai Wiebeke stets der liebste gewesen, weshalb der König ihr von dem ersten bis zu dem letzten Tage dieses Monats täglich frische Blumen gebracht oder, wenn er abwesend war, geschickt hatte. Dessen war sein treuer Kammerdiener eingedenk, als er in Galalivree, mit einem herrlichen Blumenstrauße in der Hand, am ersten Mai früh Morgens an Wiebeke’s Thür pochte.
„Wie steht es drinnen?“ fragte er die Jungfer, als diese ihn einließ.
„Ungewöhnlich gut, heute. Die gnädige Frau ist gesprächig, sie hat etwas Suppe genossen, ihren Stuhl in die Sonne rücken lassen und wünschte nun allein zubleiben.“
„Geh‘ und bitte die gnädige Frau, mir einen Augenblick Gehör zu schenken.“
Die Jungfer ging hinein und meldete, wie gewöhnlich, „den Kammerdiener Sr. Majestät.“ Wiebeke schien sie nicht zu bemerken, ihr Kopf war noch tiefer auf die Brust gesunken, als sonst. „Sie betet,“ flüsterte die treue Magd, als sie behutsam auf den Fußspitzen wieder hinausschlich.
In dem Kammerdiener, der in der halb offenen Thür stehen geblieben war, dämmerte ein anderer Gedanke. Er winkte der Jungfer, ihm zu folgen. Leise näherte er sich der leidenden Frau, schob die duftenden Blumen in ihre gefalteten Hände, – sie waren starr, vom Tode berührt, das Auge gebrochen.
„Ich wußte wohl, daß sie dem hochseligen Herrn bald folgen würde. Sie liebten sich zu innig, um lange getrennt leben zu können,“ sagte der treue Diener, die hervorquellenden Thränen mit der Hand fortwischend und die Todte in stiller Ehrfurcht betrachtend.
Das war die einzige Leichenrede, die der braven, pflichtergebenen Frau gehalten wurde. —–
Als man dem Könige Anzeige von dem erfolgten Ableben der Wiebeke Kruse machte, befahl er dem Kanzler für ihr Begräbniß Sorge zu tragen. Dieser trug es seinem Kammerdiener auf, und so geschah es, daß Wiebeke’s irdische Ueberreste in einen Sarg einfachster Art gelegt, auf einen Arbeitswagen gesetzt und am 6. Mai 1648, Abends, nach dem vor dem Norderthore gelegenen Kirchhofe gefahren und dort beerdigt wurden; an einem Orte, wo keiner seine Angehörigen gebettet wissen möchte.
So belohnte König Friedrich III. eine Frau, welche mit seinem Vater achtzehn Jahre lang, bis an das Ende seiner Tage, Wohl und Weh getheilt hatte und von ihm hochgeschätzt und innig geliebt worden war.
Auf Wiebeke Kruse’s Kinder machte das Ende der Mutter einen schmerzvollen Eindruck. An Ulrich Christian ging die Prophezeiung des Königs in Erfüllung. Nachdem er sieben Jahre in spanischen Diensten gestanden und sich in mancher Schlacht ruhmvoll ausgezeichnet hatte, kehrte er nach Dänemark zurück, ward als Generalmajor nach Schonen gesandt und fand dort, wir auch bald darauf bei der Belagerung von Kopenhagen Gelegenheit sich durch persönliche Tapferkeit und Tüchtigkeit in seinem Berufe auszuzeichnen. Im Jahre 1658 endete er seine kurze, aber glorreiche Laufbahn, tief betrauert von allen, die ihm nahe gestanden hatten.
Sophia Elisabeth vermählte sich mit Claus v. Ahlefeldt, welchen König Christian ihr zum Gemahl bestimmt hatte. Ihr einziges Kind, eine Tochter, vermählt mit dem Baron v. Kielmannsegge, war es, die den Bramstedtern, welche ihre Großmutter so sehr geliebt hatte, schweres Leid zufügte – eine lange, traurige Geschichte, die wir hier nicht näher berühren wollen.
Nach Bramstedt war Wiebeke Kruse nach ihrem ersten Besuche, fast jedes Jahr wieder gekommen, mehrmals in Begleitung des Königs, und der Tag ihrer Ankunft ward stets als Festtag in dem Almanach ihrer Gutsunterthanen bezeichnet, indem sie niemals abreiste, ohne während ihrer Anwesenheit Freude und Frohsinn um sich verbreitet zu haben. Hier schenkte sie das Korn zur Wintersaat, dort eine Kuh; diesem erließ sie die jährlichen Abgaben, jenem schenkte sie das Grundstück zu einem Häuschen: kurz, ihr Andenken war gesegnet, ihre Anwesenheit ein Freudenfest für den Ort. Ganz besonders treu hingen ihr die Schulknaben und Kuhhirten an, die immer reichlich von ihr beschenkt wurden, und selbst wenn sie nicht anwesend war, Morgens und Abends beim Aus- und Eintreiben der Kühe unter ihren Fenstern stehen blieben und so herzhaft mit den langen Peitschen knallten, daß es weithin über den Blek schallte: eine Sitte, die obwohl das Schloß längst verfallen ist, mit ächt nationaler Beharrlichkeit im Festhalten am Altherkömmlichen, trotz aller Klagen der Einwohner, trotz oftmaliger Drohung der Behörde, die Eltern in Geldstrafe zu nehmen oder die Buben ob des Unfuges zu züchtigen – sich bis auf den heutigen Tag erhalten hat.
Eine Ungerechtigkeit gegen die brave Bauerntochter, die wir beklagen möchten, ist, daß die Härte und Grausamkeit zweier nachfolgenden Gutsherrinnen jetzt auf Wiebeke Kruse übertragen sind, weil sie die einzige ist, deren Namen sich im Gedächtniß der Einwohner erhalten hat. So werden manche Züge von despotischer, herzloser Behandlung des Gesindes, die auf Sophia Amalia v. Kielmannsegge und die Freiherrin v. Grote zurückzuführen sind, der warmherzigen Wiebeke angedichtet. Ja, wie sehr der Name einer historisch bekannten Persönlichkeit den in der Luft schwebenden Mythen und Sagen zum Anhaltspuncte dient, sehen wir daraus, daß „die Frau im Wolkenkleide“, welche früher im Anklever saß und ihre Sonnenfäden spann, den Bramstedtern jetzt als „de ole Wiebeke“ bekannt ist, d. h. den wenigen alten Leuten, die sich noch erinnern, wenn sie als Kind die Kühe hüteten, die alte Wiebeke auf dem Baume sitzen gesehen oder sich doch entsetzlich vor ihrem Erscheinen gefürchtet zu haben. In der jetzigen Generation sterben, wie in anderen Orten, die schönen alten Ueberlieferungen, welche sich länger denn ein Jahrtausend von Eltern auf Kinder vererbten, nach und nach aus.
Man zeigte vor Jahren (als das Gut Bramstedt sich in dem Besitze des gelehrten Professors Meyer, des Biographen Schröder’s befand) im gutsherrschaftlichen Garten einen mit Stachelbeerbüschen umpflanzten Rasen, von welchem es hieß, er sei kellerhohl, und in dem finsteren Raume habe Wiebeke (es soll die Baronin v. Grote gewesen sein) ihre widerspenstigen Mägde und aufsätzigen Leibeigenen eingesperrt. Eine schöne alte Linde an der Au wurde als Wiebeke’s Lieblingsplatz bezeichnet, mit dem Zusatze, daß auch Christian IV. häufig unter derselben gesessen habe. In dem jetzigen Wohnhause, welches früher als Thorgebäude und Magazin benutzt wurde und nur auf der einen Seite zur Aufnahme des königlichen Gefolges wohnlich eingerichtet war, sieht man noch jetzt eine Nische mit der goldenen Namenschiffre Christians IV. geschmückt.
——————
Dies ist alles, was in Bramstedt noch erinnert oder richtiger vor etlichen Jahren noch erinnerte an eine Zeit, über die erst zweihundert Jahre hingeflossen sind, und selbst diese spärlichen Andeutungen sind im Gedächtniß der Einwohner mit anderen Sagen vermischt, die offenbar einer viel früheren Zeit entstammen. Im Interesse der tiefer dringenden Specialgeschichte unseres Landes müssen wir beklagen, daß die geistlichen und weltlichen Behörden, als Vertreter wissenschaftlicher Bildung solcher Ortschaften, welche nachweislich in vergangenen Zeiten weit bekannt und berühmt oder doch von historischer Bedeutung waren, selten darauf bedacht sind, die noch vorhandenen, auf die einstmalige Blüthe hinweisenden Denkmäler zu schützen und zu erhalten, sondern leider oft um eines nichtigen Vortheiles der jetzt lebenden Generation oder gar des einzelnen Menschen willen die Spuren tilgen, die von dem Leben und Wirken vergangener Geschlechter reden, und die nicht selten für den Kunsthistoriker, für den Geschichts- und Alterthumsforscher unschätzbare Kleinode sind.
Wann wird das anders werden!