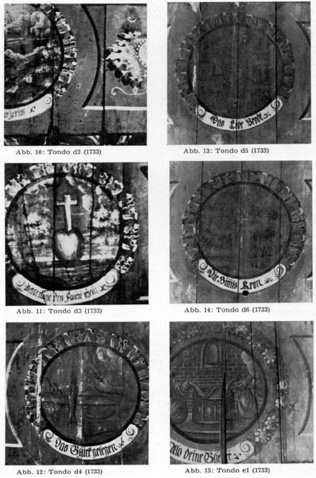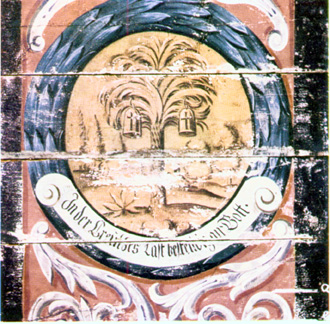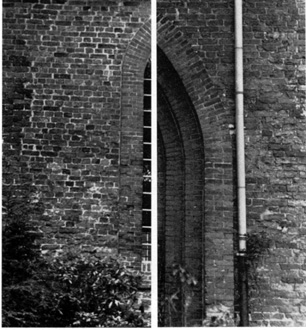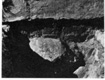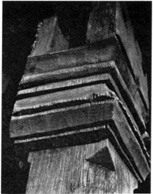Text aus dem Buch:
Alt-Bramstedt im Bild
von Jan-Uwe Schadendorf
Bad Bramstedt 1977.
( einige nachträgliche Korrekturen in hellblauer Schrift ergänzt )
- Bramstedt Leed, von August Kühl
- Rundgang durch Bramstedt 1912, von August Kühl
- Bramstedt im Zeichen des Roland
- Warum die Bramstedter ihren schönen alten Roland nicht länger haben wollten, von W.H. Riecken
- Vom Bramstedter Schloß
- Wiebeke Kruse
- Der Flecken kämpft um seine Freiheit
- Von Kriegen und anderen Schrecken
- Von den Bramstedter Toren und Brücken
- Vom Ortsnamen und den ersten Bewohnern
- Die Quelle unter dem Eichbaum
- Paul Behlau erinnert sich
- Einige Bramstedter Originale
- Bramstedts alte Straßen- und Flurnamen
- Bramstedts Aufbruch ins 20. Jahrhundert
Bramstedt Leed
As de Eeken op den Liethbarg,
As de Eschen in den Grund,
Wöllt wi fast stahn, nich torügg gahn,
Tru un fast mit Hart un Mund.
So lang de Wind weiht un de Hahn kreiht,
Tru un fast mit Hart und Mund.
As de Wotteln in dat Erdriek,
As de Twiegen in de Kron,
Sick de Hand gewt un tosam lewt,
Wöllt ock wi tosamenstahn.
So lang de Wind weiht un de Hahn kreiht,
Wöllt wi fast tosamenstahn.
As de Vageln in de Twiegen,
As de Hirch, as Reh un Voß,
Wöllt wi frie sin, nüms to eegen sin,
Frie dat Hart un frie de Bost.
So lang de Wind weiht un de Hahn kreiht,
Frie dat Hart un frie de Bost.
Uns leew Bramstedt mit dien Roland,
Mit dien Wischen wiet un grön,
Mit dien Linden, smuck un köhlig,
Du schast wassen, du schast blöhn!
So lang de Wind weiht un de Hahn kreiht,
Schast du wassen, schast du blöhn.
Rundgang durch Bad Bramstedt
von August Kühl 1913Wenn liebe Freunde und gute Bekannte uns in unserem Heim aufsuchen, so zeigen wir ihnen gern, wie wir eingerichtet sind. Und seiunser Haus auch noch so klein und unscheinbar, dennoch führen wir sie mit Stolz durch jeden Raum, verweilen mit Liebe bei jeglichem Stück der Einrichtung. – Nicht anders ist’s, wenn wir in unserm stillen Städtchen Besuch empfangen aus der Großstadt. Da drängt es uns auch, ihn hindurchzuführen durch seine Straßen, Gassen und Gäßchen, ihn hinzuweisen auf seine bescheidenen Reize, ihm zu erzählen von seiner Vergangenheit. Halte es mir darum zugute, lieber Leser, wenn ich Dich hiermit bitte, einen Rundgang mit mir zu machen durch mein liebes Bad Bramstedt. Wenn es auch nicht gar viel ist, was ich Dir zeigen kann, so hoffe ich doch, daß es Dich nicht gereuen wird, Dich auf ein Stündchen meiner Führung anvertraut zu haben.
Bramstedt ist ein uralter Ort. Das beweisen die zahlreichen Funde aus der Stein- und Bronze-Zeit, die man hier zu verschiedenen Malen gemacht hat. Auch die Hünengräber auf den Höhen nördlich und südlich des Bramautales sind dafür stumme Zeugen aus grauer Vorzeit. Schon vor zwei Jahrtausenden muß hier eine nicht unbedeutende Siedlung bestanden haben, denn ein aus jener Zeit stammender ausgedehnter Urnenfriedhof ist vor kurzem auf den Grundstücken, die sich von der Straße „Hinter den Höfen“ (heute Rosenstraße, d. Verf.) bis zur Lieth ausdehnen, aufgedeckt worden. Sicher wurden schon in vorgeschichtlicher Zeit Ansiedler herbeigelockt durch das wiesenreiche, im Norden durch bewaldete Höhen geschützte Tal der Bramau. Außerdem bildeten Osterau und Hudau auf drei Seiten eine natürliche Schutzwehr gegen feindliche Angriffe, und endlich stellte die Bramau eine bequeme Verbindung mit Stör und Elbe und weiterhin mit der Nordsee her, wie auch die alte Heerstraße, die die Mitte unseres meerumschlungenen Landes von Norden nach Süden durchzog, die „via regia“, wie sie im Mittelalter hieß, über Bramstedt führte, weil hier, unmittelbar vor dem Zusammenfluß der drei Auen, die Furten leichter passierbar waren, die Brücken einen bedeutend geringeren Aufwand an Material und Arbeit erforderten.
Freilich dürfen wir uns das alte Bramstedt nicht so ausgedehnt wie jetzt vorstellen, wo es wie eine langbeinige Spinne seine Arme ausstreckt nach Norden und Süden, nach Osten und Westen. Was damals hier wohnte, drängte sich zusammen in den sicheren Winkel zwischen Hudau und Osterau. Der Bleeck und die beiden Hinterstraßen, das war das Bramstedt der alten Zeit und des Mittelalters, und erst. als die Zeiten friedlicher wurden. wuchs der Ort über diese Grenzen hinaus. – Von allen Seiten war Alt-Bramstedt gegen plötzliche Überfälle geschützt. Im Norden und im Osten floß die Osterau, im Westen und Süden die Hudau, und im Südosten wurden beide dem sogenannten „Kaffeegraben“ (der Bach, der die Straße Butendoor auf Höhe der Häuser Nr. 2 und 4 unterfließt) noch teilweise durch das Becker Tor und über die Becker-Brücke, aus der das jetzige Geschlecht eine Bäckerbrücke gemacht hat. Der westliche Zugang führte durch das Hude-Tor und über die Hudau-Brücke, und im Südosten vermittelte den Zugang der Weg durch das „Hoge-Door“ und über die Hogendoors-Brücke. Die jetzige Friedrichsbrücke im Zuge der Altona-Kieler Chaussee bestand damals noch nicht; wo jetzt der Chausseedamm aufgeschüttet ist, war bis vor 75 Jahren ein tiefes Wiesental.
Von Alt-Bramstedt aus, also vom Bleeck, wollen wir unsere Wanderung beginnen. Wer als Fremder zum ersten Male den Bleeck betritt und, etwa vor dem „Holsteinischen Hause“ sitzend, das Bild des von Linden umsäumten Platzes auf sich wirken läßt, der wird zugeben müssen, daß er bei aller seiner Schmucklosigkeit eine Zierde für den Ort ist. Wenig Ortschaften gibt es, die einen so geräumigen Marktplatz ihr Eigen nennen dürfen. In unserer Heimatprovinz wird Bad Bramstedt darin nur von der Stadt Heide übertroffen. Wie kommt der kleine Ort Bramstedt zu einem solchen Platz? Wahrscheinlich war der Bleeck in heidnischer Zeit ein Ort der Gottesverehrung und zugleich eine Thingstätte. Vielleicht stand dort, wo jetzt der Roland mit schwertbewehrtem Arm Wache hält, vor zweitausend Jahren ein Abbild des germanischen Gewittergottes Donar, der in seiner Rechten den alles zermalmenden, immer wieder zu seinem Herrn zurückkehrenden Hammer trug (hier war wohl die Phantasie Vater der Gedanken). Mit der Einführung des Christentums – vor etwa tausend Jahren – hörte die Verehrung der Heidengötter auf, aber die Gaugerichte blieben, und als Thingplatz, auf dem an bestimmten Tagen sämtliche Gaugenossen sich versammelten, um Recht zu sprechen nach altem, von den Vorvätern überlieferten Brauche, behielt der Bleeck noch Jahrhunderte hindurch seine Bedeutung. Und sollte ein wichtiges Geschäft abgeschlossen werden, so begaben sich die beiden Kontrahenten samt den Zeugen nach dem Bleeck. Dort stellten sie sich unter den Roland, den christlichen Nachfolger des heidnischen Donar, um den Vertrag zu schließen. Was dort mit Wort und Handschlag beschlossen wurde, das stand für alle Zeiten auch ohne Brief und Siegel. Die Stätte unter dem Roland war unsern Altvordern ein geweihter Ort; was Wunder, daß in Bad Bramstedt kaum ein Fest gefeiert wird, bei dem die Feiernden nicht auch in fröhlichem Zug um den Roland wandern.
Saftiger Rasen breitet sich zu Füßen des Roland aus. Hinter den grünen Lindenkronen winken die blanken Fenster zahlreicher Wirtshäuser. Dem Roland am nächsten, verdeckt durch eine doppelte Lindenreihe, liegt das alte Schloß. Es ist zwar nur ein einfacher, zweistöckiger Bau, ohne Türme und Zinnen, ohne Schießscharten und Mauerkronen, aber dennoch dürfen wir nicht achtlos daran vorbeigehen, denn an das Schloß knüpfen sich zahlreiche geschichtliche Erinnerungen. Zur Zeit, als die Schauenburger Grafen über Holstein regierten, war es eine Zeitlang Fürstensitz (es handelt sich um eine historisch zweifelhafte Aussage). Später kam es in den Besitz des edlen Geschlechts der Stedings,und als Stedinghof findet man es daher mit dem zugehörigen Gute im Mittelalter vielfach bezeichnet. Häufig kehrten die dänischen Könige, wenn sie sich in Holstein aufhielten, unter dem gastlichen Dache des Stedinghofes ein. Auch König Christian IV. folgte diesem von seinen Vorgängern geübten Brauch, und gelegentlich eines solchen Aufenthalts in Bramstedt war es, als er Wiebeke Kruse, die Bauerntochter aus Föhrden, kennenlernte, deren wechselvolle Schicksale uns Fräulein Johanna Mestorf, eine geborene Bramstedterin, in einem bei Otto Meißner in Hamburg erschienenen Büchlein trefflich geschildert hat. Bei einer sich bald darauf bietenden Gelegenheit kaufte der König Schloß und Gut, um beides seiner Wiebeke zu schenken. Noch jetzt zeigt man im Schlosse das „Königszimmer“ mit dem Namenszug Christian IV. über dem Kamin und den Bildnissen des Königs und der Wiebeke Kruse, noch jetzt grünt im Garten hinter dem Schlosse alljährlich eine mächtige Linde, unter der der gekrönte Herr oft im traulichen Gespräch mit der einfachen Bauerntochter gesessen haben soll. – Ein anderes Zimmer, das „Kurfürstenzimmer“, erinnert uns an Friedrich Wilhelm von Brandenburg, den großen Kurfürsten, der im schwedisch-polnischen Kriege mit seinem Kriegsvolk durch Bramstedt zog und auf dem Schlosse übernachtete. – Für den Literaturfreund gewinnt das Schloß dadurch Interesse, daß hier vor 150 Jahren Graf Stolberg, der Vater der beiden als Dichter benannten Brüder Stolberg, wohnte. Von seinen beiden Söhnen ist der jüngere, Friedrich Leopold, der später zum Katholizismus übertrat, am 7. November 1750 hier geboren. – Das damals recht umfangreiche adlige Gut wurde im vorigen Jahrhundert immer mehr verkleinert, und jetzt gehört zum Schloß nur noch der allerdings recht ausgedehnte, parkartige Garten. In demselben findet sich noch ein Rest des alten Burggrabens, der freilich jetzt nur durchaus friedlichen Zwecken dient – er ist nämlich in einen Fischteich verwandelt. (Der Fischteich ist heute nicht mehr vorhanden, er lag jedoch zwischen Hudau und der Straße Sommerland.)
Vom Bleeck wenden wir uns nordwestwärts, der Hudaubrücke zu. Auf der Brücke machen wir einen Augenblick halt und werfen einen Blick nach links hinüber in den Schloßgarten. Es ist ein hübscher Durchblick, der sich unserem Auge bietet: In nächster Nähe die von Baumkronen und mancherlei Gesträuch eingerahmte Hudau, darüberhinaus das grüne Wiesental, und hinter diesem der Chausseedamm mit seinen weißen Geländersteinen und dem grauen Granit der Friedrichsbrücke. Einige hundert Schritt jenseits der Hudaubrücke biegen wir in den mit jungen Linden bepflanzten Wiesensteig, eine Schöpfung der Sparkasse, ein. In zehn Minuten führt er uns über die Bramau und durch die Bramauwiesen nach den Anlagen (heute Herrenholz genannt), die ebenfalls der Sparkasse gehören, von ihr unterhalten und gepflegt werden.
Bänke laden uns zum Ausruhen ein. Unmittelbar an die Anlagen grenzt der geräumige, modern eingerichtete Schießstand desKriegervereins. Nicht bloß Vereinsmitglieder üben dort die edle Sohießkunst, es wird vielmehr gern gesehen, wenn er auch von Fremden besucht wird. Zur Verfügung stehen zwei Stände zu 300 m und sechs Stände zu 175 m sowie ein Jagdstand.
Die am östlichen Ende der Anlagen befindliche Pforte bringt uns nach dem Klingberg (damals hinterer Teil des Maienbeecks). Da, wo diese Straße in den Maienbeeck übergeht, biegen wir links ab und gehen den Lehmberg (Lehmberg = Maienbaß) hinauf, damit wir den Fußsteig gewinnen, der unter der Lieth entlangläuft. Bei dem kleinen Landhaus, das am Abhang der Lieth, hinter Obstbäumen versteckt und von alten Eichen überschattet liegt, besteigen wir die Höhe und gelangen so nach einem vor kurzem angelegten Ruheplatz, von wo man einen guten Überblick über den ganzen Ort hat. Es ist ein hübsches Bild, das sich vor uns ausbreitet. Rote Ziegeldächer wechseln mit dunklen Papp- und Schieferdächern, und überall ragen dazwischen die breiten Kronen der Linden hervor, an denen Bramstedt so reich ist.
Dann steigen wir wieder hinunter und setzen unsere Wanderung ostwärts fort. Der Steig bringt uns zur Neumünsterschen Chaussee (Neumünstersche Chaussee = Kieler Straße); wir kreuzen sie, und bald stehen wir am Bahnhof. Der Bahnhofsstraße folgend, lassen wir das Bahnhofshotel rechts liegen, werfen einen Blick auf die Turnhalle, das Heim der Bramstedter Turnerschaft, und erfreuen uns an dem stattlichen Bau der höheren Privatschule (höhere Privatschule heute Grundschule am Bahnhof), die in ihren sechs Klassen hiesige und auswärtige Schüler und Schülerinnen für die Sekunda einer Realschule vorbereitet, um schließlich in den „Badesteig“ einzubiegen, der uns in kurzer Zeit nach den beiden Solbädern bringt. Im „Matthiasbad“, der ältesten der beiden Anstalten, kehren wir zunächst ein. Seinen Namen hat es nach seinem Begründer Matthias Heesch. In den 30 Jahren seines Bestehens hat es schon manchem Kranken Heilung seiner Leiden, Linderung seiner Schmerzen gebracht. Die Heilquelle, die hier zutage tritt, enthält neben salzigen auch moorige Bestandteile und zeichnet sich vor den meisten Solquellen außerdem vorteilhaft durch ihren Jodgehalt aus. Dadurch sowie durch die im Wasser reichlich vorhandene gebundene Kohlensäure wird die Heilkraft wesentlich erhöht. Nur in seltenen, sehr verschleppten und hartnäckigen Fällen bedürfen die hier verabreichten Sol-Moorbäder der Verstärkung durch Salz und Mutterlauge. Die Bäder haben sich gegen allgemeine Ernährungsstörungen, wie skrofulöse Leiden jeglicher Art, englische Krankheit, harnsaure Gicht, Blutarmut und Bleichsucht von Anfang an sehr gut bewährt. Vorzüglich wirksam sind sie, um die Ablagerungen infolge von Gicht und Gelenkrheumatismus, sowie um die Ausschwitzung nach abgeheilten Entzündungen des Rippenfells, des Bauchfells, des Beckens, der Lymphgefäße, Venen und Nerven und des Zellgewebes zum Aufsaugen und Verschwinden zu bringen. – Wir durchwandern den schattigen Garten, verweilen einige Augenblicke an den Ufern des lieblichenSchwanensees (Teich nördlich des Osteraubogens), der gleicherweise zu einer Bootsfahrt wie zu einer Angelpartie einlädt, und folgen dann dem am Wiesenrande sich hinziehenden Fußpfad, der uns nach einem der Sparkasse gehörenden, ebenfalls malerisch am Wiesental gelegenen Wäldchen bringt. Auf dem Rückwege machen wir einen Gang durch das Badehaus, werfen einen Blick in den Pavillon und lassen uns endlich in der geräumigen Veranda des Kurhauses von Fräulein Auguste, der ältesten Tochter des verstorbenen Gründers, die, unterstützt von ihren Schwestern, mit Umsicht und Geschick den ganzen Betrieb leitet, einen kühlen Trunk kredenzen. Wir lassen uns von ihr erzählen, wie ihr Vater zufälligerweise die Solquelle entdeckte und wie klein und bescheiden der Anfang des Bades war. Ein einfaches hölzernes Häuschen diente als Badekabine, und das Büfett wurde dargestellt durch ein Bord von rohem Holz, auf dem eine einzige Flasche und ein paar Gläser standen. Wer nach dem Bade der Stärkung und der innerlichen Erwärmung bedurfte, dem schenkte der biedere Matthias Heesch, die kurze Pfeife im Munde, „en Lütten“ ein, und nach erfolgter Herzstärkung setzte man seine Füße fürbaß. – Im Laufe des Gesprächs kommen wir dann noch auf den alten Gesundbrunnen, der etwa eine halbe Wegstunde ostwärts vom Matthiasbade lag, und durch den Bramstedt vor 200 Jahren auf kurze Zeit ein berühmter Ort und das Ziel vieler Kranken wurde. Tausende von Menschen waren gleichzeitig am Brunnen versammelt, um durch die Kraft des Wassers zu genesen, aber allmählich hörte der Zustrom auf, und der Gesundbrunnen geriet in Vergessenheit. Auf der „Brunnenwiese“, wo damals die wunderbare Quelle sprudelte, hat der jetzige Besitzer kürzlich nach dem segenspendenden Wasser bohren lassen, eine Wasserader ist gefunden worden, und man behauptet, daß das durch eine Pumpe zugänglich gemachte Wasser bei regelmäßigem Gebrauch eine sehr wohltuende Wirkung auf den menschlichen Körper ausübe. – Noch weiter ostwärts, am Eingang des Dorfes Bimöhlen, hat der Hofbesitzer Moritz in einer von Wald und Heide umschlossenen Wiese eine Quelle erbohrt, die den Namen „St. Johannis-Sprudel“ hat und deren Wasser von vielen Seiten als heilkräftig gerühmt wird. Die Nachfrage nach diesem Wasser ist so groß, daß ein regelmäßiger Versand nach Hamburg eingerichtet werden mußte.
In unmittelbarer Nähe des Matthiasbades wurde im Jahre 1911 eine zweite Solquelle erbohrt, und so entstand das Behnckesche Sol-Moorbad. Schmuck präsentieren sich die im niederländischen Stil errichteten, durch eine nach allen Seiten geschlossene Veranda verbundenen Gebäude, vor denen ein wohlgepflegter Garten sich ausdehnt, dem vom Ort herkommenden Besucher. Drinnen ist alles aufs beste eingerichtet, sowohl in den Logierzimmern als auch in den Badekabinen, und dabei können wir der aufmerksamsten Bedienung versichert sein. Da auch die erzielten Heilerfolge denen des älteren Matthiasbades nicht nachstehen, so ist es leicht erklärlich, daß Herr Behncke im Sommer sich stets eines vollen Hauses erfreut.
Wir fügen noch das Ergebnis einer von Herrn Dr. Ad. Langfurth in Altona, dem von der Handelskammer Altona öffentlich angestellten Handelschemiker, vorgenommenen Analyse der Behnckeschen Solquelle bei, wonach in dieser Quelle unter 100.000 Teilen enthalten sind:
Abdampfrückstände 1974,00; Glühverlust 15.00; Mineralstoffe 1959,00; darin Kieselsäure 1,00; Eisenoxyd 1,20; Schwefelsaurer Kalk Spuren; Kohlensaurer Kalk 24,82; Kohlensaure Magnesia 9,93; Chloride (Kochsalz) 1888,00; Gelöste organische Stoffe Permanganat 32,42; Ammoniak Spuren.
Von dem Behnckeschen Sol-Moorbad bringt uns ein Steg über die Osterau nach dem Lohstückerweg. Da, wo die Bahn den Weg kreuzt, zeigt ein Wegweiser uns die Richtung nach dem städtischen Gehölz bei der Hambrücke (Brücke über die Schmalfelder Au vor der Rheumaklinik). Am Bahndamm entlang schreitend, sind wir bald dort. Ursprünglich war es eine mit Moos, harten Gräsern und Heidekraut bestandene Dünenlandschaft, die auf Veranlassung des früheren Bürgermeisters G. Freudenthal aufgeforstet wurde. Der nahrungsarme Boden verbot die Anpflanzung anspruchsvoller Baumarten, sogar die Fichte wollte nicht gedeihen. Kiefer und Birke herrschen hier; zwischen den Bäumen wuchert noch das Heidekraut. Aber lohnend ist dennoch ein Gang durch die langgestreckten Anpflanzungen; besonders schön ist der Pfad, der am Ostrande mit dem Ausblick auf die Wiesen dahinführt. – Am Südrande der städtischen Hölzungen wird sich demnächst ein Jugendheim der Wandsbeker Stadtmission, das bestimmt ist, erholungsbedürftigen Stadtkindern einen billigen Landaufenthalt zu bieten und ihnen verlorengegangene Jugendfrische wiederherzustellen, erheben. In der sich anschließenden Heidelandschaft winkt uns der „Wodansberg“, ein gewaltiges Hünengrab, der das Endziel unserer Wanderung nach dieser Seite sein möge.
Auf dem Rückweg biegen wir bei der Hambrücke nach Westen ab, durchqueren auf schmalem Wiesenpfad das Tal der sich hier vereinigenden Schmalfelder- und Lentföhrdenerau und gelangen so an der „Blockshöhe“ vorbei nach dem Tannhof, wo wir die Altonaer Chaussee erreichen. Die „Friedrichsbrücke“. so benannt nach dem König Friedrich VI. von Dänemark, zu dessen Zeit sie als das Schlußstück der Altona-Kieler Chaussee. der ersten derartigen Kunststraße nördlich der Elbe, erbaut wurde, bringt uns zurück zum Bleeck. Wir grüßen im Vorbeigehen die stattliche Friedenseiche (sie steht auf dem Rasenstück vor dem „Hotel zur Post“) verweilen einen Augenblick bei dem Kriegerdenkmal, das uns in die ruhmreichen Tage von 1870/71 zurückversetzt, und erinnern uns beim Anblick der Doppeleiche (sie steht auf dem Rasen vor dem Schloß) und des mit einer Kanonenkugel gezierten Gedenksteins in der Nordwestecke des Bleeck des Kampfes, den unsere Väter von 1848/50 für die Freiheit und das Recht gegen die dänische Gewaltherrschaft führenn. Wir dürfen aber den Platz nicht verlassen, ohne den historischen Stein in der Außenmauer des Schlüterschen Gasthofes (später Rolandseck) in Augenschein genommen zu haben. Es ist zwar nur ein schlichter Granitfindling mit notdürftig geglätteter Oberfläche, auf der die Zeichen J.F.D. 1674 eingemeißelt sind, aber auch er erzählt von hartem Kampf, von mutigem Ausharren und endlichem Sieg (tatsächlich handelt es sich um einen Grenzstein und steht nicht in Zusammenhang mit dem Freiheitskampf). Unter der Führung des FleckenvorstehersJürgen Fuhlendorf, der dort wohnte, wo jetzt Schlüters Gasthof steht, lehnten die Bramstedter Bauern sich auf gegen den Gutsherrn, einen Grafen Kielmannsegge, der sie unter seine Botmäßigkeit zwingen wollte. Unter schweren Opfern behaupteten sie ihre Unabhängigkeit; sie blieben, was sie von alters her gewesen waren: freie Leute. Außer dem Stein hält auch die sogenannte Fleckensgilde, eine lose Vereinigung der Hausbesitzer, die jedes Jahr am Pfingstdienstag ihr Gildefest, das stets durch einen Rundgang um den Roland eröffnet wird, feiert, die Erinnerungen an diese Zeit wach. Denn so wurde es damals, als nach dem Sieg über den Grafen die Gilde gegründet wurde, bestimmt: „So lang de Wind weiht un de Hahn kreiht, sall um’n Roland danzt warn, wenn de Sünn ünnergeiht.“ Die Neuzeit ließ diese denkwürdige Episode aus Bramstedts Vergangenheit wieder aufleben in dem mehrfach zur Darstellung gebrachten Volksstück „Edelmann und Buern“.
Darf ich Dich nun noch schnell hinbegleiten über die Beeckerbrücke zur Kirche, die sich inmitten des alten Kirchhofs erhebt, da wo die drei Hauptstraßen Bramstedts sich scheiden. Vielleicht interessiert Dich das Altarbild, gemalt von dem hier geborenen, vor kurzem in Gremsmühlen verstorbenen Künstler Hinrich Wrage. Vielleicht vertiefst Du Dich in die Schönheiten des alten gotischen Flügelaltars mit seiner reichen Schnitzerei, der früher die Stelle des jetzigen Bildes einnahm und auf dem Kirchenboden seiner Renovierung harrt. Vielleicht siehst Du Dir bei der Gelegenheit das an ebenderselben Stelle seiner Auferstehung entgegensehende Bildnis der Maria Magdalena, der Patrona des Gotteshauses, an. Auch an dem ältesten Stück der Kirche, dem aus dem 13. Jahrhundert stammenden Taufbecken, sowie an dem vor einigen Jahren wieder hergestellten Triumphkreuz mit seinen Nebenfiguren wirst Du nicht achtlos vorbeigehen, ebensowenig an den beiden messingenen Altarleuchten, deren Inschrift uns berichtet, daß sie im Jahre 1681 gestiftet sind von Lorenz Jessen aus Glückstadt, zum Danke dafür, daß er durch das Wasser der Bramstedter Gesundbrunnen von seiner Krankheit geheilt wurde.
So gäbe es noch mancherlei, was ich Dir zeigen möchte. Gern würde ich Dich begleiten zur Schleuse, die so versteckt liegt, daß die wenigsten diesen schönen Punkt kennen, oder mit Dir einen Aufstieg zum Schäferberg machen, von wo man nach der einen Seite die Stadt, nach der anderen fruchtbare Felder übersieht, während auf der dritten die Anlagen den Blick begrenzen – aber für heute wollen wir uns genügen lassen an dem, was wir gesehen haben. Es war mir ein Vergnügen, Dir mein liebes Bramstedt zeigen zu dürfen, und ich will nur wünschen, daß auch Dir der Weg nicht zu beschwerlich, die Zeit nicht zu lang gewordenist.
Ist das Wandern Dir aber keine Last, sondern eine Lust, und gedenkst Du hier längere Zeit zu verweilen, dann rate ich Dir, Dich in der weiteren Umgebung Bramstedts ein wenig umzusehen.
Bramstedt im Zeichen des Roland
Wenn wir dieser Tage auf einem Sonnabend auf den Wochenmarkt gehen, so sehen wir im Norden den Roland, der den gesamten Platz überragt. Und gerade an solchen Markttagen dürfte unser Roland, wenn er könnte, etwas von dem spüren, was jahrhundertelang wohl seine eigentliche Bedeutung war: der Wächter der Marktgerechtigkeit.
Schon im hohen Mittelalter war Bramstedt ein Handelsort, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt war. Und bereits zu jener fernen Zeit wachte ein Roland über das Leben und Treiben zu seinen Füßen.
Doch blicken wir etwas in die uns überlieferte Geschichte des Roland.
Es fällt uns heute nicht schwer, das Alter des jetzt stehenden Standbildes zu bestimmen. Seit fast 300 Jahren ziert er den Marktplatz. Ungleich schwerer ist es festzustellen, wann Bramstedt den ersten Roland aufweisen kann. Das älteste uns überlieferte Zeugnis führt in die Jahre 1531/32 zurück, als der Bramstedter Roland zum ersten Male erwähnt wird. Heinrich Rantzau erwähnt im Jahre 1590 den Roland.
Doch damit sind wir dem wahren Alter des Rolands zwar um einen, aber um keinen entscheidenden Schritt näher gekommen. Folgen wir den Gedanken Max Röstermundts in seinem Buch „Bad Bramstedt, Der Roland und seine Welt“, so kommen wir der Sache schon eher auf den Grund. Röstermundt weist darauf hin, daß weder das im Jahre 1530 beginnende Fleckensbuch noch die 1554 anfangende Kirchenchronik einen Anhalt für die Errichtung (genauer: Ersterrichtung) eines Rolandstandbildes geben. Nun ist es sicher richtig, wenn man der Auffassung ist, daß ein derart bedeutendes Ereignis von unseren Vorvätern festgehalten worden wäre. Da aber nichts dergleichen zu vermelden ist, kann man wohl mit Fug und Recht behaupten, daß Bramstedt schon um 1500, wenn nicht noch früher, einen Roland gehabt hat.
Ein weiterer Punkt soll zur Bestimmung seines Alters angeführt werden. Hamburg hatte um 1340 einen Roland, der bis 1389 gestanden haben soll. Aus derselben Zeit existiert ein Schreiben über einen zwischen dem Hamburger Bürgermeister und dem holsteinischen (Schauenburger) Grafen Adolph in Bramstedt abgeschlossenen Vergleich. Dies gibt zumindest einen Hinweis darauf, daß Bramstedt kein unbedeutender Ort gewesen sein kann und sich des Ansehens der „hohen Herren“ sicher sein konnte.
Mit etwas Wagemut kann man aus diesen Geschehnissen auch ableiten, daß die Legende vom häufigen Verweilen der Schauenburger Grafen in Bramstedt einen wahren Kern hat. Vielleicht ist dies alles auch ein Anhaltspunkt, um das Alter des Bramstedter Schlosses zu bestimmen. Gab es in unserem Orte einst ein Schloß der Schauenburger Grafen?
Doch zurück auf den Boden dessen, das wir mit den Ergebnissen der Geschichtsforschung absichern können.
Im Jahre 1628 lagerten im Ort kaiserliche Truppen, die sich nicht gerade sehr fein benahmen. So kam es, daß am 3. Tage nach Ostern ein gewaltiges Feuer ausbrach, und „alles, was zwischen den drei Brücken gestanden“, vernichtete, wie der damalige Pastor Galenbeck zu berichten weiß. Auch der Roland blieb nicht verschont, denn im Gegensatz zu unserem heutigen war er damals aus Holz gefertigt.
Die harten Kriegsjahre schienen den Bramstedtern nicht zu ermöglichen, ihren Roland neu zu errichten. Erst 1652 gibt ein Schriftstück erneut Auskunft über ihn. Friedrich III., König von Dänemark, schreibt am 2. Juli 1652 aus Glückstadt: „Haben auch daneben allergnädigst eingewilliget, daß in mehrbesagtem Unserm Flecken Bramstedte zur Beförderung der Eingesessenen Nahrung ein erhöhter Roland auf einem grünen Anger am offenen Wege, welcher nach Hamburg führet, wo die Brabandische Kaufleute und Ochsen-Händler ihre Contracten schliessen und rechtliche Entscheidung gegenwärtig seyn, an des vorigen Kriegszeiten verbrandten Stelle wieder aufgerichtet werden möge.“
So erfahren wir aus diesen kurzen Sätzen gleich mehrerlei:
– der Roland soll auf dem grünen Anger, dem heutigen Bleeck,
errichtet werden
– der Roland scheint offensichtlich schon früher dem Ochsen
handel gedient zu haben, dessen Blüte im 15. und 16. Jahrhundert
war
– der Roland gibt eine rechtliche Gewähr für Vertragsabschlüsse.
Nun – die Bramstedter brauchen noch zwei Jahre, bis sie 1654 einen neuen Holz-Roland einweihen können. Doch dieser wird schnell wieder ein Raub von Wind und Wetter. 1666 schreibt der durchreisende Trogillus Arnkiel, daß er ihn „wiewohl sehr alt und schwach“ gefunden habe. So verwundert es nicht, daß dieser Roland 1693 umgeweht wurde – vielleicht ein Zeichen für die stürmischen Ereignisse, die in jenen Jahren dem Flecken widerfuhren. Und wie ein Omen für ihre neue Freiheit wird im gleichen Jahr ein Stein-Roland gesetzt, der – so Arnkiel – seinem hölzernen Vorgänger sehr ähnlich sehen soll.
Dieser Roland erweist sich als wesentlich standhafter. Er ist, so der Itzehoer Restaurator Hans Kolbe im Heimatkundlichen Jahrbuch von 1965, aus Oberkirchener Sandstein gearbeitet und wird wahrscheinlich von Bremer Steinmetzen geschaffen worden sein.
Doch die Wirren der Zeit ließen den Roland nicht in Ruhe. 1813 lagerten, wie schon fast 200 Jahre zuvor, Truppen in Bramstedt, und diese errichteten rund um den Roland ein Strohmagazin, das im Winter zusammenbrach. So fand man im Januar 1814 den Roland zerbrochen unter der Last. Der Kirchspielvogt Cirsovius nahm die abgebrochenen Teile in Verwahrung, während der Rumpf auf seinem Platze liegen blieb.
All seinem reichen Erleben zum Trotz blieb der Roland so lange Jahre unbeachtet an seiner Stelle. Die Bramstedter scheinen sich ihrer Historie plötzlich nicht mehr bewußt, so daß es erst des massiven Einsatzes der „Schleswig-Holsteinischen Patriotischen Gesellschaft“ bedarf, bis man an seine Restaurierung denkt. Erst 1827 ist der Roland wieder in altem Glanze an seiner historischen Stätte zu sehen. Der Steinmetzmeister Klimesch aus Hamburg führte eine, auch nach dem heutigen Urteil von Herrn Kolbe, hervorragende Arbeit durch, als er die Teile wieder zu einem Ganzen zusammenfügte. Auch wird er es gewesen sein, der in die Steine, die heute den Roland umgeben, den Namen des damaligen Kirchspielvogtes Cirsovius, sowie der Fleckensvorsteher Peter Fölster und Friedrich Schmidt, einmeißelte.
In den folgenden Jahrzehnten blieb unser Roland von Katastrophen verschont, nur sein Standort verlagerte sich – bedrängt durch den sich entfaltenden Autoverkehr – immer weiter nach Westen. So fanden wir ihn einstmals fast in der Mitte des „grünen Angers“ und heute nur noch inmitten eines grünen Rasens.
Es soll hier der Vollständigkeit halber nicht unerwähnt bleiben, daß einige Historiker auch die Meinung vertreten, daß der Roland ein Denkmal für eine Person darstellt. So vertrat schon 1652 Casparius Dankwerth die Meinung, daß der Bramstedter Roland ein Denkmal für Gerhard den Großen sein könne, der 1317 siegreich aus der Schlacht am Strietkamp hervorging, bei der ihn auch die Bramstedter unterstützten. Andere meinen, daß der Name Roland auf einen sagenhaften Vetter Karls des Großen zurückgeht, der eine Art Sinnbild für einen Helden gewesen sein soll.
Doch wird dieses unseren Roland wenig stören und seiner Ausstrahlung wenig Abbruch tun, genausowenig wie die ungeklärte Frage, warum er als römischer Krieger dargestellt ist.
Zum Schluß dieser Betrachtungen über den Roland wollen wir noch einmal an den Anfang zurückkehren. Der Roland = Hüter der Marktgerechtigkeit heißt es oft. Doch – was hat es damit auf sich? Nun, nach allem, was wir uns heute über die alte Zeit vorstellen können, wird der Roland den zu seinen Füßen abgeschlossenen Verträgen, die wohl per Handschlag erfolgten, Rechtskraft gegeben haben. Die Brabandischen Kaufleute aus dem Süden kamen über Wedel nach Bramstedt und erwarteten hier die Viehherden, die aus dem Norden kamen. Auf dem breiten Markt des Fleckens werden sich die Kaufleute nach ihnen genehmer Ware umgesehen haben und eine Einigung mit den Besitzern gesucht haben. Sollte es bei diesem Handel zu Streitigkeiten gekommen sein, so wird eine Art Gericht (vielleicht auch nur eine Person) an Ort und Stelle geschlichtet haben. Das Zeichen des Rolands verlieh diesen Entscheidungen eine von allen anerkannte Rechtskraft. In alten Schriften finden wir im Zusammenhang mit dem Markt und dem Roland eine Bezeichnung der „Morgensprache“. Dies wird wohl die Verkündung der getroffenen Entscheidungen gewesen sein. Alles, was dem Gericht (oder dem Kirchspielvogt) am Vortage an Auseinandersetzungen vorgetragen wurde, entschied es in dieser Ansprache.
Ja und heute schaut unser Roland eher gleichgültig auf das Geschehen von seinem Sockel hernieder und vielleicht durchzuckt ihn bei manchen Geschäften eine wehmütige Erinnerung an alte Macht. Wer genau hinsieht wird bei dem einen oder anderen Handel wohl auch erleben, daß er beide Augen zudrückt.
Warum die Bramstedter ihren alten schönen Roland
nicht länger haben wollten
von Wilhelm-Heinrich Riecken
Mein Jugendfreund Christian Stürk und ich waren an einem schönen Sommertag zu Rad unterwegs und waren, da wir frühzeitig mit nüchternem Magen aufgebrochen waren, hungrig und durstig geworden. Wir näherten uns Bad Bramstedt und entdeckten gleich rechts am Ortseingang den einladend aussehenden Gasthof Stadt Hamburg. Nur flink hinein!
Im gemütlichen Gastzimmer verknackte jeder ein paar handfeste Hamburger Butterbrote mit deftiger hausgemachter Bauernmett-wurst und schönem frischen Holländerkäse, dazu ein großes Glas frische fettreiche Milch, und dann studierten wir die an der Wand aufgehängte Landkarte.
„Wohin wollen Sie denn, meine Herren?“ fragt der aufmerksame, freundliche Wirt, ein großer kräftiger Mann, dem der gepflegte Vollbart gut stand.
„Nach Bordesholm; dort steht vor dem historischen Dom die berühmte, über tausend Jahre alte, mächtige Linde.“
„Na, denn mal zu !“ So 75 Kilometer von Hamburg auf dem großen, knochenschüttelnden Hochrad mit drei- bis vierzölligen Vollreifen über die damals sehr ausgefahrenen Landstraßen und durch die Kleinstädte mit ihren holprigen Kopfsteinpflaster zu fahren, war damals eine achtungsgebietende Leistung.
„Wenn ich nicht irre, sind Sie beide hier zum ersten Mal zu Gast, meine Herren, da müssen Sie sich doch ins Radfahrerfremdenbuch eintragen.“ Damit händigte uns der geschäftstüchtige Wirt, Herr Hesebeck, ein ziemlich dickes, längliches Buch aus.
„Was wollen wir denn hineinschreiben?“ flüsterte ich Christian zu. „Mach einen Vers, du kannst ja dichten,“ gab er zurück. So lauschte ich ein wenig nach innen und schrieb keck und froh:
Wer heutzutage kein Rad besitzt,
den kann man nur bedauern,
denn der, der seine Kraft nicht nützt,
muß elendig versauern.
Der Turner hängt an seinem Reck
und kommt dabei nicht weiter,
der Sänger singt in einem weg
der Töne schwere Leiter.
Der Radler aber turnt und singt
und macht dabei noch Reisen,
drum haben ihn die Mädel gern,
ich kann es stets beweisen.
Wilhelm Heinrich Freiherr von der Lenkstange,
Stahlroß-Rittmeister, Hamburg.
Und darunter setzte Christian einen ebenso phantastischen Titel:
Baron Christian von Schleifstein,
Gut Mottenburg bei Teufelsbrück.
Der Wirt las schmunzelnd und verständnisvoll. „Das müssen meine Mädels auch lesen. He, Kamilla, komm her, wir haben heute adligen Besuch in unsrer Hütte.“ Kamilla las und rief fröhlich, als wir das Zimmer verließen: „Auf Wiedersehen, ihr Herren Stahlroßrittmeister!“
Herr Hesebeck trat mit uns vor die Tür, um uns die Fahrtrichtung zu zeigen. Da stoppte vor uns ein schneidiger Reiter seine schäumende, schöne braune Stute und schwang sich gewandt aus dem Sattel. An der ganzen Haltung erkannte man auf den ersten Blick den altgedienten Kavallerie-Offizier. Er trug einen mächtigen Schnurrbart und mochte an die fünfzig Jahre zählen.
Es war Graf Luckner, der tolle Graf, wie er im Volksmund ob seiner verwegenen Reiterstückchen hieß, der einen Besitz im benachbarten Bimöhlen hatte.
Sein Sohn ist Graf Felix von Luckner, der sich als wagemutiger Kommandant durch seine Kaperfahrten im 1. Weltkrieg einen unsterblichen Namen gemacht hat. Ich lernte diesen Seehelden, der immer so gemütlich seinen Brösel qualmte, kennen, als er 1930 mit seinem Vollschiff „Vaterland“ während einer Weltreise im Hafen von Los Angeles vor Anker gegangen war. Mit ihm zusammen reiste Julius Lauterbach, der gleichfalls durch seine verwegenen Abenteuer bekannte Kapitän der ruhmbedeckten „Emden“.
Nun zurück nach Bramstedt! Der schneidige Reitersmann entdeckte mein von vielen Neugierigen begafftes stolzes Hochrad und sagte lächelnd: „Meine temperamentvolle Lotte hat solch glitzerndes, hohes Stahlroß nicht gern und hätte mich neulich, als sie vor dem seltenen Anblick eines radelnden Hochradfahrers scheute, beinah in einen Graben geworfen.“
„Na, Herr Rittmeister, ich glaube, daß das allerfeurigste Roß das nicht fertigbringt.“ Der Graf dankte lächelnd, mit seiner Gerte salutierend.
Alsdann wies uns der Wirt unsern Weg: „Wenn Sie dort über den Rathausplatz fahren, kommen Sie links in der schönen Lindenallee an dem Schloß vorüber, das König Christian IV. von Dänemark für seine Geliebte Wiebeke Kruse bauen ließ. Dort steht auch der prächtige Roland. Die Straße führt über die Bramau-Brücke und teilt sich dann. Links geht es nach Itzehoe. Sie müssen sich rechts halten, bei der Kirche herum, da sind Sie bald an einer steilen, langgestreckten Anhöhe auf der Kieler Strecke und kommen über Neumünster nach Bordesholm. – Noch eins!“ schloß der Wirt seine Rede. „Sie sollten sich unsern Roland mal ordentlich ansehen. Wir Bramstedter sind sehr stolz auf dieses Wahrzeichen, denn er ist schöner als der Bremer Roland, der in Wedel, in Perleburg und in Brandenburg an der Havel.“
„Oh, wir werden ihren Roland gebührend bewundern.“ „Gut, meine Herren, dann will ich Ihnen noch etwas anvertrauen.“,.Na, und -?“ „Ja,“ sagte Vater Hesebeck, nach dem Grafen Luckner schielend, „das ist so ’ne Sache. Die Bramstedter wollen ihren alten schönen Roland nicht länger haben.“ Neugierig fragten wir: „Weshalb denn nicht?“ „Na,“ wandte sich Vater Hesebeck zum Grafen Luckner, „verraten Sie bitte das Geheimnis.“ Dieser spielte den Nachdenklichen, kratzte sich hinter dem rechten Ohr, schaute uns blinzelnd an und sagte: „Nun, er ist den Bramstedtern lang genug!“ – Wir waren gründlich reingefallen ! Nun aber rasch weiter! Alle schauten gespannt zu, als wir uns auf die großen Holzräder schwangen. Ein Anlauf, und schwups! Uns instinktiv zurückwerfend, saßen wir im hohen Sattel. Mit sportlichem „All Heil!“ strampelten wir los.Auszug aus dem Buch „Von Hamburg nach Amerika“ von Wilhelm-Heinrich Riecken, erschienen und verlegt bei Artur Haack, Bad Bramstedt.
Vom Bramstedter Schloß
Ohne jemanden enttäuschen zu wollen, sei gleich vorweg geschickt, das, was heute allgemein als Schloß bezeichnet wird, ist keines und ist auch nie eines gewesen. Doch das ist kein Grund zur Traurigkeit, denn es hat in Bramstedt einst ein Schloß gegeben. Dieses stand auf dem Gelände hinter dem heute so benannten Gebäude zur Glückstädter Straße hin.
Wir wissen davon aus zweierlei Quellen: Zum einen wird 1751/2 davon berichtet, daß der damalige Gutsbesitzer Graf Stolberg das alte Schloß abreißen ließ, und zum anderen ist bekannt, daß das heutige „Schloß“ in der zweiten Hälfte des 30jährigen Krieges errichtet wurde. Dies besagt nun eindeutig, daß es ein Schloß gegeben haben muß, und zwar schon vor 1600, denn worin haben sonst die Besitzer vorher gewohnt?
Leider sind bis heute noch keine Baubeschreibungen über dieses Schloß bekanntgeworden, so daß jede Vorstellung von seinem Aussehen fehlt. Doch gibt es Quellen, die berichten, daß das Haus so gestaltet war, daß man es mit gutem Recht als ein hochherrschaftliches bezeichnen kann. Auch die Tatsache, daß Bramstedt ein bedeutendes Handelszentrum zur Zeit der Ochsentriften war und auf eine uralte Geschichte verweisen kann, bestärkt die Annahme, daß in unserem Ort auch der hohe Adel zumindest hin und wieder seinen Aufenthalt nahm.
Vom Abbruch des Schlosses ist überliefert, daß die Grundmauern so dick gewesen sein sollen, daß man seine liebe Mühe hatte, diese zu beseitigen.
Doch nun genug der Rede vom nicht mehr vorhandenen Haus. Es soll jetzt die Rede vom Gut und vom heutigen „Schloß“ sein.
Als erster Besitzer bzw. Verwalter des Gutes ist ein Dirick Vageth aus den Akten bekannt, der Anfang des 16. Jahrhunderts auch „Borgimeister“ in Bramstedt gewesen sein soll. Dies ist insofern bemerkenswert, als daß Gut und Flecken Bramstedt ansonsten wenig miteinander zu tun hatten, wenn man einmal von gewissen Privilegien der Gutsbesitzer absieht. 1541 überschreibt König Carl III. das Gut seinem Sekretär Caspar Fuchs.
Die nächste Aktennotiz ist fünfzig Jahre später erfolgt. 1591 ist ein Gerdt Stedingk Eigentümer des Gutes. Stedingk war Mitglied des dänischen Hochadels und stand in Diensten des Königs. Er war verheiratet mit einer Elisabeth Fuchs, so daß angenommen werden kann, daß das Gut auf dem Erbwege in seinen Besitz kam.
Dann kommt für das Gut die Phase, die aus der Geschichte der Wiebeke Kruse bekannt geworden ist. 1631 kauft König Christian IV. die „Stedingkhyser“ für 19.000 Mark. Es ist sicherlich interessant zu wissen, daß sehr viele Bauern („Kätener und Hufner“) aus den umliegenden Dörfern an das Gut „jerrliche Abgaben“ zu entrichten hatten. So aus: „Weddelbrooke, Hiddershusen, Hagen, Borstell, Wimersdorf“. Nicht lange bleibt der König Eigentümer. Er schenkt das Gut und zusätzlich die Mühle einschließlich Gayen an Wiebeke Kruse (1633).
Mit einem Landaustausch sorgt Wiebekes Verwalter, ihr Bruder Henneken (oder Henricus) für eine zusammenhängende Gutsfläche im Westen der Stadt. Dies hat später noch zur Folge, daß das Gemeindegebiet von Bad Bramstedt auf dem Katasterplan zum einen als „Bramstedt Flecken“ und zum anderen als „Bramstedt Hoffeld“ geführt wird.
Schon 1632 wird von Christian die Errichtung eines „Vorwerks“ betrieben und die Restaurierung des Schlosses. Das Vorwerk oder Torhaus ist das Gebäude, das wir heute als Schloß bezeichnen.
Das Tor dieses mächtigen Hauses, dessen Mauerstärke 60 cm erreicht, soll übrigens von der ehemaligen Festung Krempe stammen, die im damaligen Krieg „geschliffen“ worden war. Auch viele der verwendeten Steine werden von anderen Orten stammen. denn bei genauem Hinsehen erkennt man, daß die unteren Teile des Gemäuers aus größeren Steinen sind als die darüber liegenden (zu sehen in der Durchfahrt). Das Vorwerk wird in erster Linie den Bedarf an Wirtschaftsraum und Unterbringungsmöglichkeiten für die Dienerschaft gedeckt haben.
Nach Wiebeke Kruse übernahm ihre Tochter Elisabeth Sophie verheiratete von Ahlefeld das Gut, die es an ihre Tochter Christine Sophie weitervererbte. Christine heiratete in zweiter Ehe den Johann Gottfried Baron von Kielmannsegg. Dieser erwarb über Kopenhagener Spekulanten die Pfandrechte über den Flecken Bramstedt, den der König in seiner Geldnot als Sicherheit gegeben hatte. So kamen Gut und Flecken praktisch in eine Hand. Doch wäre dies nicht schlimm gewesen, hätte der Baron nicht versucht, die Bramstedter zu unterjochen. (Davon mehr in dem Abschnitt über Jürgen Fuhlendorf und die Fleckensgilde.) Nun – auch die Aera Kielmannsegg nahm für Bramstedt ein Ende, und im Jahr 1698 erwarb der Oberstleutnant Baron von Grote das Gut. Dessen Frau erfreute sich bei den Bramstedtern nur einer sehr geringen Beliebtheit, da auch sie die Freiheit der Fleckenslüüd antasten wollte.
Von dem Verkauf blieben jedoch die Mühle und Gayen ausgeschlossen. In der Mühle wohnte nun Wiebekes Enkelin, mittlerweile als Frau von Dieden in dritter Ehe. Ihre einzige Tochter heiratete einen ungarischen Grafen Th. Th. von Schmidegg, und ihre Nachkommen zogen noch bis in die Mitte des letzten Jahrhunderts Nutzen aus Mühle und Gayen.
Nach dem Tode der Baronesse von Grote übernahm deren Neffe, Baron von Printz, das Gut, verkaufte es jedoch im gleichen Jahr, 1751, an den Grafen Christian Günther zu Stolberg, der als Amtmann des Kreises Segeberg am Orte tätig war. Dem Grafen Stolberg wurden in Bramstedt ein zweiter Sohn und eine Tochter geboren. Beide Söhne waren Dichter und mit Goethe befreundet und gehörten dem „Göttinger Hain“ an. Die Tochter taucht in Goethes Briefen als die „unbekannte Schwester“ auf.
Schon 1756 verließ Graf Stolberg das Gut, um in Kopenhagen als Hofmarschall tätig zu werden. Neuer Besitzer wurde der Regierungsadvocat Markus Nicolaus Holst, der es wiederum 1774 an den Justizrat Ferdinand Lawätz abgab. Herr Lawätz hat sich nicht nur um die Erhaltung vieler alter Schriftstücke verdient gemacht, er ist auch der Stifter der Lindenallee, die auf vielen Bildern dieses Buches zu sehen ist. Er mußte damals für die Pflanzung der Linden die Genehmigung des Fleckens gesondert einholen, da der Gutshof mit der Vorderfront des Schlosses endete.
Nach Lawätz kam das Gut in die Hände des Hamburger Professors Meyer, der mit Schau- und Lustspielen sowie Gedichten bekannt wurde. Er verstarb 1840 in Bramstedt, und sein Grabmal steht heute noch auf dem Kirchenrasen.
Nachbesitzer waren der Landdrost von Lütken und wiederum ein Graf von Kielmannsegg, der diesmal jedoch die Bramstedter in Ruhe ließ.
1857 kaufte N. F. Paustian als erster Bürgerlicher das „Schloß“. Da ihm auch die Mühle und Gayen gehörten, vereinigte er einen großen Teil des ehemaligen Gutes in seinen Händen. Gut 45 Jahre blieb dies alles in seinem Besitz. Zu Weihnachten 1902 melden die „Bramstedter Nachrichten“, daß der Besitz einschließlich dem Schloß und Gayen an „einen Herrn aus der Rheinprovinz“ veräußert worden sei. Der Erwerber war der Bergwerksdirektor Schrader, der bald darauf an die Makler Junge und Springer aus Itzehoe weiterverkaufte. Diese Parzellanten boten die einzelnen Grundstücke und Gebäude 1903 zum Verkauf an. Gayen ging an den Gastwirt Heinrich Fick, während das Schloß von der Familie Meyer erworben wurde.
Anfang der sechziger Jahre erward die Stadt Bad Bramstedt das Schloß von Meyer. 1969 wurde es mit erheblichem Kostenaufwand restauriert und stellt seitdem einen prägenden Punkt des Marktplatzes das ohne eigentlich je ein Schloß gewesen zu sein.
Wiebeke Kruse
Beschäftigt man sich mit der Geschichte Bramstedts, so stolpert man unweigerlich über einen Namen: Wiebeke Kruse. Ist dieser Name auch vielen Bramstedtern ein Begriff und haben sie ihn in Verbindung mit dem Schloß auch des öfteren vernommen, so wissen wohl nur wenige Genaueres über das Leben der Wiebeke Kruse zu berichten. Doch dank der in Bramstedt geborenen Historikerin Johanna Mestorf ist die Geschichte der Bauerntochter aus Föhrden für die Nachwelt festgehalten und zu Papier gebracht worden.
Wiebeke Kruse wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Föhrden als Tochter des Vollhufners Hans Kruse geboren (diese Aussage zur Herkunft ist mittlerweile als falsch erwiesen) . Wenn man der Legende glauben will, so trat an die Wiege eine „Tatersche“ (Zigeunerin) und prophezeite ihr den weiteren Lebensweg. Doch Wiebeke wuchs – ob mit oder ohne Prophezeihung – in ihrem Dorfe auf und soll von früher Jugend an einen besonderen Gefallen an dem Peitschenknallen der Kuhhirten gefunden haben.
Als Siebzehnjährige kam sie in das Haus des Jörgen Götsche nach Bramstedt, um dort im Haushalt zu dienen. Kaum ein Jahr später stand sie eines schönen Frühjahrstages an der Beeckerbrücke in der Aue und wusch die Wäsche, als sie auf der Brücke eine vornehm anmutende Reiterschar erblickte. Die Augen des einen Reiters, der auf der Brücke stehenblieb, um die Landschaft zu genießen, erfaßten das junge Mädchen und verweilten bei ihrem Anblick. Er fragte sie nach ihrem Namen, und sie antwortete ihm. Schnell entspann sich ein Wortwechsel, an dessen Schluß Wiebeke wußte, daß sie mit dem König Christian IV. gesprochen hatte und von ihm eingeladen war, als Dienerin seiner Gemahlin an seinen Hof zu kommen.
Nachdem der König unter einer großen Linde auf dem Schloßhof dem Vater versprochen hatte, sich für das Wohlergehen seiner Tochter einzusetzen, stand dem Aufstieg des Bauernmädchens nichts mehr im Wege. Und so kam Wiebeke, an deren gewitzten Antworten der König so viel Gefallen gefunden hatte, an den Hof und diente dort der Königin Christine.
Über Jahre hinweg half sie der Königin und kümmerte sich insbesondere um die Erziehung der Kinder. Dabei kam sie in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges in ganz Nordeuropa herum. Doch Anfang der 30er Jahre des Jahrhunderts fand Königin Christine sehr viel Gefallen an dem Rheingrafen Ludwig Otto von Solms. Dies blieb dem König nicht verborgen, und als es allzu offensichtlich wurde,was sichzwischen den beiden entsponnen hatte, verstieß er seine Frau, ohne sich jedoch von ihr formal scheiden zu lassen. Auch Wiebeke mußte zu dieser Zeit den Hof verlassen, weil sie auf die nachforschenden Fragen des Königs keine Mutter der Königin, Ellen Marsvin, und verbrachte auf deren Gut Kjaerstrup fast vier Jahre. Dort traf sie auch den König wieder, dermittlerweile die Sache in einem etwas anderem Licht sah. Er bat sie, der
seine Frau zu seiner Linken zu werden, und Wiebeke willigte nach reiflicher Überlegung ein. (Womit sie, um ehrlich zu bleiben, in Reihenfolge mindestens die dritte „linke Frau“ Christians war.)
So verbrachte Wiebeke viele Jahre an der Seite des geliebten Königs und gebar einen Sohn und eine Tochter.
Um Wiebeke nicht von der Gnade seiner ehelichen Kinder abhängig zu machen, schenkte er ihr 1633 das zuvor von den Erben des Grafen Stedingk erworbene Gut Bramstedt und zusätzlich die Bramstedter Mühle. In diese Zeit fällt auch der Neubau des Torgebäudes, das heute allgemein als Schloß bezeichnet wird.
In den folgenden Jahren übernahm wohl hauptsächlich der Bruder von Wiebeke, Henneken, die Verwaltung des Gutes, da sie selbst meist in der Nähe des Königs weilte. Doch soll Wiebeke Kruse eine gütige und großzügige Herrin gewesen sein, die immer wieder dort Hilfe gewährte, wo sie nötig erschien. Es geht auch die Legende, daß sie der Zigeunerin, die bei ihrer Geburt die Prophezeihung ausgesprochen hatte und der sie später noch einige Male begegnet sein soll, in Bramstedt Außen vom Tor (Butendoor?) ein Haus errichten ließ. Noch um 1800 soll dort eine Frau mit ihrer Tochter gewohnt haben, die man die „Tatersche“ nannte.
Christian IV. starb am 28. Februar 1648, und kaum zwei Monate später verschied auch Wiebeke, gerade vierzig Jahre alt. Ungeklärt ist, ob sie sich selbst das Leben nahm, ermordet wurde oder aus Kummer starb.
Wie gut die Entscheidung Christians war, ihr das Gut Bramstedt zu schenken, zeigt die Tatsache, daß der Sohn Christians, Friedrich III., seine „Stiefmutter“ des königlichen Hofes verwies.
Die Erben Wiebekes übernahmen den Gutshof. Es waren dies Ulrich Christian Gyldenlöwe, der 1658 ledig starb, und Elisabeth Sophie Gyldenlöwe, die einen Claus von Ahlefeld zum Mann nahm. Die einzige Tochter dieser Ehe, Christine, war in zweiter Ehe mit dem Baron von Kielmannsegg verheiratet. Dieser Baron sorgte für die Unbill, die den Namen Wiebeke Kruses zum Teil in Mitleidenschaft zog und den Namen Jürgen Fuhlendorfs in die Bramstedter Geschichte einführte.
Doch muß festgestellt bleiben, – will man Johanna Mestorf folgen – daß Wiebeke auch im höheren Alter mehr Freude am Peitschenknall der Hirten hatte als am Sich-unbeliebt-machen bei den Bramstedtern.
Der Flecken kämpft um seine Freiheit
Alljährlich sehen wir am 3. Pfingsttage, auch heute noch, die Fleckensgilde um den Roland tanzen. Voran die Musikanten wird zum fröhlichen Tanze aufgespielt. Diese schöne Tradition schreitet nun schon bald in das vierte Jahrhundert, und nicht wenige Bramstedter erinnern sich noch an die Heimatfeste 1924 und 1949 zum 250. und 275. Jahrestage der Fleckensgilde.
Nun wird sich mancher sicherlich fragen: „Ja, warum ist denn 1974 nicht das 300jährige Bestehen feierlich begangen worden?“ Genau an dieser Stelle finden wir den Ansatzpunkt, den Ursprüngen der Fleckensgilde nachzugehen.
Um diese berechtigte Frage gleich von vornherein zu beantworten, sei hier auf den Stein hingewiesen, der seit dem Umbau des „Rolandseck“ im Jahre 1906 in dessen Außenmauer zu finden ist. Er trägt die Inschrift „J.F.D. 1674“. Unsere Väter und Großväter sind wohl davon ausgegangen, daß dieses eine Art Ehrenstein sei, und setzen so das Entstehen der Gilde im Jahre 1674 an. Doch Anfang der fünfziger Jahre mußte man sich eines anderen belehren lassen. In seinem Buch „Der Roland und seine Welt“ stellte Max Röstermundt fest, daß die Geschehnisse, die zur Fleckensgilde führten, erst im Jahr 1685 anzusiedeln sind, und Hans Hinrich Harbeck unterstreicht in seiner „Chronik von Bramstedt“, daß es sich bei dem Stein in der Mauer aller Wahrscheinlichkeit nach um einen Grenz- (oder Prell-)stein handelt. Und so kommt es, daß sich die Gilde heute „Fleckensgilde von 1688″ nennt und damit auf ein Datum beruft, das im Gildebuch von 1756 genannt ist. (mittlerweile durch neue Urkunden auf 1560 datiert).
Doch schauen wir uns das Bramstedt Ende des 17. Jahrhunderts einmal an und vergegenwärtigen uns einen Überblick über die damaligen Vorkommnisse.
Wir schreiben das Jahr 1685. Bramstedt erstreckt sich nur in wenigen Ausläufern über Bleeck und Kirchenbleeck hinaus. König Christian V. von Dänemark ist Regent des Landes, und auf dem Bramstedter Schloß sitzt Christine, die Enkelin der Wiebeke Kruse, als Gutsherrin. Erst vor kurzer Zeit hat sie in zweiter Ehe den Baron von Kielmannsegg geehelicht, aber schon in dieser kurzen Zeit hat sie feststellen müssen, so sagt man, daß der Baron mehr am Klang barer Münze denn an den zarten Tönen der jungen Ehe interessiert war. Jedoch – auch Christine ist dem „Mammon“ nicht abgeneigt und erfreut sich bei den Gutsbauern nicht gerade sonderlicher Beliebtheit.
Der Flecken Bramstedt und das Gut sind in dieser Zeit in keinem sehr guten Zustand. Der dreißigjährige Krieg, der nachfolgende Schwedische Krieg und die „Polackenzeit“ haben tiefe Spuren hinterlassen. Davon zeugt auch das Aussehen des (hölzernen) Rolands, den man erst 1654 wieder aufgestellt hatte. Vom Wind und Wetter und den Stürmen der Zeitgeschichte ist sein einstiger Glanz stark verblaßt.
Geld war es, das den König veranlaßte, 1665 das gesamte Amt Segeberg (ohne die Orte Segeberg und Oldesloe) an den Grafen Königsmark zu verpfänden. Nach wenigen Jahren merkte dieser, daß trotz harter Pressung aus seinem Pfande nicht allzuviel Ertrag herauszuholen war, und so veräußerte er es weiter an den Etats-Rat Holgerstorff. Dem widerfährt das Schicksal nicht besser, und über den Assessor Elers gelangt der Pfandbrief schließlich an die Kopenhagener Kaufleute Weinmann und Wiegandt. Doch war dieses Geschäft nur mit anderem Hintergrund erfolgt. Es hatte der Ober-Rentmeister Brandt am Hofe ein Interesse, das Gut zu kaufen, da er vernommen hatte, daß der Baron von Kielmannsegg in Kopenhagen weilte, um einen zahlungskräftigen neuen Eigentümer zu finden. Brandt wollte sich mit dem Gut allein nicht zufriedengeben, und so veranlaßte er Elers zum Kauf und Verkauf des Pfandbriefes. Die Briefe sollten von den Kaufleuten an von Kielmannsegg verkauft werden, so daß das Gut mit dem Flecken, dem Hasenmoor und den Segeberger Holzungen als eine Einheit von Brandt hätten übernommen werden können. Ihm selbst waren wegen seiner Stellung bei Hofe solcherlei Geschäfte (Machenschaften wäre wohl der richtige Ausdruck) nicht möglich gewesen.
So ergab es sich, daß der Baron von Kielmannsegg die Pfandrechte erwarb. Er kam dazu „wie die Jungfrau zum Kinde“, schreibt treffenderweise der Fleckensgildenchronist Walter Ehlers 1949.
Man schreibt den 27. Oktober 1685, als dieses Geschäft zustande kommt. Der Baron von Kielmannsegg „vergißt“ nun aber urplötzlich seine Verkaufsabsichten. Ihm scheint offensichtlich der Gedanke, Herr über zig Quadratmeilen in Holstein zu sein, sehr gut zu tun. Aus Kopenhagen zurückgeeilt, läßt er am Sonntag von der Kanzel der Kirche verkünden, daß er den Flecken mit allem dazugehörenden gekauft habe und daß er für den nächsten Tag von jedem Haus zwei Personen als Jagdhelfer erwarte. Das ist jedoch nicht bloß dem Fleckensvorsteher Fuhlendorf ein wenig starker Tobak. Diese Auslegung des Pfandbriefes und der darin für den Inhaber verbrieften Rechte geht ihnen doch zu weit. Nicht genug, daß sie die Steuern und sonstige Gelder an den Gutsherrn zu zahlen haben, nun sollen von ihnen Dienste verlangt werden, die sie den Leibeigenen fast gleichstellen.
So versuchen die Ratmänner die Forderungen zunächst einmal zu verzögern, um sich beraten zu können. Am Nachmittag erscheint der Bruder des Barons bei ihnen und verliest den Pfandbrief und versucht sie von der Auslegung des Barons zu überzeugen. Die Ratmänner bitten sich Bedenkzeit bis zum nächsten Tage aus. Am selben Nachmittag erscheint der Vogt bei Fuhlendorf und verlangt, daß er am nächsten Morgen vier Pferde stellen und nach Hamburg fahren solle. Jürgen F. antwortet, daß ihm der Baron keine Obrigkeit sei, sondern der König allein. Der Vogt kommt noch ein zweites und drittes Mal und droht mit dem „Verließ“. Fuhlendorf bleibt hart und sagt, daß ihn auch der Tod nicht schrecken könne.
Die Sonntagnacht geht schnell vorüber, und in manchem Hause findet gar niemand Schlaf. Am Morgen des Montag versammeln sich alle auf dem Bleeck, und es ist ein großes Debattieren. Nach langem Hin und Her einigen sich die Männer. Sie wollen zusammenstehen und auch Leib und Blut für ihre Freiheit geben. Unter die Herrschaft des Bramstedter Hofes wollen sie sich in keinem Fall begeben.
Gesagt – getan. Sechs wackere Bramstedter gehen auf den Hof des Barons. Doch sie erschrecken sehr. Nicht nur, daß der Baron seine gesamte Dienerschaft, seine Bauern und viele Fleckensleute, die in seinen Häusern wohnen, versammelt hat – nein, auf der Diele steht ein großer Tisch, hinter dem der Baron sitzt, und auf diesem Tisch blinkt es von Degen und Pistolen. Dies schmeckt den Gesandten wenig, und sie sehen zu, daß sie ohne Prügel aus dem Hause kommen.
Gegen Abend wagt sich eine zweite Delegation von sechs Leuten auf den Gutshof, dieses Mal ist Jürgen Fuhlendorf unter ihnen. Sie weisen die Forderungen des Barons zurück und sagen, daß sie lieber wegziehen wollten, als sich in die Unfreiheit zu begeben. Der Baron sagte: „Ich werde jeden, der wegziehen sollte, verfolgen lassen und ihm den Kopf abschlagen.“ „Sachte. Sachte,“ sagte darauf ein Ratmann. „Es läßt sich nicht so leicht Köpfe herunterschlagen.“ Ein Wort gibt das andere, bis der Baron schlielßlich zu den Waffen greift, Jürgen Fuhlendorf niederschlägt und ihn fürchterlich zurichtet. Damit nicht genug – er läßt ihn ins Gefängnis werfen. Die anderen können entkommen und alarmieren den Flecken. Sofort greift man zu allem, das als Waffe dienen kann, und zieht auf den Gutshof. Da überlegt es sich der Graf und gibt Jürgen Fuhlendorf frei.
Ausgestanden ist die Angelegenheit so einfach nicht. Der Baron reitet eilends nach Glückstadt und fordert zwei Kompanien Soldaten, um den Flecken zu „beruhigen“. Auch die Bramstedter entsenden Timm Langhinrichs und Jochen Zimmer an die Elbe und erklären, daß sie den Kauf rückgängig gemacht haben wollen und einen Schutzbrief verlangen, solange dieses Verfahren dauere.
Der Baron unterliegt in seinem Bestreben, und die Bramstedter erhalten den Schutzbrief. Jedoch – der Adel bekommt auch sein Recht, und so werden Jürgen Fuhlendorf und einige Getreue zunächst arretiert, und nach einiger Zeit wird der Fleckensvorsteher als einziger in das Gefängnis geworfen, trotz seiner vielfältigen Verletzungen.
Was so furios begonnen, geht nun auf dem Verhandlungs- und Petitionswege weiter.
Die Bramstedter wenden sich an den König mit der Bitte, den Flecken wieder einzulösen und nicht unter die Herrschaft des Hofes Kommen zu lassen. Der Rat und Amtsverwalter Brüggemann zu Itzehoe verspricht zu helfen, doch der Ober-Rentmeister Brandt zu Kopenhagen hat seine Vorstellungen noch nicht aufgegeben und versucht, so weit es ihm möglich ist, die Sache zu hintertreiben.
Beharrlichkeit führt zum Ziel. Wieder und wieder werden Bramstedts Fleckenslüüd vorstellig. Schließlich kommt die Einigung: Der Flecken soll 14.000 Reichstaler an den Kaufmann Weinmann zahlen, dann soll der Kauf des Barons für nichtig erklärt werden. Schweren Herzens stimmen die Bramstedter zu. Ihnen bereitet die Verteilung der Last große Sorgen und viel Diskussionen. Die getroffene Regelung zeigt, wie groß der Opfermut der Fleckensinsassen ist. Alle sollen die gleiche Last tragen. dafür sollen alle Äcker, Wiesen und Holzungen im Fleckensgebiet unter ihnen verteilt werden.
So werden drei Obligationen ausgefertigt, die zu verschiedenen Terminen an den Amtsvorsteher Brüggemann als den Bevollmächtigten Weinmanns (!) zu zahlen sind. Noch im Dezember werden die ersten 4.000 Reichstaler angezahlt, und schon zeigt sich, daß Brüggemann ebenfalls eigene Interessen bei der unglückseligen Geschichte verfolgt. Er will vom Flecken das „Hasen Mohr“ und die „Hölzungen in der Segeberger Heide“ kaufen. Und wie das so ist, wenn einer etwas will, was die anderen nicht wollen, und der eine auch noch über mehr Möglichkeiten verfügt – entspinnen sich allerlei Mißliebigkeiten für den Flecken. Nachdem den Fleckensbevollmächtigten der erste Pfandbrief trotz gegenteiliger Zusage nicht ausgehändigt wird, verweigern diese die nächste Zahlung.
So kommt es zu viel Hin und Her, an dem der Tod Brüggemanns genausowenig ändert, wie der neue Weinmann-Bevollmächtigte Markus Dau.
Ober-Rentmeister Brandt mischt immer wieder einmal mit, und selbst der Kirchspielvogt Wolf E. Haseler preßt den Flecken. Ein Besuch beim König bleibt ohne Erfolg, und der Amtsverwalter Reich läßt sechs Bramstedter, unter ihnen Jürgen Fuhlendorf, nach Segeberg kommen und dort verhaften. Wochenlang bleiben sie im Gefängnis, während sich Reich in Kopenhagen vergnügt.
Endlich meint es das Schicksal gut mit den Fleckensinsassen: Reich kommt bei einer Feuersbrunst in Kopenhagen ums Leben, und sein Nachfolger, Etat-Rat Meyer, willsich für den Ort einsetzen. Er kommt zu Besuch und bittet etwas später die Bramstedter. zu ihm nach Rendsburg zu kommen. Doch keiner traut sich nun nach den schlechten Erfahrungen in Segeberg. Nur Jürgen Fuhlendorf findet den nötigen Mut. Er reist hin und erläutert dem Rat die Probleme.
Es wird vereinbart, daß Hasenmoor und die Segeberger Holzungen an den König gehen und mit 6.000 Taler berechnet werden. Die restlichen 4.000 der 14.000 Taler sollen bis 1695 bezahlt werden.
So soll es denn auch im wesentlichen geschehen sein. Zwar dauert die Einigung im Flecken über die Landaufteilung noch bis ins nächste Jahrhundert, doch ändert dies nichts an der Tatsache, daß der Flecken sich freigekauft hat. Zur Verwahrung nimmt man die Obligationen in die Fleckenslade, um sie auch den Nachkömmlingen zu erhalten.
Die Bramstedter danken dem Herrgott für die glückliche Wendung und werden auf der Welt für ihren Einsatz entlohnt, indem der König die Bemessungsgrundlage für ihre Steuern und Abgaben herabsetzt.
Ob die Bramstedter schon damals oder erst in späteren Jahren am 3. Pfingsttage um den Roland getanzt haben, ist nicht festzustellen. Indes hat der heutige Brauch seinen Ursprung in der Überlieferung.
Die Ehrung der Männer, die ihren Leib nicht schützten, um ihre Freiheit zu bewahren, hat sich die Fleckensgilde, die ursprünglich eine Brandgilde war, auf das Banner geschrieben. Fleckensgilde von 1688 nannte sie sich aufgrund schriftlicher Überlieferung. Doch wie es der Zufall wollte, stieß ich bei der Lektüre für dieses Buch auf eine Stelle in Harbecks Chronik, in der sich ein Einwohner Bezug nehmend auf einen Brand im Jahre 1677 äußert: „Meine Mittel und der Gilde Beistand reichten nicht; ich mußte Schulden machen.“ (Harbeck, S. 178) Dies bedeutet nichts anderes, als daß unsere Gilde schon 1677 bestanden haben muß. Fortan wird sie also „Fleckensgilde von 1677“, heißen können.
Schon zu Lebzeiten hat man Jürgen Fuhlendorf, dem Fleckensvorsteher in der schweren Zeit, einen Stein in die Rolandmauer gesetzt. „J.F.D. 1693″ ist darauf zu lesen (nicht 1695, wie bei H. H. Harbeck geschrieben). und man kann wohl annehmen, daß die Bramstedter im Jahre der Errichtung ihres ersten steinernen Rolands auch dem Manne ein ewiges Andenken bewahren wollten, der wie ein Steig gegen die Wogen der Obrigkeit gestanden hatte. (Es ist aber denkbar, daß es sich, wie bei dem eingangs angeführten Stein, auch hier um einen Grenzstein handelt.)
Seit 1938 ist die Bramstedter Oberschule, das heutige Gymnasium, nach diesem Manne benannt, und seine Nachkommen findet man noch heute in Bramstedt und Umgebung. (Es sind allerdings keine direkten Nachkommen, wie eine Betrachtung der Ahnenreihe zeigt.)
Um die überlieferten Vorkommnisse im Gedächtnis der Bramstedter zu bewahren, schrieb der Bramstedter Lehrer und Organist August Kühl als Volksstück „Edelmann un Buern“, dessen Text noch heute im Stadtarchiv auf eine engagierte Theatergruppe auf der 3. Wohltätigkeitsveranstaltung des Krankenhausvereins am 8.8.1909 statt. Wiederaufführungen gab es zu den Heimatfesten 1924 und 1949 sowie zum 30jährigen Bestehen der höhern Privatschule 1938, als deren neue Namensgebung erfolgte.
Von Kriegen und anderen Schrecken
Bramstedts Lage am Ochsenweg, der alten Heerstraße, hat es in der Geschichte immer wieder mit sich gebracht, daß der Ort in die sogenannten Wirren der Zeit hineingezogen wurde.
Ähnlich wie Stellau und Bornhöved hat auch Bramstedt seine mittelalterliche Kampfstätte aufzuweisen, denn die Streitereien der hohen Herren um die Vorherrschaft im Lande zwischen den Meeren dauerten über Jahrzehnte und Jahrhunderte an und führten zu immer neuen Schauplätzen.
In Bramstedt erinnert noch der Name der Straße „Strietkamp“ an die Ereignisse des 14. Jahrhunderts, von denen hier (halb Legende, halb Historie) berichtet werden soll.
Um 1300 herrschte in Holstein der Graf Johann, mit dem Beinamen der Einäugige. Den Beinamen erhielt er, weil er bei einem Weih-nachtsessen ein Auge verloren hatte, als ein Hofnarr einen Knochen nach einem Junker warf, der ihn geärgert hatte – leider verfehlte das Wurfgeschoß sein Ziel und traf den Grafen an bezeichneter Stelle.
Graf Johann, der auch in Bramstedt auf dem hiesigen Schloß residiert haben soll, vererbte schon zu Lebzeiten seinen Besitz an seine vier Söhne. Da aber die Erbteile der einzelnen offensichtlich nicht groß genug waren, um deren Lebensgewohnheiten zu finanzieren, kam es zum Bruderzwist. So starben im Laufe einiger Jahre die Söhne auf mehr oder weniger natürliche Art und Weise. Auch die Enkel, Neffen und sonstigen Verwandten wurden sich nicht einig. So kam es, daß 1317 Graf Adolph VII. die Entscheidung mit Graf Gerhard III. suchte. Letzterer brachte bei Bramstedt ein Heer aus Hademarschen, Schenefeld, Nortorf, Kaltenkirchen und Kelling-husen zusammen. Graf Adolph, der die Ankunft der Dithmarscher, die ihn unterstützen wollten, nicht abwarten konnte, griff an und mußte sich bald der Übermacht beugen. Adolph suchte sein Heil in der Flucht und wollte Bramstedt erreichen. Kurz vor Bramstedt verbarg er sich unter einer Brücke (der Hambrücke). Als nun Gerhard mit seinen Mannen ihm folgte, sah einer seiner Reiter, wie der Jagdhund Adolphs umherstreunte. Bald hatte der Hund die Spur seines Herren gefunden und lief unter die Brücke. Graf Adolph wurde gefangengenommen, und Gerhard ging als Sieger aus den Auseinandersetzungen hervor.
Gerhard erhielt später den Namen Gerhard der Große. Er war der Schauenburger Graf, der im Schleswig-Holsteinischen und Dänischen am meisten Macht auf sich vereinigen konnte. Doch 1340 starb auch er eines gewaltsamen Todes, als er auf dem Krankenbett lag.
Soweit also die frühesten uns bekannten kriegerischen Ereignisse aus der Bramstedter Gemarkung. Auch in den folgenden Jahrhunderten ist es in dieser Gegend nicht immer friedlich zugegangen, so kämpften hier 1401 nochmals die Schauenburger, doch erst aus der Zeit des 30jährigen Krieges sind uns Überlieferungen bekannt.
Vom Pastoren Galenbeck, der in jenen wechselvollen Jahren im Kirchspiel Bramstedt tätig war, wird berichtet, daß von 1627 – 1629 Kaiserliche Truppen im Holsteinischen waren. Am Dienstag nach Ostern 1628 ist der Flecken in Brand gesteckt worden. „Alles, was zwischen den Brücken gestanden, von dem Hohen Tore über die Hudau und Mühlenstrom, ingleichen die Mühle, des Pastoren Haus und die zwei, so dabei stehen“ ist ein Raub der Flammen geworden.
An diesem Tage wird wohl auch das alte Bramstedter Schloß zumindest stark beschädigt worden sein; denn aus Akten jener Zeit, als Christian IV. den Hof erwarb, sind Abrechnungen über umfangreiche Renovierungsarbeiten bekannt.
Doch war dies nicht das letzte Ereignis, das in jenem Jahrhundert den Flecken erschütterte. Schon wenige Jahre nach dem Krieg zogen neue Heere beim Schwedenkrieg durch das Land und preßten die Bewohner. Polnische Truppen quartierten sich in Bramstedt ein, raubten Pferde und andere Tiere, wühlten den Boden der Kirche auf und suchten nach allem, was irgendeinen Wert hatte.
1660 schreibt der Chronist, daß die polnischen Truppen auf ihrem Rückweg aus Dänemark „den Bramstedtern den Rest geteilt“ hätten.
Aber auch die Friedenszeiten waren nicht ohne Schrecken. 1668 brannten im Flecken sieben Wohnhäuser ab: „Jasper Wulf, Hinrich Fölster, Metta Hartmann samt dem Stall, Johann Krützfeldt, Martin Schulten samt der Schmieden, Johann Hardebeck, Bartelt Gieselers.“ Noch nicht einmal zehn Jahre später verzeichnet die Kirchenchronik erneut eine Feuersbrunst, bei der unter acht Häusern auch die Küsterei in Flammen aufging.
Noch einmal, im Jahre 1725, ist von einer großen Feuersbrunst im Flecken die Rede. In den folgenden Jahren ist hiervon nichts Ähnliches mehr überliefert.
Doch nicht nur Feuer und Krieg zehrten an den Kräften des Fleckens. Anno 1746 wird im Fleckensbuch von einer Viehseuche (Maul- und Klauenseuche) berichtet, die 217 Stück Vieh dahinraffte. Das dürfte zu damaliger Zeit gut die Hälfte der gesamten Nutztiere am Orte gewesen sein, und wir vermögen uns vorzustellen, welch harte Zeit für die Blekeslüüd herrschte.
Das nächste Jahrhundert begann nicht gerade rosig. Napoleon sorgte in Europa für Unruhe, und es kam zum Krieg, indessen Verlauf in Bramstedt Truppen lagerten. Im Winter 1813/14 errichteten die Soldaten ein Lager im Bleeck, und als sie abzogen, ließen sie einen umgestürzten und zerbrochenen Roland zurück.
Von 1826 – 28 grassierten die Schafpocken in Holstein, und von 1831 – 33 suchte die Cholera diese Gegend heim, ohne daß wir über eventuelle Opfer am Ort nähere Auskünfte hätten.
Als es dann 1848 hieß, für die Freiheit zu streiten, waren auch die Bramstedter dabei. Einige Freiwillige meldeten sich in Rendsburg für die schleswig-holsteinische Sache. Am Orte selbst wurde eine Bürgerwehr ins Leben gerufen, um Ruhe und Ordnung aufrechtzuerhalten. Der älteste Sohn des örtlichen Pastors Gerber, Wilhelm, gründete einen Bürgerverein für politische Bildung.
Nicht allein die Kriegszeiten bedrückten den Ort. Seit mehreren Jahren herrschte die Kartoffelkrankheit und vernichtete so eines der Hauptnahrungsmittel.
Die nachfolgenden Kriege blieben für den Flecken selbst meist ohne materielle Schäden. Zwar fielen Söhne und Väter aus einigen Familien, doch sorgten Veteranen- und Kriegervereine für den rechten Zeitgeist. Erst der 2. Weltkrieg ließ Bramstedt den Krieg wieder direkt spüren. Nicht nur, daß aus fast allen Familien Angehörige fort waren, auch der Ort selbst wurde betroffen. Am 27. Juli 1942 fiel eine Luftmine auf den Bleeck, die von englischen Bombern abgeworfen wurde, als diese von Hamburg zurückkehrten. Die Bauernhäuser Zimmers und Göttsches wurden dem Erdboden gleichgemacht, ebenso das Sängerheim und das Wohnhaus Siems im Butendoor. Andere Häuser in der Mühlenstraße, am Bleeck und bis in den Butendoor hinein wurden abgedeckt oder sonst wie beschädigt. Zehn Menschenleben forderte dieses Unglück.
Dieses war das letzte schwere Unglück, das den Ort traf. Wohl gab es noch viele kleine und große Brände, doch meist blieben diese auf ein Haus beschränkt. Und die Zeit der Seuchen und Kriege ist hoffentlich für unsere Gegend endgültig vorbei.
Von den Bramstedter Toren und Brücken
Keinem, der auf dem Bleeck steht, wird es gelingen, die Stadt zu verlassen, ohne einen Fluß oder ein Gewässer zu überqueren.
Wenn diese Behauptung niemanden stutzig macht, so sei es gut, wenn aber doch jemand meint, dies sei nicht richtig, so wird er sicherlich an den Weg nach Segeberg denken. Und genau an dieser Stelle wollen wir unsere kleine Abhandlung beginnen.
Auch der Butendoor hat seine Brücke, selbst wenn manch einer behaupten wird, daß es keine sei. Auf Höhe der Mühle Andersens läuft der sogenannte Verbindungsgraben von der Osterau zur Hudau, und die Brücke, die ihn überquert, hatte früher den Namen „Hogendohrer Brüch“. Das (heute zweifellos bescheidene) Rinnsal, das an dieser Stelle überbrückt wird, ist eine Verbindung zwischen dem Mühlenteich und der Hudau. Die Brücke war früher wesentlich schmaler und auch als solche zu erkennen. (1899 beschlossen die Fleckensvorsteher, daß die „Außermtorbrücke“ verbreitert werden solle; und der Ausbau der Segeberger Chaussee ließ die Brücke quasi verschwinden.)
Indes bleibt nicht nur die Brücke interessant. Ihr Name gibt den Hinweis auf ein ehemals vorhandenes Tor. Tatsächlich hat an dieser Stelle einst ein Tor gestanden, das sogenannte „Hogedor“. Durch den Namen darf man sich jedoch nicht irreleiten lassen. „Hoge“ deutet zwar darauf hin, daß es sich um ein besonders stattliches Tor gehandelt haben mag, trotzdem wird es nicht viel mehr als ein Schlagbaum gewesen sein. In alten Akten unserer Stadt findet man die Bezeichnung „Rönnebaum“ in Zusammenhang mit diesem Tor, und Rönne heißt soviel wie Rinne oder Graben; es war also der (Schlag-)baum bei dem Graben.
Ist dieses Thema noch so interessant, verlassen wir dennoch den Bleeck einmal durch dieses Tor. Wenn man dem Butendoor (man achte auf diesen Namen) folgt, so bemerkt man nach gut hundert Metern, daß die Häuserfronten beiderseits der Straße plötzlich auseinanderlaufen und ein separater Weg auf der rechten Seite verläuft. Dies gibt Grund zu der Annahme, daß vor langer Zeit der Weg hier entlang über den Strietkamp Richtung Schmalfeld führte.
So leicht, wie hier geschrieben, war es damals natürlich nicht, nach Schmalfeld zu gelangen, denn zunächst galt es, die Schmalfelder zu überqueren. Zu Fuß war dies kein Problem, wohl aber mit Gespann. Deshalb hat man auch schon sehr früh eine Brücke errichtet, die Hambrücke (= Waldbrücke). Diese Brücke hat die älteste uns bekannte Geschichte, als sie bei der Schlacht am Strietkamp 1317 eine verhängnisvolle Rolle für den Grafen Adolph von Schauenburg spielte. (In diesem Buch bei „Von Kriegen und anderen Schrecken“ nachzulesen).
Zu jener Zeit und noch viele weitere Jahre war die Hambrücke die der Altonaer Straße und der Hamburger Straße, die heute weit mehr benutzt werden, entstammen beide der neueren Zeit.
Nach dem Südwesten hin bot zu jener Zeit nur noch die Hudaubrücke die Möglichkeit, die Auen zu überschreiten. Auch sie, in unmittelbarer Nähe des Schlosses gelegen, war mit einem Tor versehen, dem sogenannten Hudetor. Über die Brücke und durch das Tor wurde im späten Mittelalter der Weg in die Residenzstadt Glückstadt angetreten.
Ihre eigene Historie hat auch unsere Beeckerbrücke. Von ihr aus soll – wie im Kapitel Wiebeke Kruse berichtet – Christian IV. seine Wiebeke erblickt und sein königliches Auge auf sie geworfen haben. Wenn auch die Brücke damals etwas weiter flußabwärts gestanden haben wird (die Bebauung am Kirchenbleeck läßt dies vermuten), so ist es uns dennoch nicht möglich, den Ort des Geschehens heute zu rekonstruieren. Trotzdem hat Wiebeke ihr Glück gefunden, und die Bramstedter haben ein königliches Kapitel mehr in ihrer Chronik.
Der Name dieser Brücke war sehr stark der Zeit unterworfen, und so sprach man eine Zeitlang (und zum Teil noch heute) von der Bäckerbrücke, weil man die Brücke mit der anliegenden Bäckerei in Verbindung brachte. Der ursprüngliche Name hat aber die Bedeutung Bachbrücke, und auch die Straße Maienbeeck erinnert an das Beecker Tor.
Bleibt noch das letzte Tor Bramstedts zu erklären. Dieses war das Bektor. Ist der Name auch überliefert, so läßt sich sein Standort nicht einwandfrei festlegen. Am wahrscheinlichsten ist wohl, daß es am Eingang des Maienbeecks zum Kirchenbleeck gestanden hat, um dort die von Westen kommenden Einreisenden kontrollieren zu können.
Vollständigkeitshalber sei erwähnt, daß den „Bramstedter Nachrichten“ vom 18.11.1903 zufolge Anfang des 18. Jahrhunderts für alle hier erwähnten Brücken vom König die Renovierung (bzw. der Neubau) betrieben wurde: 1701 die Hudaubrücke; 1706 die Beeckerbrücke; 1711 die Hogendohrer Brücke und 1717 die Hambrücke.
In alter Zeit bildeten die Brücken und ihre Tore jedoch nicht nur Übergänge über die Auen, sondern waren auch eine Art Begrenzung der Siedlung, wie aus dem am Schluß erwähnten Zitat zu sehen ist.
Ursprünglich dürfte Bramstedt nur den Bleeck mit Hinterstraßen umfaßt haben. Erst allmählich dehnte sich der Ort entlang der Ausfallstraßen aus. Aus dem 17. Jahrhundert sind Siedlungsgenehmigungen für den Butendoor und den Maienbeeck vorzeigbar, so daß man davon ausgehen kann, daß zunächst diese Straßen sowie der Kirchenbleeck und der Anfang des Landweges (vorwiegend von Kätnern = kleinen Bauern) besidelt wurden.
Nach dem Bau der Kiel-Altonaer Chaussee 1830 – 33 wurde auch entlang dieser Straße vermehrt gebaut, doch seine eigentliche größere Ausdehnung erfuhr der Ort erst in diesem Jahrhundert. Noch um die Jahrhundertwende war die Straße „Hinter den Höfen“ (Rosenstraße) nur dünn bebaut, und neue Häuser entstanden auch im hinteren Teil des „Landwegs“, „Am Bahnhof“ und im „Schlüskamp“. Die Bebauung des Nordens und Westens, das Gebiet des ehemaligen Gutshofes unserer Stadt, fällt überwiegend in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg, als die Bevölkerungszahl sprunghaft anstieg (1900: ca. 2.100 Einwohner).
Heute ist das Gebiet zwischen den Brücken „nur noch“ der historische, kleine Kern der Stadt.
Zum Schluß noch eines: Früher waren die Brücken nicht nur eine geografische Abgrenzung des Bleecks, sondern offensichtlich auch eine soziale. denn in alten Urkunden findet sich der bezeichnende Satz: „De Herrn in’n Blek unn dat gemeen Volk op de anner Sied von de Brügg“. – Da kann man nur hoffen, daß unsere Herren „in’n Blek“ heute nicht genauso denken.
Vom Ortsnamen und den ersten Bewohnern
Jeder, der über Bad Bramstedt etwas wissen will, wird sich unweigerlich auch Gedanken über den Ortsnamen selbst und das Alter dieser Siedlung machen, um nicht zu sagen, machen müssen.
Nun, bevor wir ein wenig in die Materie einsteigen, soll auch an dieser Stelle vorausgeschickt werden, daß bei dieserlei Nachforschungen vieles im Dunkel der Geschichte verschwunden ist. Aber einiges tritt durch Funde, Überlieferungen und intensive Kleinarbeit der Historiker aus dem Dunkel zumindest in die Dämmerung und einiges sogar an das Licht.
Fangen wir mit dem Ortsnamen an. Dabei ist das Vorwort Bad noch am schnellsten und einfachsten erklärt, denn diese Bezeichnung führt Bramstedt erst seit dem 12. März 1910. Damals wurde diese Titulierung Bramstedt auf Initiative der Post zuerkannt, um posta lische Verwechslungen mit Barmstedt und anderen ähnlich lautenden Orten zu vermeiden. Es war also nicht, wie man vermuten könnte, in erster Linie eine Anerkennung des Kurortes. sondern eher eine Zweckbezeichnung. Doch zur Ehrenrettung des Bades Bramstedt sei gesagt, daß natürlich das Solbad die Gewähr dafür bot, daß der Name Bad Bramstedt richtig gewählt war. Die Entwicklung unseres Ortes hat die Initiative der Post von einst nur bestätigt.
An den eigentlichen Ortsnamen wollen wir von hinten herangehen. Die „Stede“-orte sind allesamt Niedersachsensiedlungen und sind in ihrem Entstehen in der zweiten Hälfte des ersten Jahrtausends nach Christus anzunehmen. Stede heißt soviel wie Stätte, Wohnstätte oder Aufenthaltsstätte.
Nun fehlt also nur noch die Bedeutung von Bram, und da schleicht sich auch gleich die Mehrdeutigkeit der Forschung ein. Es gibt einige Forscher, die vermuten, daß Bram von dem Personennamen Bramo stammt. Doch da diese Meinung nicht sehr zahlreich vertreten wird, wollen wir es bei ihrer Erwähnung belassen.
Häufiger, wenn nicht überwiegend, ist die Auffassung, daß unser Ortsname von dem niederdeutschen Wort Braam oder Bramm abstammt, und dieses bedeutet nichts anderes als Ginster. Unser Ort war danach eine von Ginsterbüschen umgebene Wohnstätte.
Nun – es ist heute sicherlich nicht schwer, Ginster in der Bramstedter Feldmark zu finden, doch wird man mit Recht die Frage stellen, ob dieser so dominierend sei, daß man den Ortsnamen danach wählen könnte.
Auch bei diesem berechtigten Zweifel helfen Überlieferungen. So berichtet Hans Hinrich Harbeck in seiner Chronik, daß der Mühlen besitzer N. F. Paustian an der Landstraße nach Bimöhlen zehn Tonnen Ginsterland verbrannt habe, um das Land urbar machen zu können. Dies war sicherlich nicht das erste Stück Land, das auf diese Art und Weise der gelb leuchtenden Pracht beraubt wurde, und so können wir mit Sicherheit davon ausgehen, daß reichlich mehr von diesem Strauch in unserer Landschaft zu sehen war. J. Kähler schreibt in seinem „Stör- und Bramautal“ sogar, daß „der ganze Höhenzug von Bramstedt nach Bimöhlen gelb davon“ gewesen sei.
Damit genug vom Ginster, von den „Steden“ und vom Bad, denn es war zweifellos nicht das kräftige Gelb, das unsere Vorfahren nach hier lockte. Schon eher waren es die Auen, die für saftige Wiesen und genügend Wasser sorgten, und der Höhenzug im Norden, der Schutz vor den kalten Winden bot. Dies werden die Gründe gewesen sein, warum sich hier Menschen niederließen.
Nicht zuletzt den Ausgrabungen des Bramstedter Lehrers (und ehemaligen Leiters der Volkshochschule) Gerhard Müller haben wir es zu verdanken, daß wir Genaueres über die ersten Siedlungsspuren wissen. Doch auch bei vielen Aushebungen für Neubauten und bei einer systematischen Grabung im Jahre 1905 kam allerlei zutage.
Nach vielerlei Tonscherben, Urnen, Werkzeugen und anderen Gebrauchsgegenständen kann man mit Sicherheit davon ausgehen, daß schon 8000 v. Chr. an den Hängen des Liethberges (und seiner östlichen Fortsetzung) gesiedelt worden ist. Von dieser Zeit an lassen sich fast lückenlose Beweise für eine Siedlungstätigkeit in unseren Graden aufzeigen.
Am Rande sei erwähnt, daß ein Kurgast in seiner Moorwanne sogar eine römische Münze aus der Zeit Trajans (98 – 117 n. Chr.) fand.
Hatten wir eben festgestellt, daß bei Bauvorhaben oft etwas ans Licht kommt, so muß auch festgestellt werden, daß vieles unter den heute vorhandenen Bauten verborgen sein mag, was uns reichhaltig Aufschluß geben könnte. So scheint insbesondere der Standort unserer Kirche von Interesse zu sein. Zum einen wurden Kirchen in alter Zeit oft an Thingstätten der Heiden errichtet, zum anderen werden einige schon gehört haben, daß man behauptet, daß sich an dieser Stelle einst eine Burg befunden hätte. Wenn man sich unter Burg nicht gerade eine Festung nach Muster der Rhein burgen vorstellt, sondern eher Sachsenburgen, wie man sie heute noch in Hitzhusen und Willenscharen in der Landschaft sehen kann, so läßt sich diese Vorstellung auch mit hiesigen Funden in Einklang bringen.
Die Sachsenburgen waren Ringwälle, die mit Palisaden versehen waren und den Bewohnern als Zuflucht bei Gefahr dienten (daher auch der Name Fluchtburgen). Und in der Tat fand man bei Straßenbauarbeiten im Schlüskamp und im Landweg Reste von Holz, die an Palisaden erinnerten. Vielleicht war es diese Burg, die Sagen in Gang setzte um die einstige Größe unseres Ortes und um hier stattgefundene Schlachten.
Doch weg von der Spekulation: Einen konkreten Hinweis darauf, daß Bramstedt schon vor mehr als tausend Jahren eine gewisse Bedeutung hatte, kann man in der Tatsache sehen, daß der Apostel Ansgar hier zwischen 834 und 840 predigte und das Christentum verbreiten wollte. Der Flurname Kapellenhof soll vielleicht an die Stätte erinnern, an der dieses geschehen ist. Ansgar hatte aber offensichtlich nicht den gewünschten Erfolg, denn 300 Jahre später ist die Rede davon, daß Vicelin dem Christentum dieserorts wieder Eingang verschaffen soll. Doch waren sie nicht die einzigen, denen so widerfuhr, und die Bramstedter scheinen sogar später auch wackere Christen geworden zu sein. Der Bau unserer Kirche, den man auf 1316 datiert, gibt Grund zu dieser Annahme.
Mit dem Jahr 1316/17 haben wir auch den Anschluß an die anderen Abschnitte dieses Buches gefunden, und so wollen wir uns mit dieser nicht mehr nachtschwarzen, aber auch nicht taghellen Vergangenheit zufriedengeben.
Die Quelle unter dem Eichenbaum
Es war vor nunmehr rund 300 Jahren, als der achtzehnjährige Knabe Gerd Gieseler an einem Junitage im Jahre 1681 das Vieh seines Vaters, Bartelt Gieseler, auf dem Wege nach Bimöhlen hütete. Dieser Knabe litt seit seiner frühesten Kindheit an einem Fieber, das ihm immer zu schaffen machte. Als ihn an diesem Tage ein Fieberschauer überkam, setzte er sich unter einen Eichbaum am Wegesrand nieder und, so weiß die Chronik zu berichten, betete zu Gott, daß er ihn von seiner Krankheit befreien möge. Just in diesem Augenblick wurde er einer Quelle gewahr, die an dem Fuße des Baumes hervorsprudelte. Gerd hielt seinen Hut auf, um mit dem Wasser seinen Fieberdurst zu löschen. Kaum hatte er von dem Naß gekostet, durchlief ihn ein Schauer, und sein Durst war fort, sein Fieber entschwunden.
Der Hirt schwieg zunächst über dieses Ereignis. Als er aber hörte, daß die Frau des Nachbarn Johann Hambeck auch am Fieber litt, sagte er ihr, daß sie von dem Wasser holen möge, das unter dem Eichenbaum hervorsprudelt. Sie tat, wie ihr geheißen und genas. Schnell machte nun diese neue Kunde sich im Lande breit, und von allerorts strömten Heilungssuchende nach Bramstedt, um von der Quelle „hinter den Mohrstätten“ (Karkenmoor) zu trinken.
Der Chronik nach sind über 800 Kranke, die als Lahme, Krüppel oder Blinde gekommen waren, von ihren Leiden genesen. Man erzählt, daß sie ihre Krücken in den Baum gehängt haben. Der Baum selbst soll noch bis 1707 gestanden haben. Für die Heilkraft der Quelle gibt es auch heute noch Zeugen der Vergangenheit: Ein Altarleuchter in der Kirche trägt die Inschrift: „Anno 1681 den i. Juli ist Larenz Jessen, Kön.-Prov. Verwalter in Glückstadt, durch Gebrauch des Wassers von Quartan befreiet; verehret diese Leuchter zum Gedächtnis“, und in den Kirchenbüchern aus jener Zeit steht geschrieben, daß aus dem am Brunnen aufgestellten Armenstock in den Jahren 1681 – 88 insgesamt 2188 Mark der Kirche übergeben worden sind.
Doch irgendwann in diesen Jahren verlor die Quelle ihre Anziehungskraft und erst 80 Jahre später, im Jahre 1761, gab es ein erneutes Aufblühen. Für einige Monate beschäftigten sich in dem Sommer dieses Jahres Wissenschaftler, Behörden und allerlei Leute mit dem Brunnen. Es wurden Untersuchungen des Wassers angestellt und sogar eine Brunnenordnung erlassen, um den Andrang zu regulieren.
Es dauerte nach diesem kurzen Aufblühen weitere 50 Jahre bis Bramstedts Quellen wieder ins Gespräch kamen. Um 1810 stellte der Hamburger Baumeister Hübener den Antrag, am Orte eine Brunnenanstalt zu errichten.
Doch es handelte sich nun nicht nur um eine alte Quelle auf der Brunnenwiese am Karkenmoor, sondern um neu entdeckte an der Lentföhrdener Aue, hinter der Hambrücke und auf einer Flur mit dem Namen Holenförd (auch Halenfjörd = Hamvie).
Diese neuen Quellen befanden sich allesamt dort, wo wir heute das neue Kurhaus finden, und man war sich schon damals über deren heilende Wirkung einig.
Inwieweit die Pläne des Herrn Hübener zur Ausführung gekommen sind, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall war es ein Unternehmen von kurzer Dauer. Vielleicht sind daran auch der damalige Krieg und die Besetzung Bramstedts schuld.
Für unsere neuere Zeit ist das Jahr 1879 von ernsthafter Bedeutung. Fast zweihundert Jahre nach der wundersamen Heilung des Gerd Gieseler erwirbt der Kätner (Bauer) Matthias Heesch an der Osterau eine Wiese.
Man erzählt, daß er eines Tages mit seinem Arzt zusammen im Holsteinischen Haus saß und diesem erzählte, daß seine Wiese nach der jüngsten Überschwemmung ganz weiß ausgesehen habe. Der Arzt, Dr. Postel, erläuterte ihm, daß dies vom Salzgehalt käme. „Da müßte man Bäder verabreichen,“ meinte er zu dem einfachen Landmann. Nun, Heesch ließ sich das nicht zweimal sagen. Er baute nahe der Quelle ein bescheidenes Haus aus Brettern und
verabreichte kalte Solbäder. Nachdem es ihm gelungen war, das Süßwasser aus der Quelle fernzuhalten, verbesserte sich die Solequalität. Auch wurden neue Bohrungen aufgenommen und weitere Gebäude errichtet.
Nachdem mehrere seiner Patienten öffentlich die Heilwirkung bekräftigten, kam die Sache so richtig in Schwung.
Die Bramstedter Fleckenssparkasse tat damals das ihrige, indem sie in der Nähe des Kurhauses Anlagen pflanzen ließ und den Badesteig renovierte. Schon bald reichte das Angebot an Unterkünften am Matthias-Bad nicht mehr aus, so daß die Verwandten Heeschs 1905 am Dahlkamp ein Unterkunftshaus errichten ließen, das uns heute noch als „Waldburg“ erhalten ist. Heesch selbst starb schon 1887 im Alter von 67 Jahren. Doch der Erfolg der Heeschs ließ die Konkurrenz nicht schlafen:
Herr Behncke erwarb in unmittelbarer Nähe ein Gelände und baute dort „Behncke’s Sol- und Moorbad“. Dies geschah im Jahre 1911.
Auch das mittlerweile Stadt und Bad gewordene Bramstedt zeigte sich mehr an dem Kurbetrieb interessiert. Fußwege wurden angelegt und überholt und die Grünanlagen besonders gepflegt.
Es sei hier am Rande vermerkt, daß Bramstedts Quellen das Wasser für den einstmals existierenden „St. Johannis-Sprudel“ (der im Eppendorfer Krankenhaus viel Verwendung gefunden haben soll) und den „Roland-Sprudel“ lieferten. Diese Quellen sprudeln heute nicht mehr, dafür aber ein artesischer Brunnen in der Rheumaklinik.
Doch zurück zu den Bädern Heeschs und Behnckes. Im Jahre 1918 kauften kurz vor Ende des 1. Weltkrieges Hamburger Interessenten nicht nur die Bäder der beiden Bramstedter, sondern auch das Gelände der Sparkasse am Kurhaus und den Rühgerpark. War diese Entwicklung von alten Bramstedtern zunächst mit einigem Argwohn betrachtet worden, so rechtfertigte sie sich doch schon bald durch eine Belebung des Kurbetriebes. Das Moor wurde eingehend untersucht und zeigte ein so positives Ergebnis, daß man es verstärkt einsetzte. Auch kam zu der Betreuung von Privatpatienten eine engere Zusammenarbeit mit den Ortskrankenkassen hinzu.
Schon bald zeigte sich, daß das alte Kurhaus zu klein war. Es kam der Gedanke eines Neubaues auf. Doch traten dabei auch andere Kurorte als Bewerber auf. Bramstedts Stadtväter wußten die Situation der Stunde einzuschätzen, und so boten sie den Landesversicherungsanstalten den Kaiser-Wilhelm-Wald hinter der Hambrücke als kostenloses Baugelände an. Diesem Angebot konnte man sich nicht verwehren, und so wurde nach den Plänen des Architekten Feindt im Mai 1929 der Bau eines neuen großzügigen Kurhauses in Angriff genommen.
An dieser Stelle muß auch dem langjährigen Bramstedter Bürgermeister Gottlieb C. Chr. Freudenthal ein nachträgliches Lob ausgesprochen werden. Ihm ist es zu verdanken, daß das ehemalige Ödland jenseits der Hambrücke für ganze 5 Mark vom Fiskus erworben wurde und systematisch aufgeforstet wurde. Vielleicht war es eine stille Eingebung, die ihn spüren ließ, welche Bedeutung dieses Gelände später einmal für den Ort haben würde.
Am 25. Oktober 1930 wurde das neue Kurhaus eingeweiht. Schon wenige Jahre später wurde das „Kurhaus an den Auen“ erbaut und 1936 mit der Rheumaheilstätte verbunden. Seitdem ging die Entwicklung stetig weiter. Der Name des damaligen Direktors Oskar Alexander wird damit verbunden bleiben, und zu Recht trägt die Straße von der Segeberger Straße zum Kurhaus seinen Namen.
In den fünfziger und sechziger Jahren wurden das Haus des ärztlichen Dienstes, ein Verwaltungsgebäude und das Kurhaustheater geschaffen. Kurmittelhaus II und III (Am Teich), der Neubau des Zentralgebäudes und zweier Bettenhäuser folgten, und heute wird mit viel Energie die Renovierung des Baus von 1929 betrieben. Die Namen der Verwaltungsdirektoren Herbert Alexander und Reinhold Rath stehen hinter diesem Aufschwung.
Würden Matthias Heesch heute nach rund hundert Jahren oder gar Gerd Gieseler nach rund dreihundert diesen Kurort sehen können, so würden sie sicherlich ihr Erstaunen über die von ihnen ausgelöste Entwicklung nicht in Worte fassen können. Wer hätte es auch vermuten können, daß aus der Quelle unter dem Eichenbaum und aus dem Salz an den Grashalmen einer Wiese eine der größten Spezialkliniken der Welt werden würde?
Paul Behlau erinnert sich
Seit dem 6. Oktober 1914 bin ich als geborener Bramstedter doch eigentlich kein Bramstedter mehr. „Ich höör dar nich mehr to, bün Butenlänner.“ Es ergab sich bald nach dem Kriegsende, nach meinen sogenannten Wanderjahren, daß ich in Altona ansässig wurde, also gar nicht mal so weit von Bramstedt entfernt. So war es für mich immer einfach, von Altona aus ein Wochenende in dem mittelholsteinischen Ort zu verleben und immer wieder festzustellen, daß Bramstedt doch ein „hübsches Nest“ sei. Sogar eine Vergangenheit, ja eine interessante Vergangenheit hat der Ort. geologisch wie auch geschichtlich. Man denkt an die „Unter der Lieth“ ausgegrabenen Urnengräber, an den Waren-Umschlagplatz an der Bramau, man erinnert sich auch daran, daß die Wegekreuzung West-Ost und Nord-Süd einmal wichtige Handelsplätze waren (vielleicht schon zur Hansezeit oder noch eher). Der „Ossenweg“ führte durch den Ort weiter nach Kiel oder Hamburg. Früh schon, sicherlich schon in heidnischer Vorzeit war Bramstedt „Thingstätte“ (Gericht) und erhielt die Marktgerechtsame. Im 17. Jahrhundert entdeckte, wie es hieß, ein Hütejunge die Heilkraft der Quelle (Gesundbrunnen), und es gab Leute, die von weit herkamen, um sich an dem Wasser gesundzutrinken. Wiebeke Kruse aus Föhrden gefiel einem dänischen König so, daß er sie mitnahm nach Kopenhagen. Kein Wunder, daß Anekdoten und Balladen um sie und ihr Leben herumgeschrieben wurden. Viel später, erst zu meiner Zeit, entwickelte sich das Solbad und in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts erst die große Badeanstalt mit Kurhaus und Kureinrichtungen. Die Bezeichnung „Stadt“ durfte „das Flecken Bramstedt“, wie es einmal hieß, ab 1910 etwa führen.
Aber ich gehöre seit 1914 nicht mehr dazu. Ich bin Hamborger, wie man früher einfach alles nannte, was „mal so“ von Hamburg zugereist kam. Bramstedt ging mich also gar nichts mehr an. Doch Heimat ist Heimat, und man kann die Jahre mit ihrem wechselvollen Geschehen und den ebenso wechselvollen Bildern nicht einfach aus sich herausschütteln.
Soweit ich zurückerinnern kann, war Bramstedt in meinem Leben, wie es war, was es tat. Das sind nun drei Vierteljahrhunderte. In so langer Zeit merkt man, daß alles in noch tiefere Vergangenheit versinkt. – Da war der eigenartige Geruch. Schon, wenn ich hier der Bahn entstieg, kam mir oft ein eigenartiger Geruch entgegen, den ich (für mich) einfach mit der Bezeichnung „Bramstedter Luft“ abtat. Was das eigentlich mit der Luft zu tun haben sollte, das habe ich viel später herausgekriegt. Es war der Rauch des Torffeuers, das noch in vielen Haushalten üblich war und sich bei günstigem Wind über dem Ort ausbreitete.
Es gab einmal eine Zeit, da war Bramstedt mehr ein großes (Kirch)dorf als eine kleine Stadt. Da fuhr noch täglich der Postwagen (von Wrist), da fuhren noch die Erntewagen auf holperigem Pflaster, da trieben morgens und abends die „Kohlhaders“ (Hütejungen) die Kühe nach und von der Weide. Zumeist nahmen sie ihren Weg durch die Furt, die von beiden Ufern aus durch die Au führte. Die „schiefe
Ebene“, die die Furt bildete, diente uns Jungen im Winter zum „Rüschen“ (Schlittenfahren). Wer da seinen Fuß am Ende der Fahrt nicht richtig einhaken konnte, landete unweigerlich im Wasser. An Wintertagen scholl von den Bauernhäusern her der rhythmische Schlag der Dreschflegel und später mehr und mehr das Summen des „Döschdampers“, des „Döschkassens“.
In den letzten Jahren des vorigen Jahrhunderts wurde der Landweg zur Provinzial-Straße ausgebaut. Vorbehauene Steine, die zu schnurgeraden Zeilen gesetzt wurden, werden der Straße eine bis dahin ungekannte Glätte geben. Es war auch wohl an der Zeit, denn die Straße belebte sich. Es kamen Lastkraftwagen daher, Personenautos mit abenteuerlich gekleideten Insassen. Man machte sich wohl in den Jahren zum ersten Mal Gedanken darüber, wo das alles, das damals Neue, noch hinführen wolle. Wie war es überhaupt damals mit den Autos? Das Erste in Bramstedt hatte ein Arzt, das Zweite ebenfalls ein Arzt, das Dritte legte sich ein Rechtsanwalt zu. Man kaufte Grammophone und wunderte sich bald nicht mehr, wenn aus den Fenstern oder gar aus Türen die Öffnungen kleinerer und größerer Trichter herauslugten. Musik kam aus den Dingern heraus, Marschmusik, Gassenhauer, sentimentale Lieder, wie sie eben so im Schwange waren. Handwerker, die vielfach auf dem Lande arbeiteten, kauften Fahrräder, um sich die Zeit für ihre Wege zu verkürzen. Klaas Sachtleben, ein Chausseewärter, war ja wohl der letzte seiner Gemeinde, der auf seinem Hochrad zur Arbeit fuhr. Das mochte kurz vor der Jahrhundertwende gewesen sein. In meine Kinderjahre fiel auch die Weiterführung der Altona-Kalten-kirchener Eisenbahn, die sonderbarerweise in den ersten Jahren ihres Bestehens nur bis Kaltenkirchen führte. (Man hielt den Ort schon damals für fortschrittlicher.)
Zwei Nachtwächter gab es in Bad Bramstedt. Zu ihrer eigentlichen Wächtertätigkeit hatten sie noch die Aufgabe, die Straßenlampen zu putzen und mit Petroleum zu versorgen. Ich glaube aus meiner tiefsten Vergangenheit zu erinnern, daß sie sich auf ihren nächtlichen Wegen mit einer Knarre bemerkbar machten.
Ebenfalls in diese Jahre fiel der Bau des Wiesensteiges (vom Dahlkamp nach der Glückstädter Straße). Er wurde beiderseitig mit Bäumen bepflanzt und fügte sich sogleich in die Landschaft ein. Wie er selbst einen prachtvollen Anblick bot, so gewährte er in seiner ganzen Länge einen schönen Ausblick über die Wiesen, das Stadtbild bis zur Lieth, die damals noch von vielen Waldstücken bestanden war. Wer noch aus der Zeit stammt und die Bäume heute betrachtet, der kann sich vorstellen, was sie im Laufe von sieben Jahrzehnten an Umfang „angesetzt“ haben. Jünglinge waren sie damals, wie ich einer war. Man kann nach so langer Zeit aber auch erleben, daß man plötzlich vor einem Baum steht, der damals noch gar nicht da war. Ja, so genau glaubt man, die Stätte seiner Kindheit noch im Gedächtnis zu haben.
Dort, wo jetzt das Hochhaus sich an die Lieth lehnt und von seiner Höhe weit über das Land schaut, stand einmal eine Wattefabrik, die noch während der ersten Jahre dieses Jahrhunderts in Tätigkeit war. Die Kratz- und Spinnmaschinen wurden zusammengeschlagen, während für die Dampfmaschine eine Schrotmühle errichtet wurde. Doch auch diese kam zu keinem nennenswerten Ertrag, und die Räumlichkeiten wurden zu Schweineställen umgebaut. So hatte man hier ein Bild der Entwicklung in großer Deutlichkeit vor Augen. Eine Großschlachterei wurde errichtet und ging wieder ein. Dies war am Kirchenbleeck. Eine neue entstand dafür am Schlüskamp. Sie war das zaghafte Beginnen einer Industrie. Die Bauern begannen ihre verstreut liegenden Ländereien zu „verparzellieren“ und draußen in den Feldern neue Höfe zu errichten. Man ahnte ja wohl schon damals, daß einst für bäuerliche Betriebe im Ort kein Platz mehr sein werde. Mit der zunehmenden Technisierung zeigte sich, daß das Oel ein zukunfttechnisches Handelsobjekt wurde. Bis dahin hatte man einen halben Liter Petroleum gekauft und ein bißchen Maschinenöl. Und dann kam die Elektrizität – aus eigenem Werk – vom eigenen Schalter – Bramstedt war modern geworden.
Einige Bramstedter Originale
von Paul Behlau
Trina mit’n Bart
Eigentlich hieß sie Trina Lorenz. Wir nannten sie aber so, weil sie am Kinn einen übermäßig starken Haarwuchs hatte. Sie hatte aber auch immer eine abgeplattete Schnapsflasche (Köhmbuddel) bei sich. Sie trank also, doch ich habe sie nie betrunken gesehen, höchstens mit einem „Glööskopp“. Wer kurzfristig Arbeiten zu verrichten hatte, wandte sich an sie. Mit ihr ließ sich was schaffen. Sie war als tüchtige Arbeiterin bekannt. Zu Festtagen, wozu sie auch Hochzeiten, Kindtaufen und Konfirmationen in der Nachbarschaft rechnete, ging sie mit einer Schere auf die Bartstoppeln los, band einen reinen „Pisten“ vor und beschmierte ihr Haar mit Fett (Smolt). Für Kuchen und andere Geschenke hatte sie eine große Tasche unter den Rock genäht. Man ließ sie gewähren und gab ihr reichlich, obgleich sie doch zumeist gar nicht eingeladen war.
Adolf Schümann
Er verkaufte Lehm, Sand, Kies und Grand vom „Tegelbarg“, der wohl auch in noch früheren Zeiten aus seinen eiszeitlichen Ablagerungen vieles für den Bau des Ortes hergegeben hatte. Um seine Ware abzuliefern, benutzte er eine Karre, die er sich selbst gebaut (trechtklütert) hatte und entsprechend primitiv aussah. Kasten mit Deichsel und zwei Räder hatte das Ding. Was er aber davorspannte, waren nicht Hund noch Esel, sondern zwei über die Maßen große Ziegenböcke, die furchtbar stanken. Er selbst hatte sich mit einer Sackschürze feingemacht. Als Ausrufer verdiente er sich noch ein paar Groschen dazu.
Trina Steckmest
genannt Stuten-Trina
Anna Ahrens
Auch sie (Utropersch) klingelte sich mitunter durch den Ort. Sie war ein zerarbeitetes Weiblein (schon damals mit blauer Brille) und hatte als Auftrag auszurufen, daß dann und dann dort und dort Tanzmusik sein werde oder daß bei einem Schlachter prima fettes Ochsenfleisch zu verkaufen sei. Ja, dieser Mittel bediente man sich, um solche Neuigkeiten bekanntzumachen. Die Zeitung gab es zwar, aber man glaubte eben, auch noch die alte Form anwenden zu müssen.
Bramstedts alte Straßen- und Flurnamen
Ohne viel Vorrede soll hier ein Text abgedruckt werden, der am 24. November 1937 im „Segeberger Kreis- und Tageblatt“ unter dem Titel „Bramstedter Straßennamen im Wandel der Zeiten“ erschienen ist. Leider ist der Verfasser dieses Textes unbekannt, jedoch läßt der Buchstabe K., den man zum Schluß auf der Zeitungsseite findet, auf August Kühl schließen.
„Bad Bramstedt hat den Vorzug, daß die Bezeichnungen für Straßen und Plätze fast ohne Ausnahme heimatgebunden sind. Das ist wohl zur Hauptsache zurückzuführen auf das nur ganz langsame Wachstum des Orts. Wo Straßen wie Pilze aus der Erde schießen, da macht man, um Namen zu finden, allerorten Anleihen, bei Dichtern, bei Heerführern, bei sonstigen verdienten Männern und Bäumen usw. Das war hier nicht erforderlich, die bodenständigen Namen lagen sozusagen griffbereit. Ein weiterer Grund für diese Namengebung dürfte die Anhänglichkeit der Einwohnerschaft an das Vorhandene, ihre Wertschätzung für das Althergebrachte sein. Dieser Sinn für das Gewesene und uns von unseren Vorfahren Überlieferte läßt uns hoffen, daß eine zwanglose Betrachtung des oben gekennzeichneten Gebiets manchem Leser erwünscht sein wird.“
Der Bleeck hat sich viele Erklärungen gefallen lassen müssen. Besonders oft bringt man das Wort mit „Blick“ zusammen und erklärt Bleeck als den Ort, von dem man einen freien Ausblick zum Himmel hat. Wir halten Bleeck für eine Bezeichnung, die gleichbedeutend ist mit Ort, Flecken. In alten Urkunden wird Bramstedt geradezu der Bleeck genannt. Ähnlich war es in Alt-Neumünster, das aus zwei Teilen, dem Lütten und dem Groten Bleeck, bestand, an deren Stelle später der Klein- und Großflecken traten. In dem Dorfnamen Hüttblek treffen wir dasselbe Wort in gleicher Bedeutung. Auch in Bramstedt gibt es wie früher in Neumünster einen Groten und Lütten Bleeck, der erstere wird schlichtweg Bleeck genannt, der letztere heißt, weil bei der Kirche liegend, Kirchenbleeck. Als Zubehör zum Bleeck kann man die beiden Hinterstraßen auffassen, die große oder Mühlen-Hinterstraße östlich, die kleine westlich vom Bleeck. Letztere führt jetzt den treffenden Namen „Achternbleeck“, während man erstere zur Mühlenstraße gemacht hat. Dieser Name will uns weniger gefallen. Unter Mühlenstraße versteht man doch eine Straße, in der die Mühle liegt oder die wenigstens als Zufahrt zur Mühle dient. Weder das eine noch das andere trifft für unsere Mühlenstraße zu. Zwei schmale Straßen, nach Hamburger Vorbild Twieten genannt, verbinden den Bleeck mit seinen Hinterstraßen. Die eine zweigt zwischen Kaufmann Schlichting und Bauer Köhncke nach Achternbleeck ab, die andere verläßt den Bleeck ostwärts zwischen den Häusern von H. Delfs und A. Rumohr. Eine dritte Twiete verbindet den Kirchenbleeck mit der Rosenstraße. Nach einem früher dort wohnhaften Drechsler heißt sie die Dreiertwiete.
Nach Südosten zweigt vom Bleeck die Straße Butendoor ab. Noch vor wenigen Jahren einer schlecht gepflasterten und auch in anderer Hinsicht ungepflegten Dorfstraße vergleichbar, ist sie jetzt, seit der Vollendung der Reichsstraße nach Bad Segeberg, eine unserer schönsten Straßen geworden: glatt und geradlinig zieht sie sich zwischen den Häusern dahin, nicht bloß für den Fußgängerverkehr, sondern oft auch noch für freundliche Vorgärten reichlich Raum lassend. Butendoor hieß sie schon in alten Zeiten, weil sie außerhalb des Hogendoors lag. Später, als so vieles ohne Not und Zweck verhochdeutscht wurde, nannte man sie Außermtor und bewies damit nicht bloß, daß man unsere plattdeutsche Muttersprache verachtete, sondern auch, daß man die hochdeutsche Sprache nicht zu meistern verstand. Vor einigen Jahrzehnten ist man wieder zum guten Alten zurückgekehrt. Butendoor zweigt sich eben vor der Bahn in die Segeberger Straße und die Straße „Zum Stadtwald“. Westlich von Butendoor und Zum Stadtwald ist eine neue Straße, der Strietkamp, entstanden. Sie hat ihren Namen nach dem Gelände, das durch sie erschlossen worden ist, dem Schlachtfeld, plattdeutsch Strietkamp, auf dem im Jahre 1317 Graf Gerhard der Große von Holstein seinen Vetter Adolf von Schauenburg in die Flucht schlug. Eben außerhalb des Bleeck zweigt der Lohstückerweg von Butendoor nach Osten ab. Lohstücke heißen die Äcker und Weiden, zu denen der Weg führt. Der Name läßt darauf schließen, daß die Gegend früher bewaldet gewesen ist, denn Loh heißt Wald.
Vom Bleeck gelangen wir an der Wassermühle vorbei über den die Osterau überbrückenden Mühlensteg zum Schlüskamp. Rechts von ihm lag hinter dem Mühlendamm der große, jetzt teils zugeschlickte, teils zugefahrene Mühlenteich. Eine Schleuse im Damm mit Umlauf führte das überflüssige Teichwasser unterhalb der Mühle der Osterau zu. Nach dieser Schleuse erhielten die benachbarten Ländereien und danach auch die Straße ihren Namen. Der Schlüskamp stößt rechtwinklig auf die Straße „Am Bahnhof“, und hinter dem Bahnhof zieht sich die Straße Achterndieck zum Alten Kurhaus hin. Der Name Achterndieck ist ein Beweis dafür, daß der Mühlenteich, plattdeutsch Möhlendieck, in alten Zeiten eine beträchtliche Ausdehnung gehabt hat.
Die Beeckerbrücke bringt uns vom Bleeck nordwärts in den Kirchenbleeck. Zufällig wohnt nahe an dieser Brücke ein Bäcker, und so erhielt sie im Volksmunde den Namen Bäckerbrücke. Aber die Brücke und auch ihr Name sind sicher viel älter als die Bäckerei. Die Brücke lag, bevor die Chaussee um 1830 gebaut wurde, allerdings etwas weiter stromabwärts. Die Häuserreihe an der Westseite des Kirchenbleeck und auch die Längsrichtung der Schlüterschen Scheune zeigen uns den Weg, den die alte Landstraße nahm, und lassen uns die Lage der alten Beeckerbrücke vermuten. Die Bäckerei kann erst gebaut worden sein, als die Chaussee schon vorhanden war; sie liegt wahrscheinlich mitten auf der alten Landstraße. Die Beeckerbrücke und das vor ihr liegende Beeckertor haben mutmaßlich ihren Namen nach der Straße Maienbeeck erhalten, zu der sie führten, und diese Straße wiederum wurde benannt nach dem kleinen Bächlein, das, von den Koppeln des Maienbaß herunterkommend, die Hauswiese des Bauern Kohfahl durchfließt, die Straße in einem Siel kreuzt und so der Bramau zufließt. Woher hat dieses Wässerlein seinen Namen? Nach einer alten Sage soll der Name auf König Christian IV. zurückzuführen sein. Als dieser an einem schönen Maientage von der Steinburg nach Bramstedt unterwegs war, soll er, bei unserm Bächlein angelangt, das damals noch ungehemmt über den Weg floß, voll Entzücken über das vor ihm sich ausbreitende Landschaftsbild ausgerufen haben: „Welch ein schöner Bach im Maien!“ Eine sehr weit hergeholte und äußerst unwahrscheinliche Erklärung. Eine andere Deutung will den Namen in Verbindung bringen mit den Birken, deren Zweige als Maien bekannt sind. Die Höhen am Maienbeeck seien wohl mit Birken bestanden gewesen. Abgesehen davon, daß auf den Uferhöhen jetzt zur Hauptsache Eichen und Buchen wachsen, die wahrscheinlich auch früher dort den hauptsächlichen Baumbestand ausgemacht haben, wird bei dieser Deutung ganz vergessen, daß unsere Vorfahren nur plattdeutsch sprachen und auf plattdeutsch heißen die Birken bekanntlich Barken. Wie sollten sie dazu gekommen sein, die Birken Maien zu nennen? Mit dieser Deutung war es also auch nichts. Nun gibt es ein Maienhoop bei Hagen und bei Fahrenkrug. Maienmoor bei Bramfeld, Maienborn bei Heidmühlen. Maienbeck bei Bustorf im Kreise Schleswig. An allen diesen Orten findet sich sumpfiges Gelände, und sumpfig sind und waren früher noch viel mehr die Ufer unseres Maienbeeck, so sumpfig, daß das Haus neben dem Bächlein, in dem sich ein Verkaufsladen befindet, auf eingerammten Pfählen gebaut werden mußte. Das Wort Maien ist abzuleiten von einem jetzt nicht mehr gebrauchten Wort, das Kot, Sumpf bedeutet. In einigen Gegenden Nord-Schleswigs nennt man eine niedere Wiese ebenfalls Mai. Der Name des durch den Sumpf fließenden Baches wurde dann übertragen auf die umgebenden Höhen als Maienbeeck, wie auch auf die Straße. Der letztere Teil des Maienbeeck hieß früher Klingberg, wohl entstanden aus Klintberg, d; h. eine stark ansteigende, meistens sandige Höhe, aus dem Klintberg einen Klingberg zu machen, entspricht unserer holsteinischen Art, sich das Sprechen möglichst bequem zu machen. Schade, daß dieser alte Straßenname hat weichen müssen! Hätte man sich nicht lieber den nichtssagenden Namen Schäferberg verschwinden lassen und dafür das Wort Klingberg einsetzen können.
Der Name der rechts vom Maienbeeck sich abzweigenden Straße Maienbaß erklärt sich nach dem Vorhergesagten ohne weiteres. Die Verlängerung des Maienbeeck nach Hitzhusen hinaus ist der Dahlkamp, dessen Name sich wohl aus seiner niedrigen Lage im Vergleich zum Herrenholz erklärt. Die ebenfalls vom Maienbeeck abzweigende Rosenstraße hieß früher Hinter den Höfen. Man hatte vor, diese Bezeichnung in das kürzere und ursprünglich gebräuchliche Achternhöven umzuwandeln. Den Anwohnern gefiel der Name nicht; auf ihren Wunsch wurde er durch Rosenstraße ersetzt. So ist dieses Kuckucksei unter unsere Straßennamen geraten, die sich sonst so einheitlich aus Heimatboden, -art und Volkssprache gebildet haben.
Die nördlichste Straße des Orts heißt „Unter der Lieth“. Sie verläuft, wie schon der Name sagt, am Fuße des Liethbergs. Eine Lieth findet sich auch bei Kellinghusen, bei Krücken, bei Elmshorn. Überall ist es eine aus der Ebene ansteigende Höhe ohne Abfall auf der anderen Seite, also ein Anstieg zu einer Hochebene. Man bringt das Wort in Verbindung mit Lehne. Die untere Ebene ist gleichsam die Sitzfläche eines Stuhles, die ansteigende Höhe die dazugehörige Lehne. Die Straße Unter der Lieth reicht im Westen bis Maienbaß, im Osten geht sie in den Fuhlendorfer Weg über, ein Teilstück der alten Landstraße von Altona-Hamburg nach Norden. Verbindungsstraßen von Unter der Lieth und Rosenstraße sind Zum Liethberg und Gartenweg. Vom Kirchenbleeck zweigt nach Osten der Landweg, dessen Verlängerung die Bimöhler Straße ist, ab. Der Landweg hat wohl seinen Namen danach, daß an ihm viele Landleute wohnten, für die er der Weg zu ihren Ländereien war. Der Kieler Berg hätte nach dem Gelände, das diese Straße durchschneidet, auch wohl Raaberg heißen können, der Berg, auf dem gerodet wurde. An früheren Waldbestand erinnert auch die vom Landweg nordwärts abzweigende Straße Düsternhoop, ursprünglich ein Weg, der durch dichtes Gehölz führte. Neben der Segeberger, der Kieler und der Altonaer Straße haben wir auch eine Glückstädter Straße. Das mag auf den ersten Blick auffällig sein. Was geht uns Glückstadt an, daß eine Straße, die noch nicht einmal direkt dorthin führt, nach dieser Stadt benannt worden ist? Wenn wir aber bedenken, daß Glückstadt, eine Gründung des König-Herzogs Christian IV., von ihm zur Hauptstadt von Holstein bestimmt war, daß er die Stadt zum Sitz des obersten Gerichts und anderer Behörden machte, so werden wir verstehen, daß die Wege nach Glückstadt in ganz Holstein viel benutzt und nach dem Endziel benannt wurden. Der Sommerland-Weg, der von der Glückstädter Straße abzweigt, wurde im Sommer, wenn der Weg über die Hambrücke im Zuge der alten Landstraße allzu sandig war, gern von den Frachtfuhrleuten nach Hamburg und umgekehrt benutzt, weil er alsdann eine festere Fahrbahn bot.
Nun noch einige Fußwege. Der Wiesensteig von der Glückstädter Straße zum Dahlkamp, ein Geschenk der alten Sparkasse, bedarf keiner Erklärung, ebensowenig der vom Schlüskamp zum Alten Kurhaus führende Badesteig. Am Ramakerstieg zwischen Schlüskamp und Landweg wohnte früher ein Rademacher (jetzt Buchdruckerei K. Paustian). Der Junkerstieg vom Lohstückerweg nach der Segeberger Straße heißt so nach der Junkerskoppel, von der er abgetrennt ist, und der Steig Blockshöh vom Kurhaus „An den Auen“ zur Altonaer Straße hat seinen Namen nach der Koppel Blockshöh, an der er in seinem mittleren Teil entlangführt.
K.Soweit also unser unbekannter Schreiber. Einige kurze Anmerkungen aus heutiger Sicht seien noch hinzugefügt.
Die „Mühlenstraße“ und die Straße „An der Mühle“ erinnern heute zumindest daran, daß hier vor nicht allzulanger Zeit eine Mühle gestanden hat; so mögen diese Bezeichnungen im nachhinein ihre Rechtfertigung finden. Die Straße „Zum Stadtwald“ hat mittlerweile ihren Namen wechseln müssen. Sie führt zwar immer noch zum ehemaligen Stadtwald, doch zu Ehren des langjährigen Leiters der Rheumaheilstätte hat man sie in „Oskar-Alexander-Straße“ genannt.
Um gleich in Kurhausnähe zu bleiben: Die „Blockshöhe“ ist aus den Wegenamen unserer Stadt verschwunden, daraus hat man die merkwürdig anmutende Bezeichnung „Verlobungsweg“ gemacht. Ein Kommentar zu dieser Namensgebung seitens des obigen Verfassers wäre sicher interessant.
Indes können wir auch Positives vermelden. Zwar heißt der „Kieler Berg“ immer noch so, und die „Rosenstraße“ ist auch an alter Stelle, aber in Besinnung auf die alten Namen hat man die Stichstraße vom „Kieler Berg“ zum Gelände des Bundesgrenzschutzes „Raaberg“ getauft, und „Hinter den Höfen“ sehen wir in „Achtern Höben“ verwirklicht. Ja, sogar der Name „Klingberg“ wird erhalten bleiben. Ganz in der Nähe des ehemaligen „Klingberg“ trägt die Erschließungsstraße vom „Maienbaß“ Richtung Schäferberg diesen Namen. So konnte diesem Wunsche nach vielen Jahren Rechnung getragen werden, auch wenn die neue Straße in ein Tal führt und keinen Berg ersteigt. Beim „Maienbaß“ nun angelangt, sei noch eine Erläuterung gegeben. Ganz so selbstverständlich wie in obigem Text erscheint die Deutung des Namens nicht. „Maien“ ist erklärt, allein fehlt eine Erklärung für die Silbe „baß“. Unter Baß wird eine Weiden- oder Lindenholzung verstanden, die zum Borkschälen geeignet ist (vgl. auch Bast). Im dänischen Sprachraum heißt „baß“ soviel wie Unterwuchs auf feuchtem Grund. Die an den Maienbaß anschließende Flur trägt den Namen Schalloh, und mit Loh = Wald haben wir die Bestätigung, daß sich hier einst Wald befand.
Noch einen Augenblick wollen wir bei den Straßennamen unseres Ortes verweilen. Leider, muß man wohl sagen, ist das eingetroffen, was August Kühl (?) schon 1938 befürchtet hat. Sämtliche Dichter und Komponisten mußten auch in Bramstedt für Straßenzüge Pate stehen. Und – bedingt durch die Ereignisse des Jahres 1945 – wird die Erinnerung an die Städte und Landschaften in Mittel- und Ostdeutschland in den Seitenwegen der „Glückstädter Straße“ wachgehalten.
Andererseits gibt es gerade in den letzten Jahren eine Rückbesinnung auf die althergebrachten und ortsgebundenen Namen. Mit dem „Stedingweg“ und der „Graf-Stolberg-Straße“ wurden die Namen ehemaliger Gutsbesitzer festgehalten, und der „Königsweg“ erinnert an Christian IV. Den Hof Bramstedt und die dazugehörigen Ländereien haben auch der „Hoffeldweg“ und der „Bissenmoorweg“ ebenso wie „Bissenmoor“ als Bezugspunkt. Bissen heißt auf hochdeutsch Binsen; das Bissenmoor ist also das Moor, in dem Binsen wachsen (zum Binden von Besen). Leider wurde diese Rückbesinnung nicht immer durchgehalten, und so wurde es versäumt, entlang der Holsatenallee die alten Flurnamen in Straßenbezeichnungen aufzunehmen.
Die bis jetzt noch kürzeste Straße in Bramstedt trägt den Namen der hier geborenen ersten Professorin der Archäologie Johanna Mestorf.
Im Norden der Stadt finden wir auf dem Schäferberg eine reine „Buschkolonie“. Ausgelöst durch den „Rugenbusch“ (von rugh = rauh) folgten „Ellernbusch“ (Ellern = Erle), „Eekenbusch“ (Eek = Eiche) und „Fleederbusch“ (Fleeder = Flieder). Weil man die Büsche offensichtlich als sehr angenehm empfand, machte man die Seitenstraße des „Maienbaß“ noch zum „Brambusch“ (Bram = Ginster), mit der Folge, daß Ortsfremde diese Straße meist auf dem Schäferberg suchen.
Es sei noch vermerkt, daß auf alten Flurkarten das Gebiet östlich der heutigen Straße „Schäferberg“ den Namen „Kleine Lieth“ und das Gebiet westlich die Bezeichnung „Große Lieth“ trug. Es waren dies beides Waldgebiete.
Verweilen wir noch einen Augenblick im Norden unserer Rolandstadt. Östlich der Bundesstraße 4 finden wir den „Tegelbarg“, diese Straße hat ihren Namen erhalten, weil auf dem Gelände früher eine Ziegelei stand (vor dem heutigen Bundesgrenzschutzgebäude).
Im First der Maienbeeck-Apotheke fand man einen Ziegel, mit der Inschrift:
„Wenn wir aus Ton und Erde gut
den Ziegel form viel gestalten
So werden durch des Feuers-Glut
im Ofen dauer sie erhalten“
Johann Puls bey Bramstedt d. 3 ten October 1834
Dies läßt keinen Zweifel, daß in Bramstedt schon seit langer Zeit eine Ziegelei bestanden hat. Älteren Bramstedtern werden noch die Ziegeleien am „Düsternhoop“ bzw. „Raaberg/Tegelbarg“ in Erinnerung sein, die kurz nach der Jahrhundertwende verschwanden.
Eine neue Straße entstand ganz in der Nähe. Das Baugebiet „Lehmbarg“ hat seinen Namen nach dem Lehmberg, auf dem es sich befindet. Über den „Lehmbarg“ verläuft der „Großenasper Weg“, er ist Bestandteil des alten Ochsenweges, der, von Großenaspe über Grünplan und Gayen kommend, hier den Höhenzug verließ und in Richtung Landweg fortlief. Bevor die Eisenbahn nach Neumünster gebaut war, führte der Weg vorbei am „Söweneck“ direkt zur „Bimöhler Straße“ und machte nicht den Knick parallel zur Bahnlinie wie heute.
Da wir uns gerade in diesem Raum befinden, sollen auch noch einige Flurnamen erwähnt werden, die sich hier befinden.
Das Stück Land, das sich zwischen der Bahn und der „Bimöhler Straße“ befindet, wurde ehemals als „Kapellenhof“ bezeichnet. An dieser Stelle soll einst eine Kapelle gestanden haben und ist in vorchristlicher Zeit vielleicht ein Friedhof gewesen. Ähnlich ist auch die Bezeichnung „Stüff“ (von Stift?), die nördlich der „Bimöhler Straße“ an der Gemeindegrenze vorgefunden wird. Der „Lehmbarg“ wird früher der manchmal zitierte Galgenberg gewesen sein, auf dem Hinrichtungen stattgefunden haben sollen. Noch 1729 beschworen zwei alte Bramstedter, daß sie „auf dem Wege nach Großenaspe“ einen am Galgen haben hängen sehen.
Aber fort von diesem schwarzen Ort. Wir wenden uns anderen Wiesen und Weiden zu. Bevor der „Düsternhoop“ einen Knick in Richtung „Großenasper Weg“ macht, heißt das Gelände links „Hasloh“ (kommt von Hasel, also Haselwald). Weiter durch den mittlerweile fast zugewachsenen Weg nennt sich die Flur bis zum alten Ochsenweg „Hungerkamp“. Während Kamp = Feld eindeutig ist, läßt „Hunger“ mehrere Deutungen zu. Es kann von Huhn abstammen, kann aber auch vom germanischen Hun kommen. Hun war der Führer einer Dorfgemeinschaft (vgl. auch Hünengrab).
„Düsternhoop“ und „Großenasper Weg“ münden dort ineinander, wo die Koppeln südlich des Weges nach „Gayen“ den Namen „Langer Schlag“ tragen (Schlag ist eine Einteilung der Ackerstücke).
Weiter Richtung „Gayen“. Der Name dieses Stückchen Erde ist bis heute nicht geklärt. Die älteste Erwähnung als „Mönke Gayen“ gibt den Hinweis, daß es früher zu einem Kloster gehört hat (eventuell kommt Gayen von dem lateinischen Namen Gaius). Wir verlassen den Weg jedoch schon vorher und passieren das Roddenmoor an seiner Südseite. Obwohl in alten Urkunden vom „rothen Moor“ die Rede ist und obwohl man Anfang dieses Jahrhunderts bei Abräumarbeiten unter dem Moor eine rote Sandschicht entdeckt hat, geht die bisherige Deutung dieses Namens auf gerodetes Moor hin. Ungeachtet dieser Auslegung, setzen wir unseren Weg fort. Kurz vor dem „Stüff“ biegt der Weg wieder in Richtung Stadt. Das abschüssige Gelände zur „Bimöhler Straße“ hin trägt den Namen „Abarg“ (A heißt „Auf der Höhe“, vgl. auch A-Kathe).
Ein gutes Stück weiter stoßen wir an die Bahnlinie. Folgen wir der Trasse ein Stück Richtung Bramstedt, so sind zur Linken die Weiden der „Krätz“ zu finden. In älteren Schriftstücken ist von „Crutz“ die Rede, so daß man wieder einmal merken kann, daß die Verkoppelung des 18. Jahrhunderts bittere Spuren bei den Flurnamen hinterlassen hat. „Crutz“ kommt von Kreuz und weist entweder auf ein Grabkreuz (in Beziehung zum Kapellenhof?) oder auf eine Wegekreuzung hin (die wir hier aber nicht vorfinden). Vor dem „Vierkantigen Busch“ überspannt eine Brücke das AKN-Tal. Dem heutigen „Husdahl“ (= Tal oder seichte Gegend in Nähe eines Einzelhauses) folgend, kommen wir zur „Bimöhler Straße“ und setzen unseren Gang vorbei am „Rundenkamp“ durch die „Moorstücken“ zur „Brunnenkoppel“ fort. Richtung Bimöhlen finden wir östlich der „Moorstücken“ das „Karkenmoor“ (= Kirchenmoor, evtl. auch karges Moor).
Die Entscheidung, ob wir dem Weg folgen, den einst Gerd Gieseler nach Bimöhlen nahm, und Richtung „Holm“ gehen wollen oder gleich an der „Bomkoppel“ vorbei zum Matthiasbad wandern, müssen wir zugunsten des letzteren Weges treffen. (Holm = Erhebung in der Niederung, Bom = Baum). Denn früher konnte man über die Brücke „Vörn Hölm“ seinen Weg nehmen und dann auf der anderen Auseite zwischen „Blang de Osterau“ (= entlang der Osterau) und „Käthnerkoppeln“ (Käthner = Katenbesitzer) so zurückkehren, daß man über einen Steg wieder zu der Quelle gelangte.
Unser Spaziergang führt entlang den Koppeln „Achtern Moorstücken“ und den von der alten Sparkasse angelegten Waldungen zu den Bädern. Bevor wir jedoch das „alte“ Kurhaus erreichen, biegen wir beim Karpfenteich zum Waldbad hin ab. Die Wiesen der „Bollbrügge“ liegen links und rechts unseres Weges, wenn wir die gleichnamige Brücke über die Osterau überquert haben. Die Bezeichnung weist auf einen durch Pfahlwerk befestigten Weg (oder Gelände) hin. Auf alten Karten kann man sehen, daß einst geplant war, den jetzigen Turnierplatz der Reiter durch eine Aubegradigung auf das andere Ufer zu verlegen. Froh darüber, daß man dies unterlassen hat, gelangen wir zu der Flußbiegung. in der einst ein Steg zu den Badeanstalten Heeschs und Behnckes führte. Durch die Rügerschen Gärten hindurch kommen wir an den Lohstücker Weg. (Den Ihlbeck = Egelbach – wollen wir nicht unerwähnt lassen.) Die gerade verlassenen Anlagen wollen uns heute wieder gut gefallen, und es ist nicht schwer zu glauben, daß sie vor 60 bis 70 Jahren ein Schmuckstück dieser Gegend waren.
Auf beiden Seiten der Bahn finden wir die „Junkerskoppeln“ vor, und über den „Junkersstieg“ durchqueren wir einen Teil der „Lohstücken“ und erreichen die „Vogelstange“ an der Segeberger Straße. Ein Gelände, das auf den gleichen Namen lautet, jedoch im Butendoor auf Höhe der Hausnummern 19 – 21 lag, diente früher als Schießplatz der Vogelschützen und als Übungsort für die Bramstedter Turnerschaft. Die Vogelschützen mußten ihr alljährliches Königsschießen an dieser Stelle aufgeben, als ein Anlieger sich vor gut 65 Jahren über die Gefährdung seiner Angehörigen beschwerte.
Wir gehen ein Stück entlang der Segeberger Chaussee. Bevor der „Siggenweg“ abbiegt, heißt das Gelände Arnschuler, und uns will keine rechte Deutung dieses Namens einfallen. Besser steht es da schon mit den „Siggen“, die auf eine niedrige, sumpfige Wiese hindeuten (die mit Seggen = Riedgras bestanden ist).
Wir wollen uns den langen Weg in Richtung „Klashorn“ (Horn Vorsprung im Gelände, ein zwischen Wald und Wasser eingekeiltes Gelände, „Clas“ 1t. Herrn Finck von „Clawes“ = Klage, „Claasberg“ = Klageberg evtl. Hinrichtungsort) ersparen und die in diesem Bereich auftauchenden Flurnamen nur tabellarisch erfassen:
„Bollenbleek“ = eingefriedigte Koppel (für den Dorfbullen?)
„Schullersreben“ (Schütters Rehm) = reben ist ein längliches, schmales Stück Land; Schütter = Feldhüter, der herumirrendes Vieh zusammentreibt und bis zur Einlösung verwahrt.
„Vörn Reepen“, „Op de Reepen“, „Achtern Reepen“ = Reepen ist ein mit dem Rep = Tau, Meßtau vermessenes Stück Land
„Am Damm“ – bezieht sich auf den Straßendamm
„Ohlen Wischen“ – bedarf nur für den Nichtplattdeutschen der Übersetzung auf alte Wiesen
„Neues Moor“ – haben schon die Verkoppeler verhochdeutscht
„Haarwisch“ = Herrenwiese (?)
„Rühm“ – ist ein freier Platz, ein besonders freies Feld – oft auch erst durch Menschenhand zu einem solchen geworden, rühm = räumen „Schapbrook“ = Schap ist Schaf und Brook ist Bruch, also ein sumpfiges Gehölz, wie wir es an diesem Ort noch heute finden können.
„Tütenbarg“ – wird der Berg der Regenpfeifer = Tüter sein, wenn sein Name nicht völlig verdreht überliefert ist.
„Hohe Moor“ – bedarf keiner Erläuterung.
„Schinder Moor“ – hier werden sich die Leute nicht besonders geschunden haben, sondern eher hat der Name etwas mit dem „Schinder“, dem Abdecker, zu tun. Vielleicht sind hier vor Einrichtung der Abdeckereien verendete Tiere vergraben worden.
„Dewsbeck“ – bek = Bach ist eindeutig; dews wird wohl am ehesten mit deep = tief zu tun haben.
„Wahrensbarg“ – Wodansberg, oder evtl. Wachberg (War = Wache). „Vor dem Hamvie Berg“, „Hamvie Berg“, „Hinterm Hamvie Berg“, „Achtern Hamvie Berg“ – diese Bezeichnungen haben alle mit dem heutigen Weg Hamwinsel zu tun, dem Herr Finck seinen alten Namen zurückgab, als er nachwies, daß das früher gebräuchliche Halfinsel verkehrt ist. „Hamwinsel“ kommt von Ham = Wald und Winsel = Furt durch eine Au oder durch ein sumpfiges Gelände (vgl. auch Winseldorf); Vie = Sumpf, Bruch, feuchtes Land. Jedoch heißt „Viert“ auch nicht urbar gemachtes Heideland an der Gemeindegrenze.
Zur linken Seite des Weges finden wir die „Brookwisch“ (= Bruchwiese) und den „Asbrook“ (As = Feuchtigkeit, Sickerwasser). Bevor die Waldungen den „Hamvie Berg“ erklimmen, nennt sich das Gelände „Butterkamp“, doch hat dies nichts mit dem Brotaufstrich zu tun, sondern ist nur entfernt davon abgeleitet. Unter Butter oder besser Botter versteht man einen gelbfarbigen oder einen besonders guten Boden (oder besonders gute Weiden). Vielleicht sollte man an dieser Stelle des Spazierganges eine Butterstulle zu sich nehmen, denn wir haben noch ein gutes Stück vor uns. Bei der hölzernen Jägerbrücke überqueren wir die Schmalfelder Au. Auaufwärts finden wir bald zur Rechten „Im See“ und erhalten einen Wink auf ehemaliges Aussehen dieser Landschaft. Das vor dem Wahrensberg liegende „Clud Moor“ hat vielleicht mit „Klus“ = Klause, Einsiedlerklause zu tun, doch wollen wir diese Deutung nicht für die letzte Wahrheit nehmen. Durch den Wald gehend, kommen wir an die Verlängerung der heutigen Oskar-Alexander-Straße und zum „Wittrehm“ (rehm = schmaler Streifen Land am Rand einer Hölzung, einer Wiese etc., Witt kann mit weiß übersetzt werden, es hat mit dem in Mooren vorkommenden weißen Wollgras zu tun).
Am Stadtwald entlang passieren wir die Einmündung des „Birkenweges“, dessen Seitenstraßen der „Falkenweg“ und der „Reiherstieg“ sind. Während am „Birkenweg“ tatsächlich Birken stehen, sinnvoller wäre dennoch der Flurname „Achter de Hambrüch“, ist es bei den anderen beiden Straßen schon schwieriger, die Taufpaten heute (wenn sie überhaupt je zu finden waren).
Über die ehemalige „Blockshöh“ geht es zum „Ochsenweg“, der als Teil des uralten gleichnamigen Weges zu Recht so heißt. Vorbei an den „Achter Wischen“, „Chausseekoppeln“ und über die Altonaer Chaussee gelangen wir in den Sommerland und befinden uns nun auf dem ehemaligen Gutsgelände. Diese Gelegenheit wollen wir nutzen, um einige hier vorkommende Flurnamen zu deuten.
„Houdouhlskamp“ – niedrig gelegene Wiese bei einem Haus oder bei der Hude (= Bootsanlegestelle); „Lang Stück“ – langes Stück Land; „Herr-Koppel“ – die Koppel eines Herrn; „Körten Kamp“ -Kurzes Stück Wiese; „Schinckels Wiese“ – die Wiese des Herrn Schinckel (?); „Immenhagen“ – eingefriedigtes Stück zur Bienenhaltung; „Weddelbrook“ – eine Stelle im Bruch, die man durchwaten kann; „Hohns Kamp“ – Hoher Kamp, wird in einer alten Urkunde auch „bawen den Weddelbrook“ genannt; „Rühmeis“ -geräumtes Gebiet; „Comhaers Koppel“ – evtl. Kommissarskoppel (halte ich für wahrscheinlich; der Kirchspielvogt Averhoff trug teilw. die Bezeichnung „Commissarius“); „Im Reh“; „Op’m Barg“ – Auf dem Berg.
Damit wollen wir es belassen und setzen unseren Weg über die Glückstädter Straße durch den „Heckkamp“ (= Hechtwiese) auf dem „Wiesensteig“ fort. Beim „Herrenholz“ (einem ehemaligen (Jutsbestandteil) kommen wir auf den „Dahlkamp“. Ein kleines Stück stadtauswärts führt zwischen den Häusern 13 und 15 ein Weg hinein, der früher durch die Wiesen nach Hitzhusen verlief. Es ist der Rest des „Philosophenganges“, den Gutsbesitzer Prof. Meyer durch die Dahlkampswiesen anlegen ließ und dort täglich einen Spaziergang machte. Der Weg begann am Schloß, überquerte die Bramau und führte zur „Papenkuhl“ (= Pastorenwiese). Vor dieser „Papenkuhl“ liegt eine Wiese, die einst den Namen „Königstafel“ trug. Von dieser geht die Sage, daß dort ein König mit seiner Tafel (- seinen Rittern) versunken sei (durch kriegerische Auseinandersetzungen ?). Der Weg endete übrigens in einem Stück Erde mit der Bezeichnung „Kümmerken“ (- kümmert keinen), und damit wollen auch wir es belassen.
Soweit also unsere Flur- und Straßennamen. Es waren nicht alle, um Kritiker gleich zu beruhigen. Es mag an anderer Stelle zu anderer Zeit mehr über nicht erwähnte Namen geschrieben werden.
Bramstedts Aufbruch
ins 20. Jahrhundert
Zum Abschluß dieses Buches soll versucht werden, die Zeit, aus der die meisten der veröffentlichten Aufnahmen stammen, ein wenig auch in Worten zu beschreiben. Absichtlich ist in dieser Einleitung von einem „Versuch“ die Rede, denn die Zeit zwischen jenen Ereignissen und heute ist lang, so daß man nur in geringem Maße auf Augenzeugen zurückgreifen kann. Wir haben in Bramstedt kaum Einwohner, die zu jener Zeit in „voller Blüte ihres Lebens“ gestanden haben, daher sind die folgenden Zeilen hauptsächlich auf die Notizen gestützt, die in den „Bramstedter Nachrichten“ um die Jahrhundertwende unter der Rubrik „Lokales und Provinzielles“ zu finden waren.
Mein Blättern in den Zeitungen begann – mehr oder weniger willkürlich – mit dem Jahrgang 1895 und langte bis zum Jahre 1914, wobei leider die Jahrgänge 1900 und 1901 nicht zur Verfügung standen.
1895 wählte ich, weil aus diesem Jahre mit Sicherheit die ersten Fotografien stammen, die ich datieren wollte; und 1914 bildet den Schlußpunkt der Friedenszeit für das Deutsche Reich einerseits und eine Verringerung der vorliegenden Fotos andererseits.
Wenn man mit dem Jahre 1895 anfangen will, so muß man natürlich eine kleine Situationsbeschreibung jener Tage voranstellen.
Das damalige Bramstedt war eigentlich nicht viel mehr als ein größerer Ort in der Provinz. Rund 2.000 Einwohner lebten in den Grenzen der Stadt, damit hatte sich die Zahl gegenüber 1800 mehr als verdoppelt; wobei man hinzufügen muß, daß der Gutshof erst 1874 politisch vom Flecken einverleibt wurde und bei den Zählungen früherer Tage nur die Fleckensinsassen maßgebend waren.
Doch die Gutszeiten waren in Bramstedt vorbei. Auf Schloß und Mühle saßen seit einigen Jahrzehnten die Mitglieder der bürgerlichen Familie Paustian, und die ehemals gutszugehörigen Gemeinden hatten ihre Eigenständigkeit. Die Bewohner des Rolandstädtchens verdienten ihr Brot hauptsächlich mit der Landwirtschaft, und von Industrie war nur der erste Hauch durch zwei Wattefabriken und die Wurstfabrik von Julius Wilckens am Kirchenbleeck zu spüren. Wenn von Landwirtschaft die Rede ist, muß natürlich auch gesagt werden, daß sehr viele Bramstedter Bürger nicht nur einen Beruf hatten. Zum einen waren sie „Landmann“, zum anderen Gastwirt, Händler oder Handwerker. Nur wenige gab es, die allein einem Berufszweig zugerechnet werden konnten. Doch sollte sich dies, wie noch berichtet wird, zügig ändern; es begann die Zeit der Parzellierungen. Nicht unerwähnt darf bleiben, daß Bramstedts Ruf als Kurort in jenen Tagen gelegt wurde. Zimmermeister Heeschs beherzter Anfang mit dem Matthiasbad sorgte für den Zustrom vieler „Sommerfrischler“, wobei die Betonung auf Sommer zu legen ist, denn nur in der Zeit von Mai bis September war das „Matthiasbad“ geöffnet. Die Gast- und Logierhäuser, Herbergen und Cafes profitierten von dem Badeverkehr,
und so entstand gleichsam ein eigener (neuer) Wirtschaftszweig. Sicher war Bramstedt schon seit sehr langer Zeit ein beliebter Aufenthaltsort für Reisende von Nord nach Süd und von Ost nach West, doch nun kamen Gäste, die einen längeren Aufenthalt nahmen.
„Wer bestimmte die Geschicke unseres Heimatortes?“ wird man sich sicher fragen. Nun, ähnlich den stabilen Verhältnissen im Reich seit dem Krieg 1870/71 und der Reichsgründung, hatte auch Bramstedt seine feste Ordnung. Seit 1879 war Gottlieb Carl Christian Freudenthal Bürgermeister des Fleckens, und er sollte es auch noch bis 1909 bleiben. Sein Vorgänger im Amt als erster Bürgermeister nach der preußischen Städteordnung von 1869 war Johannes Schümann gewesen, der Wirt des Holsteinischen Hauses. Neben dem 1848 geborenen Freudenthal standen zwei Ratmänner und acht Fleckensverordnete in der politischen Arbeit.
Gottlieb Freudenthal setzte sich energisch für die Fortentwicklung seines Geburtsortes ein. Der gelernte Goldarbeiter hatte neben vielen anderen Dingen bis 1895 das Ödland hinter der Hambrücke für nur fünf Mark vom Staat gekauft und aufforsten lassen, und er hatte den Wiesensteig als Verbindung durch das ehemalige Gutgelände geschaffen. Von diesem Ereignis erzählt man sich, daß er zur Anlegung dieses Weges zwei „Wiesenfachleute“ habe kommen lassen. Als Freudenthal am Morgen mit den Ausmessungen beginnen wollte, fand er seine Fachmänner mit leicht vernebeltem Blick vor. Kurzentschlossen jagte er sie davon und machte sich selbst ans Werk; wie man noch heute sehen kann, mit glücklicher Hand.
Es würde den Rahmen sprengen, mehr solcher Anekdoten hier zum Besten zu bringen, ebenso wie eine Aufzählung Freudenthals zahlreicher anderer Posten in Verbänden, Vereinen und Institutionen zu weit gehen würde; – indes darf eines auf keinen Fall unterschlagen werden: Gottlieb Freudenthal stellte mit einer Amtszeit von 30 Jahren als Bürgermeister schon einen Lokalrekord auf, gänzlich unerreicht ist er mit seiner 40jährigen Tätigkeit als Wehrführer der Bramstedter Freiwilligen Feuerwehr. Von der Gründung Mitte 1878 bis nach dem 1. Weltkrieg hatte er ununterbrochen diese Position inne.
Mit der Feuerwehr haben wir den Übergang vom politischen Leben in das zivile gefunden. Zahlreiche Vereine gab es in Bramstedt: Einen Frauenverein von 1893, der sich vorwiegend um soziale Belange kümmerte; einen Schützenverein von 1891; einen Radfahrverein von 1893; einen Kriegerverein von 1884, der seinem Namen mit „guter deutscher Gesinnung“ alle Ehre machte. Die Bramstedter Turnerschaft ist 1884 (neu-) gegründet worden und sorgte für die sportliche Ertüchtigung. Daneben gab es aus alter Zeit zahlreiche Gilden, die ursprünglich meist den Charakter einer Hilfs- und Versicherungsorganisation hatten. Die Fleckensgilde, die Pferdegilde und die Pfannen- und Mobiliengilde seien nur beispielhaft herausgegriffen. Letztere sorgte durch ihre Bestimmungen zum Feuerschutz der ihr angehörigen Hausbesitzer dafür, daß nach und nach die Strohdächer in Bramstedt verschwanden (nur mit Pfannen gedeckte Häuser fanden Aufnahme).
Zum Abrunden des Bildes 1895 noch einige Worte zum Aussehen des Ortes. Bramstedt erstreckte sich im wesentlichen auf den Bleeck und Kirchenbleeck und entlang der Ausfallstraßen (Maienbeeck, Landweg, z. T. Butendoor, Altonaer Straße). Nur wenige Häuser waren mehr als einstöckig mit aufgesetztem Dach, und noch befanden sich viele Landmannstellen im Orte.
Im Jahr des Beginns dieser Betrachtungen erhält der Kirchenbleeck gegenüber der Kirche sein heutiges weitflächiges Aussehen. Bis zu diesem Jahr stand auf dem Grundstück Maienbeeck 1 (heute Amtsgericht) das Haus des Landmanns Wrage; jedoch nicht in der Bauflucht der anderen Häuser, sondern vorgezogen (bis etwa auf Höhe der heute stehenden Normaluhr). Die Fleckenssparkasse kauft dieses Haus, und es wird am 5. Juni abgebrochen. Drei Jahre später erwirbt Kaufmann W. Bracker das Grundstück und errichtet das jetzt noch stehende Gebäude. Sein ehemaliges Haus, Kirchenbleeck 7, verkauft er an den Barbier und Zahntechniker Rottgardt (vorher Im Winkel), der jedoch verstirbt, so daß Friseur Hermann Gau der neue Eigentümer wird.
Mit dem Bau des Brackerschen Hauses verändert sich der Maienbeeck immer mehr. Waren bislang fast nur eingeschossige Häuser zu sehen, so wuchsen vor der Jahrhundertwende die Häuser des Gärtners Kruse (Maienbeeck 18), des Schlossermeisters Hingst (Nr. 16) und das Haus des Kaufmanns Reimers (Nr. 10, heute Fa. Haack) mehrstöckig aus dem Boden, z. T. als Vorbau auf alten Mauern, z. T. völlig neu. Im Jahre 1900 kam noch als vielbewunderter Neubau das Haus Nr. 39 (heute Fa. Schnoor) hinzu. Gebaut wurde es vom Kaufmann Homfeldt aus Ottensen, der vom Gärtner Kohfahl zwei Katen, die sich an dieser Stelle befanden, erworben hatte. (Julius Schnoor kaufte 1912 dieses Haus).
Aber noch einmal zurück zum Jahr 1895. Größtes Ereignis für den Ort war zweifellos die Errichtung des Ehrenmals für die 1870/71 Gefallenen. Am Tage vor der Sedanfeier (2. Sept.) wurde der Stein gesetzt, und am nächsten Tage fand ein Umzug mit acht geschmückten Wagen durch den Ort statt. Wie die Bramstedter Nachrichten vermelden, wurde von dem Wagen der Turnerschaft eine „fotografische Aufnahme“ gemacht. Nachdem man das Denkmal nahe der Friedenseiche gesetzt hatte, konnte man ruhig ins neue Jahr blicken. Dieses brachte für Bramstedt weit wichtigere Entscheidungen. Die Verlängerung der AKN von Kaltenkirchen bis Bramstedt wurde von der Aktionärsversammlung im Januar beschlossen. Damit war Bramstedt näher an Hamburg und den Rest der Welt gerückt. Der unermüdliche Einsatz Bürgermeister Freudenthals für diese Planung hatte sich nach langen Jahren ausgezahlt. Die formelle Genehmigung durch den Landesherrn folgte eineinhalb Jahre später.
Aber nicht nur verkehrstechnisch erhielt man bessere Verbindungen. Die Post (damals noch Bleeck 28, neben dem Kaisersaal) eröffnete die Möglichkeit, vom Postamt aus zu telefonieren. Mit Voranmeldung an die Zielorte geschah dies, damit der Teilnehmer durch einen Boten zur gewünschten Zeit auf das dortige Amt geholt werden konnte.
Das Jahr 1897 brachte nicht viel Neues für die Bramstedter. Der Kriegerverein, der Schützenverein und die Gilden hielten ihre alljährlichen Feste. Am 27. Januar wurde Kaisers Geburtstag kräftig gefeiert, am 24. März der Jahrestag der schleswig-holsteinischen Erhebung und am 2. September der Sedantag. In diesem Jahr baute der aus Hamburg kommende Kunstmaler und Fotograf Struve sein Haus am Anfang der Rosenstraße. Der neuangesiedelte Künstler hatte im kommenden Jahr auch gleich gute Gelegenheit, Bilder zu fertigen. Mitte März pflanzten die Bramstedter zum 50. Jahrestag der Erhebung das Sinnbild der Einheit Schleswig und Holsteins, eine Doppeleiche, auf dem Bleeck. Dies wurde gefeiert mit einem Festumzug und mit Reden am Rolandstandbild. Gab es zu diesem Zeitpunkt schon viele Bilder zu machen, so war Bramstedts großes Ereignis erst im August gekommen: Am 20. des Monats lief um 9.58 Uhr der erste Zug in den Bramstedter Bahnhof ein. So hatte der Ort endlich seine Südverbindung. Von Ost nach West wurde der Verkehr mit Pferdeomnibussen betrieben. Gastwirt Fuhlendorf sorgte für den Personenverkehr und Gastwirt Hese-beck für die Postbeförderung zur Eisenbahnlinie nach Wrist.
Aber auch im innerörtlichen Verkehr strebte man Verbesserungen an, der Landweg sollte im hinteren Teil gepflastert und mit Klinkertrottoirs versehen werden. Die Außermtorbrücke wurde verbreitert. Ja – selbst die Post sorgte für neue Möglichkeiten. Die ersten Privatanschlüsse wurden gelegt. Am 9.9.1899 melden die Bramstedter Nachrichten, daß sich drei Geschäftsleute mit Telefonen versorgen lassen.
Die Bramstedter Turnerschaft läßt sich in diesem Jahr sehr viel einfallen, um ihre Idee von einer eigenen Turnhalle Wirklichkeit werden zu lassen. Die Sportler konnten zwar sommertags auf der Vogelstange üben, doch im Winter waren sie entweder auf den Schuppen bei der Schule angewiesen, der jedoch oft mit Torf gefüllt war, oder sie mußten in die Gastwirtschaft des Herrn Hesebeck ausweichen, wo ihnen Bälle und Veranstaltungen ins Gehege kamen. So war es kein Wunder, daß man vom eigenen Haus träumte. Am Anfang standen Sammlungen, und Ziegelsteine wurden für den guten Zweck verkauft.
In diesem Jahr entwarf Fotograf Struve eine Postkarte, die von der Druckerei Paustian aufgelegt wurde. Der Erlös sollte dem Baufonds der BT zugute kommen.
So gehen die Jahre ins Land, und Bramstedt verändert allmählich sein Aussehen. 1902 beschließt man Straßenschilder anzubringen, um gerade den Auswärtigen eine bessere Orientierung zu geben. Viele Geschäfte wechseln ihre Besitzer, ebenso wie Grundstücke von einer Hand in die andere gehen. Es würde zu weit gehen, dieses im einzelnen hier aufzuführen. Soweit es der Raum zuließ, wurden bei den Bildern in diesem Buch entsprechende Anmerkungen gemacht.
Trotzdem soll erwähnt werden, daß das Gut Bramstedt Ende 1902 von N. F. Paustian an den Bergwerksdirektor Schrader verkauft wurde, der dieses wiederum ein halbes Jahr später an die Itzehoer Makler Junge und Springer weiterveräußerte. Danach wurde das Gut aufgeteilt, und von nun an stand auch einer Besiedlung entlang des Dahlkamps und der Glückstädter Straße nichts mehr im Wege (sofern man ein Grundstück dort erwerben konnte). Während an den Ausfallstraßen meist eingeschossig gebaut wurde, bestand im Zentrum der Trend zu höherer Bauweise, doch noch hatten nicht die Jahre begonnen, in denen quasi ein Haus nach dem anderen in die Höhe wuchs. Die Kirche tat 1903 etwas für die Orientierung der Bürger und ließ im September eine neue Uhr in den Turm einsetzen.
Die Zeichen der Zeit zeigten nunmehr auch in Bramstedt auf ein leicht verändertes Bewußtsein, man wollte sich außerhalb des Fleckenverordnetenkollegiums politisch engagieren. Mag es an der letzten Reichstagswahl, bei der der SPD-Politiker v. Elm zum dritten Male im hiesigen Wahlkreis gewählt wurde, oder mag es an dem liberalen und fortschrittlichen Geist einiger Bramstedter gelegen haben: Im März 1904 wurde ein Bürgerverein für Bramstedt gegründet, der sich für kommunalpolitische Belange interessieren sollte. Vorsitzender wurde der Arzt Dr. Wulf, sein Stellvertreter der Postsekretär Weirup, Schriftführer Organist August Kühl und Beisitzer Fotograf Struve sowie Hauptlehrer Rohwedder. Sogleich wurden mehrere Ausschüsse ins Leben gerufen, die sich mit Einzelthemen näher befassen sollten.
Allmählich kam Leben in die Stadt. Verein für Verein entstand neu. Es wurde wieder ein neuer Radfahrverein gegründet, nachdem der alte offensichtlich eingegangen war, und der Herbergsverein, der kurz vor der Jahrhundertwende gegründet wurde, suchte immer noch nach einem Haus, in dem umherziehende Gesellen Unterkunft finden konnten. Im Juli 1904 feierten die Bramstedter Nachrichten ihr 25jähriges Bestehen. Doch nicht nur die Zeitung sorgte für die Information der Bürger. Damit jedermann mehr erfahren konnte, wurde auf Initiative des Bürgervereins eine Volksbibliothek ins Leben gerufen, die im September schon 278 Bände aufweisen konnte.
So bekommt Bramstedt mehr städtischen Charakter. Und während man 1905 noch den prachtvollen Bau des Bahnhofshotels des Herrn Fülscher bewundert, erfaßt ein neuer Gedanke die Köpfe: Die Elektrizität soll Einzug halten. Die Fleckensverordneten wollen sich anderenorts informieren und halten im Ort eine Umfrage, wer sich alles anschließen lassen will. Die Bemühungen führen zum Erfolg, ein Grundstück am Mühlenteich wird erworben, und mit den Bauarbeiten kann begonnen werden. Auch die Industrie nimmt ihren Anfang: Schlachtermeister Otto Wilckens will im Schlüskamp eine Großschlachterei bauen und Schlachter Johann Schnoor im Bleeck ebenfalls.
Weitreichendere Pläne für die Ortsentwicklung werden intensiv verfolgt. Am 19.3.05 wird ein Krankenhausverein gegründet, dessen Name schon seine Zielsetzung ausdrückt. Vorsitzender wird der Amtsrichter Gravenhorst und sein Stellvertreter wird Dr. Wulf. Debattiert werden die Fortführung der AKN nach Neumünster und der Bau einer Kleinbahn von Segeberg (oder Oldesloe) nach Wrist.
1906 ist das Jahr, in dem E-Werk und Schlachterei Wilckens eröffnet werden. Am 23.9.06 um 19.30 Uhr betätigt die Tochter des Bürgermeisters, Elise Freudenthal, den Schalthebel, und zum ersten Male gibt es in Bramstedt elektrisches Licht. Nur drei Tage später wird ein 1600 Pfund schwerer Bulle durch die Straßen zur Schlachterei im Schlüskamp gebracht, um den Betrieb dort aufzunehmen.
Für die Bramstedter Turner ist dieses Jahr ein gewaltiger Sprung nach vorn: Der Kaufmann Heinrich Fülscher, der kurze Zeit in Bramstedt ansässig geworden war, schenkt einen Teil seiner Bahnhofskoppel der BT, wenn sie dort eine Sporthalle errichten will. Die Turner willigen ein und lassen ihren Verein ins Register aufnehmen, um Eigentümer werden zu können. Auch sonst geschieht etwas bei den Turnern. War bis jetzt nur den Männern der Sport ermöglicht worden, so kommt am 27.5.06 auf der Vogelstange zum ersten Mal eine Mädchenriege zusammen, die keine drei Monate später, am 5.8.06, ihr erstes Schauturnen absolviert.
Damit die elektrisch beleuchteten Straßen auch bei Tage gut aussehen, werden weitere Pflasterarbeiten „Hinter den Höfen“ und am Klingberg vorgenommen. Ja – und weil die Straßen besser werden, kommt auch das erste Auto in Besitz eines Bramstedters. Der Rechtsanwalt Dr. Schumann ist der stolze Kraftfahrer, wie die Bramstedter Nachrichten am 12. Mai 06 zu vermelden haben. Wo wir nun gerade bei der Lokalzeitung angelangt sind: Seit dem 1.1.06 erscheint sie statt zwei- jetzt dreimal in der Woche; und das zu alten Abonnementpreisen.
Im gleichen Jahr kauft Dr. Schumann das Haus des ehemaligen Ziegeleibesitzers Awe (heutiges Krankenhaus) für stolze 21.000 Mark.
Die Bautätigkeit in Bramstedt ist weiter sehr rege. Gastwirt Schlüter baut seine Gastwirtschaft aus (später „Rolands-Eck“), und die Stadt will am Schulhaus Klassenräume errichten. Die Post, die nun seit einigen Jahren neben dem „Hotel Stadt Hamburg“ unter-gebracht ist, kann über Kundschaft nicht klagen. 46 Telefonanschlüsse sind bis Mitte des Jahres verlegt, davon allein 32 in Bramstedt.
Das Jahr 1907 kann man als „Jahr der Prachtbauten“ bezeichnen. Auf Bissenmoor hat der Besitzer Breckwoldt ein Herrenhaus vor das alte Haus gesetzt, der Privatier Mehrens baut eine Villa an der Beeckerbrücke (ehemalige Sparkasse), Kaufmann Schröder errichtet ein Wohn- und Geschäftshaus im Landweg (heute Köhnke) und Maurermeister Krumlinde setzt ein Gebäude an die Bimöhler Straße nahe dem Bahnhof. Zimmermeister Thode, der kräftig im Bramstedter Baugeschäft mitmischt, verkauft ein neuerbautes Haus im Landweg (Nr. 55) an einen Herrn Wichmann, der dort ein Cafe mit angeschlossener Bäckerei und Konditorei eröffnet. Kaufmann Nicolaus Specht muß sein neues Haus am Dahlkamp (heute Jarren) gleich wieder versteigern lassen, um zu Geld zu kommen.
Um noch einen Augenblick bei den Häusern zu bleiben, greifen wir in der Zeit ein wenig vor. Ein Jahr später, 1908, baut Zimmermeister Thode im Landweg 57, und Lehrer Saggau setzt sein Haus neben das Krumlindesche. Auf der anderen Seite der Bimöhler Straße wird das spätere Wohnhaus der Familie Dehn in diesem Jahr errichtet. Schließlich ist auch Textilkaufmann J. B. Paulsen mit von der Partie. Auf dem Boden des ehemaligen Altenteilhauses des Landwirtes Runge schafft er ein Wohn- und Geschäftsgebäude, das mit seiner Giebelform an das Schrödersche und Krumlindesche Haus erinnert.
Doch zurück von dieser – mangels Daten – unvollständigen Aufzählung zum Jahre 1907. Hier tut sich für die Turner wieder etwas. Sie stocken ihren Baufonds durch eine Anleihe auf und erhalten viele Spenden aus der Bevölkerung (u. a. gibt Hofbesitzer Breckwoldt 5.000 Ziegelsteine hinzu). Politisch gerät der Wahlkreis etwas ins Wanken. Zum ersten Mal seit 13 Jahren verlieren die Sozialdemokraten den Bezirk, und der Freisinnige Carstens zieht in den Reichstag ein (mit wohlwollendem Beifall der Heimatzeitung). Diese Wendung schien der Mehrheit der Bramstedter Bürger nicht unlieb zu sein, und so war denn auch kein Bruch im Elan, Neues zu schaffen, festzustellen. Pastor Hümpel setzt sich in einer Rede am 17.11.07 energisch für die Schaffung einer höheren Schule in Bramstedt ein, und keine drei Wochen später wird ein Verein zur Förderung einer Privatschule ins Auge gefaßt, der abermals drei Monate später am 2.2.08 gegründet wird. Die Angelegenheit geht zügig weiter: Ende Februar werden im Hause des Tischlermeisters Graf im Landweg Räume in der ersten Etage angemietet, und schon am 1.5.08 sitzen Schüler auf den Bänken.
Während die Privatschule in kleinem Rahmen ihre Eröffnung feierte, machte der Turnverein aus der Einweihung seiner Turnhalle am 23.8.08 ein zünftiges Fest. Vereine aus dem ganzen Turngau waren eingetroffen und mit Ehrenpforten empfangen worden. Bramstedt war festlich geschmückt, und Gäste wie Gastgeber zogen in einem Umzug durch die Straßen. Eine Woche später war denn auch das Angebot der BT komplett. An diesem Tage kamen die ersten Bramstedter Frauen zusammen, um sich im Sinne von Turnvater Jahn unter der Anleitung von Turnwart Max Kühn zu trainieren.
Aber nicht ungetrübt sollte dieses Jahr vorübergehen. Ende Oktober 1908 teilt Bürgermeister Freudenthal dem Fleckens-verordnetenkollegium mit, daß er zum 1.10.09 aus seinem Amt ausscheiden möchte, nachdem er dann 30 Jahre seines Amtes gewaltet habe. Die Fleckensverordneten akzeptieren seine Entscheidung mit Bedauern.
Gottlieb Freudenthal blieb auf anderen Ebenen weiter aktiv, schon wenige Wochen später beging die Feuerwehr ihr 30jähriges Stiftungsfest, und er war einer von zwölfen, die von Anfang an dabei gewesen waren (neben: Suhl, Krumlinde, Schmidt, Knobbe, Delfs, Reimers, Behlau, Krüger, Göttsche, Hauschildt und Danielsen).
So ging es ins neue Jahr und dies brachte in seiner Mitte einen kleinen Skandal: Der Gerichtsvollzieher war plötzlich spurlos mit „etwas“ Geld verschwunden und man mußte diesen nun mit einem Haftbefehl suchen. Doch die Gemüter beruhigten sich bald, gab es doch außer den alljährlichen Festen einige extra zu feiern. Die Turnerschaft war am 9. Juli 25 Jahre alt geworden, und aus diesem Grunde gab es ein Stiftungsfest. Der Krankenhausverein wollte seinen Fonds aufbessern und gab seine 3. Wohltätigkeitsveranstaltung. Diese war bestens ausgestattet: Dr. Wulf hielt ein Referat, und anschließend konnte man sich an einem Verwandlungskünstler erquicken. Ein Tanzreigen von acht Damen unter dem Titel „Tulpenmädchen aus Haarlem“ bildete die Fortsetzung. Als Höhepunkt des Abends wurde August Kühls Stück „Edelmann un Buern“ in einer Inszenierung von Julius Struve erstaufgeführt. Damit die Feierei kein Ende nehme, gab’s noch ein Fest zum 25jäh-rigen Bestehen der AKN.
Mittlerweile war auch ein neuer Bürgermeister gewählt worden. Er hieß Rhode und war bislang Stadtsekretär in Herdecke gewesen.
Noch kurz vor Jahresschluß unternahmen die Mitglieder des Kriegervereins am 27.12.09 den ersten Spatenstich für die Errichtung eines Schießstandes für „kriegsmäßiges Schießen“ (wie es wörtlich heißt) auf dem Schäferberg.
Gleich im neuen Jahr kann Bürgermeister Rhode eine Einweihung vornehmen: Mit dem 1.1. ist eine kommunale Sparkasse gegründet worden, deren Erträge dem Flecken zugute kommen sollen. Die erste Geschäftsstelle befindet sich im Hause des Kaufmanns Oertling am Kirchenbleeck (heute Schuhhaus Wagner). Das Baugewerbe kann sich in diesem Jahr wie in den vorhergehenden nicht über Mangel an Arbeit beschweren. Witwe Lembke baut eine Villa am Bleeck (heute Jensen), und der Kriegerverein errichtet eine Schießhalle, deren feierliche Einweihung am 1. Mai 10 stattfand. Vorsitzender Struve hält eine Rede, und Bürgermeister Rhode versenkt eine Kapsel mit der Stiftungsurkunde unter dem Eingang der Halle. Anschließend wurde in einem Festzelt „im Schütze der Anlagen“ gefeiert.
Natürlich gibt es auch bei den anderen Vereinen Veränderungen. Neuer Vorsitzender des Bürgervereins wird Organist Kühl, der bei der Turnerschaft in diesem Jahr sein 25jähriges Jubiläum als Vorsitzender begehen kann. Ein Gartenbauverein und ein Gemeinschaftsverein sind mittlerweile am Leben in der Stadt beteiligt.
Unter Bürgermeister Rhode werden seitens der Stadt viele neue Ideen entwickelt. Er plant, den Straßenzug vom Hotel „Stadt Hamburg“ bis zur Villa Liethberg durchzuführen, und zu diesem Zwecke soll mit Steckmest, Wesselmann und Sieck verhandelt werden, deren Häuser von dieser Planung betroffen wären. Als Abzweigung von diesem Straßenzug soll unter der Lieth eine neue Straße angelegt werden. Die Wattefabrik ist für diese Planung schon von der Stadt angekauft worden, und die „Bramstedter Nachrichten“ meinen, daß die Villa der richtige Residenzort für den Bürgermeister sei.
Interessant auch in unserer Zeit ist die Art und Weise, daß man die gesamten Maßnahmen mit einer Art Wertzuwachssteuer für die betroffenen Grundstücke finanzieren wollte (heute nennt man das Planungswertzuwachssteuer). Die Verschönerung des Ortes liegt den Stadtvätern und dem Bürgerverein mittlerweile besonders am Herzen. Das Gelände beim Bahnhof soll eingefriedigt und mit Bäumen bepflanzt werden, hinter der Villa Liethberg legt man einen Ruheplatz an, die Dreiertwiete wird teilweise gepflastert, und die Straße zur Hudau soll beiderseits mit Gärten versehen werden.
Im November hat der Ort, der mittlerweile über 2.600 Einwohner zählt, seine Luftsensation. Zum ersten Male überquert ein Luftschiff die Stadt! Viele stehen auf den Straßen, um sich dieses Schauspiel nicht entgehen zu lassen.
So verstreicht das erste Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts, und Bramstedt hat nun schon fast städtischen Charakter. Indes bleibt das „Leben“ eher auf die Sommermonate beschränkt, denn nur in dieser Zeit kommen Kurgäste in stattlicher Anzahl. So sind die Theater- und Konzertveranstaltungen insbesondere in diese Zeit zusammengedrängt.
Das soll sich nun ändern: Landmann Behncke, der bisher eine Landwirtschaft und ein Pensionat am Schäferberg betrieben hatte, erwirbt zu Jahresbeginn eine Koppel direkt am Matthiasbad und läßt dort Bohrungen vornehmen, die schon bald zum Erfolg führen. Es wundert keinen, daß er ein großes Pensionat an dieser Stelle bauen läßt.
Solche Aktivitäten lassen die Konkurrenz nicht schlafen: Die Familie Heesch beschließt ihr Badehaus aufzustocken, eine Veranda vor ihr Wohnhaus zu setzen und in einer Wiese einen großen Teich ausheben zu lassen. Noch rechtzeitig zum Beginn der Saison sind beide Bäder mit den Arbeiten fertig, und so erhält das Kuren ein neues Gesicht. Ja – Herr Behncke hält sein Haus sogar den Winter über an zwei Tagen in der Woche geöffnet.
Um das ganze Bild abzurunden, läßt die Stadt sich nicht erst nötigen und gibt Geld für einen Verbindungsweg von der Segeberger Chaussee zum Stadtwald, desgleichen erlaubt sie den Anliegern der Bleeckostseite, Vorgärten auf städtischem Grund und Boden anzulegen.
Das Vereinsleben wird durch einen (wieder-) gegründeten Radfahrerverein und durch den neugegründeten Schützenverein „Roland“ belebt. Letzterer führt in seinen Reihen, im Gegensatz zu dem vorher existierenden, die Uniformpflicht ein und will mit dem Kriegerverein verhandeln, um die Benutzung des Schießstandes bei den Anlagen zu erreichen.
Auch im politischen Leben der Stadt bewegt sich etwas: Bei der Ratmann- und nunmehr Stadtverordnetenwahl (seit 12. März 10 darf sich Bad Bramstedt so nennen) tritt zum ersten Male der Peitschenmacher Schrader als Kandidat der Sozialdemokraten auf und erhält 31 Stimmen, ohne eine Chance zu haben, gewählt zu werden.
Bramstedts Entwicklung zur Stadt läßt sich in diesen Tagen ferner an dem Verschwinden der meisten Bauernstellen in den Straßen Bleeck, Kirchenbleeck, Maienbeeck und Landweg ablesen. Als einer der Letzten verkauft der ehemalige Ziegeleibesitzer Julius Lamaack sein Haus im Landweg an Frau Wilhelmi, die dort im folgenden Jahr ein Wohnhaus erbaut (Landweg 10).
Eisig begann das nächste Jahr für die Bramstedter. Am 3. Februar 12 zeigte das Thermometer morgens noch knapp 29° C unter Null an. Wenige Tage später wird es aber schon wärmer, und die Wärme läßt neue Ideen sprießen. Es wird ein Lokal-Ziegenzuchtverein gegründet, und einige Bramstedter wollen sich zu einem liberalen Verein zusammenschließen. Die formelle Gründung findet am 25. Februar 1912 statt: Vorsitzender wird Schlachtereibesitzer Otto Wilckens, Schriftführer Julius Schnoor und Kassenwart J. Lütgens.
Neubauten machen in Bramstedt von sich reden. Der Verein für die Höhere Privatschule hat von Zimmermeister Thode einen Bauplatz am Bahnhof gekauft. Der Bau nähert sich schnell seiner Vollendung, und bereits am 17.4.12 kann die Einweihung stattfinden. Die Kirche baut in diesem Jahr an ihrem neuen Gemeindehaus, die Einweihung findet jedoch erst am 24.8.13 statt.
Im Jahre 1912 eröffnet Schuhmacher Hartkopf sein Geschäft in seinem Neubau im Landweg, und die AKN stellt ihren Lokomotivschuppen am Bahnhof fertig.
Wenden wir uns jetzt dem Vereinsleben zu. Bramstedts Wirte sehen sich offensichtlich einem zunehmenden Einfluß der Guttempler ausgesetzt, und sie gründen am 13. April einen Wirteverein zur – so wörtlich – „Bekämpfung der Auswüchse im Guttemplerwesen“.
Im Bürgerverein gibt es heftige Auseinandersetzungen um die Zielsetzung des Vereins. Nachdem mit der Gründung eines Verkehrsvereins gedroht wurde, ändert der Bürgerverein seine Statuten und will sich künftig mehr um den Fremdenverkehr kümmern (dies ist also mehr oder weniger die Geburtsstunde unseres heutigen Bürger- und Verkehrsvereins). Ein erster Schritt in diese Richtung wird unternommen, als man sich für eine Verbindung des Lohstücker Weges mit der Segeberger Straße einsetzt. Die Stadt stimmt diesem Plan im Sommer zu und stellt Mittel dafür bereit.
Bevor wir die Vereine verlassen, soll der Turnverein noch erwähnt werden. Ihm spendet der Maler Struve ein lebensgroßes Portrait des am 1.11.11 verstorbenen, langjährigen Turnwartes Max Kühn; das Bild findet seinen Platz in der Sporthalle.
Bramstedts Stadtväter stoßen mit ihrem Plan, am Orte ein Wasserwerk einzurichten, auf erheblichen Widerstand. Die Bürger sind offenbar von der Qualität ihrer Brunnen sehr überzeugt.
Besonderes Wasser hat der Gastwirt Heinrich Fick für die Bramstedter zur Verfügung. Er brachte auf der Brunnenwiese mehrere Bohrungen nieder und wurde schließlich fündig. Das Wasser, das man aus einer aufgestellten Pumpe entnehmen konnte, stand allen Bürgern zum Gebrauch frei. Es wurde sogar besonders ans Herz gelegt, von diesem Wasser zu genießen, um die heilende und stärkende Wirkung unter Beweis zu stellen.
Zum Jahresschluß wartet eine begeisternde Neuigkeit auf unsere Großväter und -mütter. Johannes Lütgens eröffnet im Kaisersaal ein Lichtspieltheater, und die Bramstedter können die Bilder laufen lernen sehen. Leider ist der Titel des ersten Filmes nicht bekannt, doch gibt es vom April 1914 die Notiz, daß als aktuelle Filmneuerscheinung „Quo Vadis“ aufgeführt wird.
Im neuen Jahr wartet sogleich ein neuer Gesangsverein mit dem Namen „Eintracht“ auf. Er steht unter der Leitung des Musiklehrers Ernst Beck. Während dieser Verein im Aufbauen begriffen ist, hat die Liedertafel ein trauriges Ereignis zu vermelden: Wilhelm Beck, der 40 Jahre lang Musikdirektor des Vereins war, stirbt am 22.11. im Alter von 76 Jahren.
Die Stadt und der Bürgerverein sorgen weiterhin für ein besseres Stadtbild. Ein Weg vom Badesteig zum Lohstücker Weg wird hergerichtet, und das Rasendreieck beim 70/71-Ehrenmal wird als Schmuckplatz angelegt. Die Fleckenssparkasse investiert fleißig in die Entwicklung des Ortes und baut die Wege durch die Anlagen aus.
In Ehrung Wilhelm II. nennen die Stadtverordneten den Stadtwald in Kaiser-Wilhelm-Wald um. Hinter diesem Wald entsteht in diesem Jahr ein Ferienheim der Wandsbeker Stadtmission, das am 10.7.13 eingeweiht wird.
Doch haben die gewählten Vertreter mit einiger Unbill fertig zu werden: Bürgermeister Rhode hatte Anfang des Jahres eine Kur angetreten und war Wochen später noch nicht zurück. Schließlich wurde Haftbefehl erlassen, und Mitte Mai stellt sich Rhode in Kiel. Er hatte versucht, mit seiner Familie nach Argentinien auszusiedeln – wegen zu vieler Schulden. Bei einer Überprüfung wird festgestellt, daß insgesamt 43.000 Mark veruntreut worden waren. So müssen die Bürger knapp vier Jahre nach Gottlieb Freudenthals Rücktritt erneut an die Urnen treten. Zahlreiche Bewerber lassen von sich hören, und es werden drei Kandidaten erkoren, die zur engeren Wahl stehen. Mitte Dezember wird der Gemeindevorsteher Jensen aus Schönkirchen mit 162 zu 151 Stimmen zum Bürgermeister gewählt.
Damit kehrt aber noch keine Ruhe in unsere Stadt ein. Einigen Bürgern, insbesondere einigen „angesehenen“, paßt die Wahl nicht, und sie legen Protest ein. In dem Schreiben heißt es u. a.: „Wenn man die 162 Wähler, die für Jensen gestimmt haben, nach Namen, Stand, Gewerbe, Gesinnung und Bedeutung betrachtet und sie den 151 Wählern von Schloer (der Gegenkandidat) gegenüberstellt, so …“. Diese Formulierungen rufen noch im neuen Jahr heftigste Debatten in der Stadtverordnetenversammlung hervor. Gärtner Gottlieb Freudenthal schlägt für die Jensen-Wähler eine Bresche und meint, daß wohl Stimme gleich Stimme sei.
Ob es nun ein Ausfluß dieser Streitigkeiten war oder nicht, ist aus den Zeitungen nicht mehr festzustellen, auf jeden Fall wird am 29. Januar 1914 ein Kommunalverein gegründet, der sich mit den Angelegenheiten der Stadt unter größtmöglicher Beteiligung der Bürger befassen will. Vorsitzender wird August Kühl, sein Stellvertreter C. Hein.
Nach der beruhigenden Meldung, daß die Wahl Jensens von höherer Stelle schließlich bestätigt wurde, wollen wir noch einmal kurz in den Dezember des Vorjahres zurückkehren. Es darf wohl nicht unerwähnt bleiben, daß am 15.12. der Gastwirt Willy Fuhlendorf auf seiner Buslinie nach Wrist einen Autoomnibus in Betrieb stellte und damit auch in dieser Richtung für eine zügige Beförderung sorgte.
Ja – da wir gerade beim Verkehr sind, soll ein Plan zum Besten gebracht werden, der Bramstedt auch noch auf dem Wasserweg erreichbar machen sollte. Die Bramau sollte (per Ministerbeschluß) bis Bramstedt schiffbar gemacht werden, und nahe der Beeckerbrücke rechnete man mit einer Anlegestelle. Aber diese Planungen werden, ähnlich wie der Bau der Ost-West-Eisenbahn, durch die Ereignisse in Österreich – Ungarn und dem folgenden Kriegsausbruch zunichte gemacht.
Aber bevor wir uns diesen Geschehnissen und damit auch bald dem Ende dieser Notizen zuwenden, noch einige kurze Meldungen der „Bramstedter Nachrichten“ aus dem Sommer 1914.
Am 16.6. geben die „BN“ bekannt, daß sich ein Fußballverein, der „F.C. Roland“, gegründet habe und die Sportler am Ferienheim üben wollten. Für den 21.6. wird die Fahnenweihe des Schützenvereins vermeldet.
Der Kriegsausbruch bedeutet für die Bramstedter zunächst eine Umstellung. Der Kriegerverein stellt an sämtlichen Ortsausgängen Wachposten auf und spannt über die Beeckerbrücke eine dicke Eisenkette, mit der Fahrzeuge zum Zwecke der Kontrolle zum Stehen gebracht werden sollen. Willy Fuhlendorf stellt bis auf weiteres seinen Omnibusverkehr nach Wrist ein. Zahlreiche Bürger melden sich zum Kriegsdienst oder werden eingezogen, unter ihnen auch Bürgermeister Jensen, der in Neumünster einen Telegraphen bedienen muß (mit der Folge, daß seine Amtsgeschäfte brachliegen). Die Vereine und das Rote Kreuz machen Sammlungen für die Frontsoldaten und unterstützen die Familien von Eingezogenen und Hinterbliebenen.
Der Kriegswille ist in dieser Zeit sehr mächtig. So beschließt man, auf dem Schießstand die 16- bis 20jährigen im Schießen auszubilden, um dem Vaterland einen Dienst zu erweisen. Auch die „Bramstedter Nachrichten“ ändern ihr Erscheinungsbild: War bisher die erste Seite für Lokalmeldungen reserviert, so werden nun in großen Lettern die Siegesmeldungen verkündet. Die letzte Seite hingegen bleibt unverändert, mit der Einschränkung vielleicht, daß sich nach und nach die Todesanzeigen häufen.
Aber bald gewöhnt man sich an den Kriegsalltag. Als am 1.12.14 Willy Fuhlendorf seinen Omnibusverkehr wieder in vollem Umfang aufnimmt, ist dies ein äußeres Zeichen dafür, daß Bramstedt sich mit dem Gedanken eines längeren Krieges abgefunden hat.
Die Spuren, die die Ereignisse von 1914 -18 hinterließen, sind nicht materieller Art. Viele Männer aus dem Kirchspiel Bad Bramstedt mußten ihr Leben lassen, und ihnen zur Ehre setzte der Kriegerverein 1924 ein Denkmal im Herrenholz.
Indes wollen wir diesen Bericht mit einem friedlichen Thema beschließen. Im Jahre 1918 verkauften die Geschwister Heesch, Herr Behncke, die Fleckenssparkasse und Herr Rühger die Badehäuser und die umliegenden Anlagen an Hamburger Interessenten. Dieser Verkauf und die daraus resultierende Entwicklung sind für das heutige Heilbad Bad Bramstedt von einschneidender Bedeutung gewesen.
Es ist wohl nicht zuviel gesagt, wenn man behauptet, daß in den hier behandelten Jahren der Grundstein für das jetzige Aussehen unserer Heimatstadt gelegt wurde. Und wenn man heute sagen kann: „Hier läßt es sich leben“, so ist dies auch ein Wort an diejenigen, denen wir dies zu verdanken haben.
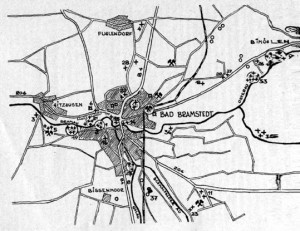




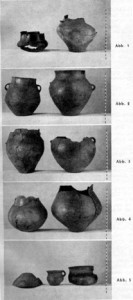
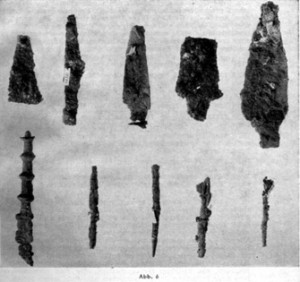
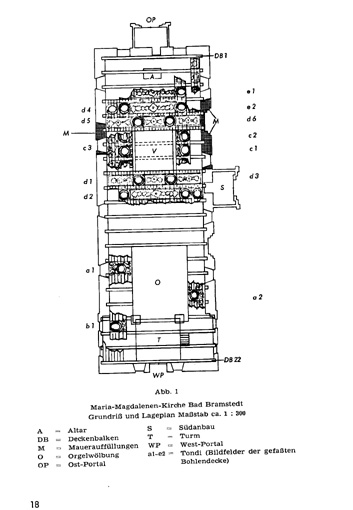 Aus Gründen der kontinuierlichen Darstellung sollen als erstes der Komplex „Kirchenboden“, später die damit im Zusammenhang stehenden Faktoren des Komplexes „Südportal“ Erläuterung finden.
Aus Gründen der kontinuierlichen Darstellung sollen als erstes der Komplex „Kirchenboden“, später die damit im Zusammenhang stehenden Faktoren des Komplexes „Südportal“ Erläuterung finden.