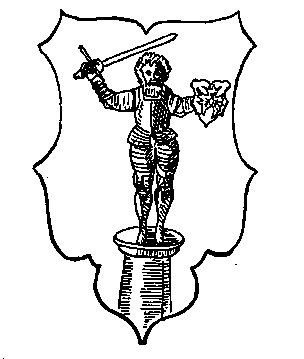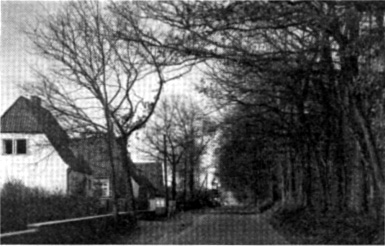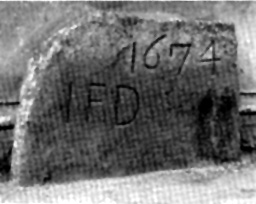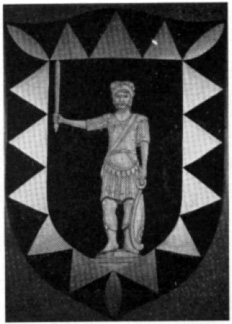Mit freundlicher Genehmigung von Stadtarchivar Jacobsen und M. Roock-Jensen, beide Bad Bramstedt
Schulchronik Föhrden – Barl
Anmerkung Schadendorf 1999: Schulchronik mit dem Charakter einer Dorfchronik.
Inhalt der Chronik:
| I. Gegenwartschronik: |
S. 1 – 43 |
|
S. 50 – 100 |
|
S. 122 – 136 |
| (Straßenbau) |
S. 234 – 238 |
| (Schule) |
S. 272 – 287 |
| sowie drei zusätzlich eingefügte Blätter |
|
| Bevölkerungsbewegung |
S. 44 – 49 |
Statistischer Anhang
Volkszählung d.Gemeinde: |
S. 101 – 103 |
| II. Vergangenheitschronik: |
S. 110 – 121 (I)
S. 137 – 186 (II) |
| A Quellen und Literatur zur Schul- und Dorfchronik |
S. 111 |
| B Beiträge und Nachträge zur Schulgeschichte |
S. 117 |
| C Beiträge und Nachträge zur Ortsgeschichte |
S. 137 |
| III. Volkskundliches |
S. 187 – 188 (III) |
IV. Die Dorfmark: Dorf-, Straßen- und Flurnamen,
Überreste, Inschriften, Dorf- und Hausanlage, Hünengräber |
S. 229 – 233 |
| V. Alte Familien des Dorfes: |
S. 239 – 264 S. 271 |
| VI. Ergänzungsblätter: |
S. 265 – 270 |
| Leerseiten: |
S. 104 – 109
S. 191 – 228 |
| Fehlseiten: |
S. 189 – 190 |
Reihenfolge der Übertragung: S. 1-100, 122-136, 272-273, 234-238, 274-287,
zusätzliche Blätter, 101-103, 110-121, 137-188, 229-233, 239-270.
Anmerkungen zum Text sowie Original-Seitenzahlen sind in eckigen Klammern angegeben []
[1] Gegenwartschronik:Von der Demokratie zum National-Sozialismus
Die Wahlen zur Nationalversammlung am 19. Januar 1919 zeigen, wie überall in Deutschland, in unserer kleinen, kaum 200 Seelen zählenden Gemeinde eine politische Einstellung der Wähler, die bisher in unserer rein ländlichen Bevölkerung nicht bemerkbar gewesen war: 29 Stimmen, also annähernd 25%, wurden für die Sozialdemokratie abgegeben.
Die Landwirtschaft hat unter der Geldentwertung bisher noch weniger zu leiden gehabt. Mancher Bauer fühlt sich infolge der Kriegsgewinne sogar noch wohlhabend und glaubt, daß diese Gewinne einzig durch eine Demokratie, die das Wohlwollen der Feindmächte sucht, ja, scheinbar schon gefunden hat, sichergestellt wurden. Schon die Wahlen im Februar 1921, bei denen die Zahl der sozialdemokratischen Stimmen auf 18 zurückgeht, zeigen eine starke politische Ernüchterung; denn jedem Einsichtigen ist klargeworden, daß die ungeheuren Lasten und Steuern für die Landwirtschaft auf die Dauer untragbar sind. Die Zahl der Parteien steigt von der einen Wahl zur anderen und jede neugegründete Partei verspricht die ersehnte Rettung. Dieser Parteienzwist überträgt sich sogar auf unsere kleine Gemeinde, in der bei der Wahl zur Gemeindevertretung fünf Parteien um die Stimmen der Wähler werben. Die jüdisch-liberalistische Einstellung, daß Gold und Besitz der alleinige Wertmesser ist, bricht sich immer mehr Bahn, und daß einzig die Besitzenden, also Bauern mit größerem Besitz, Anspruch auf eine nationale Gesinnung erheben, gilt als selbstverständlich. Doch durch die Ruhrbesetzung und die Inflation wird mancher von seinem Wahn befreit. Mancher einsichtige Volksgenosse ballt die Faust und wünscht ein geeinigtes deutsches Volk. Die Idee, „Es kann dem Einzelnen nur gutgehen, wenn die breite Masse des Volkes zahlungsfähig ist, d.h. wenn es allen gut geht“, beginnt sich im Volke zu regen. Dieser Gedanke kommt in der „Ruhrspende“ und durch die Aufnahme notleidender Ruhrkinder in unserer Gemeinde zum Ausdruck. Mancher verwünscht die Parteien, die alle viel versprechen, aber sich zu keiner Handlung aufschwingen können. Ganz Deutschland wartet auf den starken Mann, der [2] das deutsche Volk einigt und einer besseren Zukunft entgegenführt!
Die Ereignisse vom 9. November 1923 in München werden von manchem national denkenden Einwohner als „heldenhaft“ empfunden, geraten allerdings bald wieder in Vergessenheit.
Der Bauernstand ist bisher von den Geldinstituten unabhängig gewesen. Um die Wirtschaft zu heben, wurden 1924 Kredite für Schweinemast und Viehgräsung zu einem Zinsfuß von 30 – 40% p.A. angeboten. Da die Landwirtschaft in diesen Jahren infolge der auftretenden Schweinepest und Maul- und Klauenseuche vollständig unrentabel ist, muß mancher fleißige Bauer seinen Besitz belasten. Vom Staat werden 12% Goldpfandbriefe, deren Kurs jedoch auf recht bald auf 80, ja 60% des Nennwertes sinkt, für die Landwirtschaft herausgegeben. Die Verschuldung nimmt mit Riesenschritten zu. So wird der nicht freie Bauer ein Knecht des jüdischen Kapitals. Der Grund und Boden, einst das heiligste Gut seiner Ahnen, wird immer mehr Handelsware, die, wie Gold, ihren Besitzer von Tag zu Tag wechselt. Wohl machen sich von Zeit zu Zeit Scheinkonjunkturen bemerkbar, doch im allgemeinen wird die Zeit von Monat zu Monat schlechter. Die Arbeitslosigkeit nimmt rapide zu und macht sich sogar in unserem Dorfe bemerkbar. Knechte und „Mägde“, die früher während des ganzen Jahres in Dienst genommen wurden, werden nicht selten während der Wintermonate entlassen und beziehen Arbeitslosenunterstützung. Bauern werden die Zeiten immer trostloser. Da sie in unserer Gegend besonders auf Milchwirtschaft, Schweinemast und Viehgräsung angewiesen sind, geht die Wirtschaft sprungweise abwärts. Die Milchpreise sinken in kurzer Zeit von 15 auf acht Pfennig je Liter, die Schweinepreise von 70 RM auf 30 RM je Zentner. Die Kartoffeln sind wegen scheinbarer Überproduktion und Mangel an Kaufkraft kaum für eine RM je Zentner abzusetzen. Dabei steigt die Zahl der Arbeitslosen von Tag zu Tag und die Steuern und sozialen Lasten werden dauernd erhöht. Verschiedene Bauern beginnen damit, dem Staate die Zahlung der Steuern zu verweigern.[3]
Um diese Zeit macht sich die N.S.-Bewegung auch in unserer Gemeinde zum ersten Mal bemerkbar. Die erste Versammlung der „Hitler-Bewegung“ wird durch den Milchkontrolleur Struve aus Fitzbeck, dem jetzigen Landesbauernführer, Ende 1930 in Blöckers Gastwirtschaft abgehalten, ohne daß Mitglieder geworben werden; denn die Bauern sind mißtrauisch geworden und wollen von einer neuen Partei nichts wissen. Doch schon ein Werbeabend am 1.2.1931 in der Gastwirtschaft von P. Steenbock, geleitet von Reese und Fischer aus Stellau-Wrist und unter Anwesenheit des S.A.-Truppführers Bracker aus Weddelbrook und sechs S.A.-Leuten, bringt den ersten Erfolg: A. Feil, B. Feil, Johs. Lohse, Hans Schnack und Jul. Kröger treten der Partei bei und bis 1.6.1932 erhöht sich die Zahl der Mitglieder auf 15. Die N.S.D.A.P Föhrden Barl wird der Ortsgruppe Stellau-Wrist angegliedert.
In den wiederholten Wahlen tritt deutlich in Erscheinung, daß die Tage der Sozi-Regierung gezählt sind, die Stimmenzahl der N.S.D.A.P. wächst unaufhörlich. Den Tag der Umwälzung am 30.1.1933, an dem der Reichspräsident Feldmarschall Hindenburg sich entschließt, Hitler die Regierungsgewalt zu überlassen, erlebt jeder begeistert und innerlich befriedigt am Lautsprecher mit. Bei der Reichstagswahl am 5.3.1933 werden in unserer Gemeinde von 130 Stimmberechtigten 113 Stimmen für die N.S.D.A.P. und neun Stimmen für „Schwarz-weiß-rot“ abgegeben. Wahlbeteiligung 98%. Der Tag von Potsdam wird in Schule und Gemeinde würdig gefeiert. Von allen Häusern flattern die Fahnen!
Bald nach der Machtübernahme wird, um die Interessen der Gemeinde im Kreise besser vertreten zu können, Föhrden Barl ein selbständiger Stützpunkt des Kreises Segeberg und auch die S.A. wird dem Sturm in Hitzhusen unterstellt. Am 1.3.1933 wird Bernh. Feil zum Stützpunktleiter und Albert Feil zum Ortsbauernführer ernannt. Der bisherige Gemeindevorsteher wird bis auf weiteres als Bürgermeister bestätigt. Am 1.5.1935 stellt Pg. [Parteigenosse] B. Feil seinen Posten als Stützpunktleiter zur Verfügung und an seine Stelle tritt Pg. Gustav Blunck, Wilh. Mohr wird Ortsgruppenamtsleiter der N.S.V. Am 1.7.1936 wird Alb. Feil zum Bürgermeister, Hs. Rühmann zum Kassenleiter und Johs. Lohse zum Ortsbauernführer ernannt. Seit Gründung der Ortsgruppe werden alljährlich das S.A.-Ringreiter- und das Erntedankfest als Volksfeste abgehalten. Am 15.5.1938 gründet Frau Hagelstein die N.S.-Frauenschaft, die nach ihrem Wegzug (1.4.1939) von Frau Tonder geleitet wird.
[4] Der Landwirtschaft wird geholfen.
30.1.1933.Nach der Machtübernahme am 30.1.1933 galt es nun, scheinbar unüberwindbare Aufgaben zu lösen.
Die Arbeitslosigkeit innerhalb unserer rein bäuerlichen Gemeinde ist schnell beseitigt. Durch die Regierung werden nun Festpreise für landwirtschaftliche Produkte und ebenso Grundlöhne für die Arbeiter eingeführt. Die Preise für Roggen – Zentner acht Mark – und Milch – neun Pfennig je Liter – erweisen sich bald zu niedrig und müssen im Laufe der Zeit mehrfach erhöht werden. Die Preise für Kunstdünger werden durch Hermann Göring um 30% gesenkt. Um die Bautätigkeit zu beleben, zahlt der Staat zu den Reparaturkosten und Kosten eines Umbaues 40% Zuschuß, wovon z.B. Johannes Harbeck bei Neubedachung seiner Häuser und Heinrich Schnack und Gebrüder Thies beim Ausbau ihrer Wohnhäuser Gebrauch machen. Auch zur Neubeschaffung landwirtschaftlicher Maschinen und dem Bau von Jauchegruben und Dungstätten zahlt der Staat Zuschüsse. Um aus den Ländereien Höchsterträge herauszuholen, wird die Weideeinteilung, der Umbruch von Wiesen und Weiden mit schlechten Gräsern, die Drainierung der Äcker und Wiesen angeregt und durch hohe staatliche Zuschüsse gesichert. Zur Hebung der Milchwirtschaft werden die Meiereien vergrößert und modern eingerichtet, die Milchkontrolle durchgeführt und auf Züchtung von hochwertigem Zuchtvieh staatlicherseits eingewirkt. Um die Fleischversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, werden sogenannte Schweinemastverträge abgeschlossen. Der Staat liefert acht Zentner Korn, je Zentner ca. 8,50 RM und zahlt später für Fettschweine 56 Mark je Zentner. Es würde zu weit führen, auf alles einzugehen, um zu zeigen, wie unsere Regierung alles tut, um die Volksernährung zu sichern und um den Bauernstand zu heben.
Um viele Bauern, die vor dem finanziellen Zusammenbruch stehen, vor dem Zusammenbruch zu retten, werden die überschuldeten Bauernhöfe unter staatlichen Schutz gestellt und später umgeschuldet, so daß jeder Bauer in die Lage versetzt wird, die auf seinem Besitz ruhenden Steuern und Lasten zu tragen. In unserer Gemeinde erfolgt Umschuldung bei folgenden Bauern: August Johannsen, Rudolf Fölster (Kätner), Witwe Dora Fölster (Katenstelle 4 1/2 ha), Bernhard Feil und Hans und Johannes Rühmann. Sämtliche Bauernhöfe werden zu Erbhöfen erklärt, dürfen als solche nicht weiter belastet werden, gehen ungeteilt auf den Hoferben über und bleiben so der Familie für ewige Zeiten erhalten. Zum Ortsbauernführer wird Albert Feil, nach dessen Rücktritt 1937, Johannes Lohse ernannt, den der Ortsgruppenleiter während des Krieges 1939/40 vertritt.
[5]Während dieser Zeit hat der Bauernführer in Vertretung, Pg. Blunck, oft schwere und unangenehme Aufgaben zu erledigen, die er jedoch stets gern und ohne Beeinflussung ausführt. Die Arbeitskräfte müssen gerecht verteilt, die verwaisten Bauernhöfe verwaltet und die zugeteilten Futtermittel verteilt werden.
Mehrere Volksdeutsche aus Jugoslawien finden seit 1938 in unserer Gemeinde Beschäftigung. Sie haben sich schnell an die hiesigen Verhältnisse gewöhnt und gelten als fleißige und willige Mitarbeiter. Nach der Niederwerfung Polens werden bei den Bauern zehn junge Volksdeutsche untergebracht, die jahrelang arbeitslos waren und sich daher schwer an die Landarbeit gewöhnen konnten. Die meisten von ihnen – bis auf vier – kehrten recht bald in ihre Heimat zurück.
Im August 1940 finden, wie einst im Weltkriege, 20 französische Kriegsgefangene, die in Johannes Lohse’s Kate Unterkunft gefunden haben und bei ihren Arbeitgebern das Essen einnehmen, in unserer Gemeinde Arbeit. Sie werden von zwei älteren Wachleuten beaufsichtigt. Obgleich viele Kriegsgefangene von der Landwirtschaft nichts verstehen, sind die Bauern bisher im allgemeinen mit ihren Leistungen zufrieden. Sie gelten als willige und fleißige Arbeiter. (Lohn 80 Pfennig je Tag.)
In der Verwaltung des Dorfes ist seit der Machtübernahme das Führerprinzip gewährleistet. Dem Bürgermeister, der auf Vorschlag der N.S.D.A.P. vom Landrat ernannt wird, steht der Gemeinderat zur Seite. Dieser hat, wie der Name schon sagt, zu beraten, zu entscheiden hat einzig der Bürgermeister, der auch allein die Verantwortung trägt.
Da der ehemalige Bürgermeister W. Runge kein Parteigenosse ist, tritt 1937 Pg. Albert Feil an seine Stelle. Zu Mitgliedern des Gemeinderates werden der Ortsgruppenleiter Pg. Bernhard Feil – seit 1935 Pg. Blunck -, Pg. Hans Rühmann (Kassenleiter), Johannes Lohse (Ortsbauernführer), Pg. Johannes Karstens, Pg. Hermann Blöcker u. Vg. [Volksgenosse] Heinrich Harbeck ernannt.
Seit 1933 hat die Gemeinde eine „freiwillige Feuerwehr“, der fast alle Bauern und jüngeren Leute angehören und die seit Bestehen durch den Löschzugführer Pg. G. Blunck vorbildlich geführt wird. Die Wege- und Verkehrsverhältnisse wurden weiter ausgebaut.
Mancher ältere Volksgenosse konnte oder wollte die jetzige Zeit nicht verstehen. [6] Er kann es nicht begreifen, daß er mit seinen liberalen, demokratischen oder konservativen Ideen nun plötzlich von der Führung abtreten soll, um wenig begüterten jungen Volksgenossen Platz zu machen und ist der Meinung, daß dieser nationalsozialistischen Revolution recht bald eine andere folgen werde. Leider sah sich die Geheime Staatspolizei sogar genötigt, in einem Falle (Bauer Heinrich Reimers) einzugreifen. (9 [evtl. 4?] Monate Gefängnis). Doch allmählich kommen, wie es die Spenden zum deutschen Roten Kreuz und zum Winterhilfswerk zeigen, auch die Alten zu der Einsicht: Es ist doch Vieles besser geworden!
„Gleiches Blut gehört in ein Reich!“
Wir wollen Gott danken, daß es uns vergönnt ist, die größten geschichtlichen Ereignisse aller Zeiten, die Schaffung des „Großdeutschen Reiches“ durch unseren Führer mitzuerleben. Nachdem dieser mit starker Hand die inneren Verhältnisse des Reiches geregelt und ein schnelles Aufblühen der Wirtschaft herbeigeführt hat, versucht er durch geschickte Verhandlungen die unterjochten Auslandsdeutschen ins Reich zurückzuführen. Dies gelingt ihm durch die Rückkehr des Saargebietes.
Das Ergebnis der Volksabstimmung im Saargebiet am 13. Januar 1935 wird am 15. Januar 1935 durch den Kommissar des Völkerbundes über alle Sender der Welt bekanntgegeben. Die Schüler haben sich in höchster Spannung um den Lautsprecher versammelt. Die Freude und Begeisterung im Saarland nimmt von Minute zu Minute zu. Die Erwartungen sollen noch bei weitem übertroffen werden.: 90,5% der Gesamtbevölkerung haben für den Anschluß an Deutschland gestimmt. Wir vernehmen mit Rührung, wie Gauleiter Bürckel dem Führer Meldung erstattet und wie dieser den Deutschen an der Saar durch den Lautsprecher mit warmen Worten seinen Dank ausspricht. Nach kurzer Schulfeier, in der ich über das Thema: „Gleiches Blut gehört in ein Reich“ spreche, wurden die Schüler entlassen. Das Dorf zeigt reichen Flaggenschmuck.
Am 1. März erfolgt dann die feierliche Rückgabe des Saargebietes durch den Völkerbund. So weit Deutsche auf der Erde wohnen, wird dieser Tag festlich begangen. Wieder sind meine Schüler mit mir um den Lautsprecher versammelt, um die Übertragung des Festaktes in Saarbrücken zu hören. Am Abend wird durch die S.A. auf dem Wrister Kamp ein Freudenfeuer abgebrannt. Lehrer Mohr holt die Feuerwehr: „Die Saar kehrt heim!“ [7] Mit dem Liede „Deutsch ist die Saar“ endet die Feier.
Freiwillige (meine ehemaligen Schüler) treten in die Wehrmacht ein!
Es ist dem Volke kein Geheimnis mehr geblieben, daß in aller Stille gearbeitet wird, Deutschland wieder „wehrhaft“ zu machen, um die Ketten des Schmachvertrages von Versailles zu zerbrechen. In Neumünster entstehen mächtige Kasernen, auf dem Lockstedter Lager werden große, mächtige, unterirdische Bauten, „Kartoffelkeller“, aufgeführt, die Zahl der Freiwilligen, die für ein Jahr verpflichtet werden – darunter besonders viele Studenten – nimmt immer mehr zu. Aus unserem kleinen Dorf mit rund 200 Einwohnern dienen z.Zt. sechs ehemalige Schüler als Freiwillige: Kurt Mohr, Walter Behnke, Ernst Kröger, Hinrich Kröger, Otto Schnack und Ernst Kock – zwei als Berufssoldaten: Hans Kock und Heinrich Kock – und drei bei der Polizei: Hans Blunck, Fritz Fölster und Julius Kröger.
Da unsere ehemaligen Feinde, insbesondere Frankreich und England, trotz feierlichen Versprechens nicht daran denken, abzurüsten, erklärt der Führer gelegentlich der Heldenehrung am 17. März 1935 vor dem Reichstag die Einführung der „allgemeinen Dienstpflicht“.
Diese heroische Tat des Führers wird im ganzen deutschen Volke mit inniger Freude begrüßt. In feierlichem Zuge bewegen sich die Bewohner unseres Dorfes zum Kriegerdenkmal 1914/18, um durch Kranzniederlegung die Gefallenen des Weltkrieges zu ehren. Die Gemeinde flaggt halbmast.
Der historische 7. März 1936, den wir geschlossen am Lautsprecher miterleben, ist ein Tag von außenpolitischem Ereignis ersten Ranges. Vor dem Reichstag verkündet der Führer die Besetzung des Rheinlandes, wodurch der letzte noch fehlende Akt zur vollen deutschen Wehrhoheit wieder errungen ist. Der Reichstag wird aufgelöst, und am 29. März tritt die Nation geschlossen an die Wahlurne, um ihre Pflicht zu tun und den Führer zu bestärken in seinem Kampf für Ehre, Freiheit und Frieden der deutschen Nation. In unserer Gemeinde findet die Wahl, wie in früheren Jahren, in der Schule statt und kann, da bereits nachmittags drei Uhr sämtliche Wähler ihre Stimmen abgegeben haben, vorzeitig abgeschlossen werden. Das Ergebnis der Wahl zeigt wieder einmal, daß das ganze deutsche Volk (98,8%) geschlossen hinter seinem Führer steht. In unserem Dorfe werden acht Stimmen mit Nein gezählt (95% „Ja“-Stimmen), worüber mancher recht verärgert ist.
[8] Während meines Aufenthaltes in der Ostmark im Jahre 1929 hatte ich die Österreicher als gute Deutsche kennengelernt. Sie hatten damals nur den einen Wunsch: „Wir wollen heim ins Reich!“ Dieses Bestreben machte sich ganz besonders in Steiermark und Tirol, wo wir „Reichsdeutschen“ mit einem Sturm der Begeisterung empfangen wurden, bemerkbar. Doch der Feindbund und die katholische österreichische Regierung versuchten mit allen Mitteln, den Anschluß ans Reich zu unterbinden.
1936 nahm ich als „politischer Leiter“ unserer Ortsgruppe am Reichsparteitag in Nürnberg teil. Ich erlebte Tage der Begeisterung, die nicht zu beschreiben sind. Den österreichischen Nationalsozialisten war von ihrer Regierung die Teilnahme am Parteitage verboten; aber trotzdem hatten sich bei Nacht und Nebel einige Formationen über die Grenze geschlichen, um den Führer zu sehen und begrüßen zu können. Die Ostmärker, die mit ungeheurem Jubel empfangen wurden, schilderten uns die Not und das Elend ihrer Heimat und die Drangsalierung ihrer Gesinnungsgenossen in Österreich. Jeder von ihnen glaubte mit voller Zuversicht: Der Führer wird uns bald heimholen und die Kerker öffnen!1937 verlebe ich mit vielen „Kraft durch Freude“-reisenden Volksgenossen an der österreichischen Grenze (Freilassing). Viele Flüchtlinge suchten schon damals Schutz im Deutschen Reich und wurden militärisch (z.B. auf dem Lockstedter Lager) ausgebildet. Die Grenze wurde von österreichischen Grenzaufsehern aufs Strengste überwacht. Die Spannung war schon damals auf das Höchste gestiegen. Um Blutvergießen zu vermeiden, verhandelt der Führer noch einmal mit der österreichischen Regierung, die scheinbar einzulenken gedenkt.
Am Abend des 12. März 1938 sitze ich wieder am Lautsprecher. Nach Beendigung des Nachrichtendienstes wird bekanntgegeben, daß noch wichtige Meldungen folgen werden. Daß die politischen Vorgänge in Österreich sich wegen der „Volksabstimmung“ immer mehr zugespitzt haben, ist mir durch die Presse hinreichend bekannt. Wird sich der Führer die Herausforderung des österreichischen Bundeskanzlers gefallen lassen?Von diesem Alpdruck werde ich erlöst; denn der Lautsprecher gibt bekannt, daß der Bundeskanzler Schuschnigg, um Blutvergießen zu vermeiden, beschlossen hat, zurückzutreten und daß der Nationalsozialist Seiß Inquart die Regierungsgeschäfte übernommen hat. Die neue österreichische Regierung wendet sich nun, um Ruhe und Ordnung zu gewährleisten, um Schutz an den Führer, der Waffenhilfe zusagt.
[9] Die Ostmark wird ans Altreich angegliedert!
Bereits am Morgen des 13. März 1938 prangt die Gemeinde im reichen Flaggenschmuck. Deutsche Truppen marschieren! Der Führer, von den Ostmärkern mit noch nie dagewesenem Jubel begrüßt, hält seinen Siegeszug durch seine Heimat! Wohl selten sind unsere sonst so zurückhaltenden Bauern von den sich überstürzenden Nachrichten so mitgerissen, wie in diesen Tagen! Wie leuchten die Augen der Kinder, wenn der Führer zum Volke spricht, wenn die Ostmark, das jüngste deutsche Bollwerk, in nicht endenwollender Begeisterung dem Führer zujubelt. Das österreichische Volk hat durch seine dem Führer entgegengebrachte Begeisterung bereits bewiesen, daß es stets deutsch gewesen ist.
Am 15. März findet eine Schulfeier statt. Der Lehrer spricht über das Thema: „Ein Volk, ein Reich, ein Führer!“
Am 10. April findet in dem nunmehr „Großdeutschen Reich“ eine Volksabstimmung und gleichzeitig die Neuwahl zum deutschen Reichstage statt. Der Stimmzettel enthält die Frage: „Stimmst du für den Anschluß Deutsch-Österreichs an das Deutsche Reich und für die Liste deines Führers Adolf Hitler?“ In unserer Gemeinde wohnen 117 Wahlberechtigte (Vollendetes 20. Lebensjahr), von denen sechs mit „Nein“ und 117 mit „Ja“ stimmen. Sechs auswärtige Wähler wählten durch Stimmschein. Anläßlich des überwältigenden Wahlerfolges wird Flaggenhissung vom 10. – 13. April angeordnet.
Das Sudetenland kehrt heim. Die Tschechei wird deutsches Protektorat.
In banger Erwartung erlebt unsere Gemeinde die letzten Tage des Monats September. Ein neuer Weltkrieg scheint vor der Tür zu stehen! Wohin man auch kommt, überall herrscht eine schwüle, jedoch ernste und zuversichtliche Stimmung. Jedem ist bewußt: Die deutschen Truppen werden marschieren, um die bedrängten Brüder zu erlösen, um ein uns angetanes Unrecht wieder gutzumachen. Reservisten sind auf unbestimmte Zeit zu Übungen eingezogen, die Gemeinde stellt 15 Pferde mit mehreren Wagen, die älteren Bauern: Heinrich Schnack, Johs. und Heinrich Harbeck, Hugo Schwartzkopff und Hinrich Schuldt nach Neumünster zu den einzelnen Truppenteilen zu befördern. Der 29. September, der „Tag von München“, rettet den Frieden! Am 1. Oktober rücken die deutschen Truppen, darunter einige ehemalige Schüler: die Unteroffiziere und Wachtmeister Kurt Mohr, Walter Behnke, Hans und Ernst Kock, außerdem die Gefreiten Ernst Harbeck und Otto Schnack – als Angehörige der 20. motorisierten Division – unter dem Jubel der befreiten Bevölkerung über die Grenze.
[10] „Am 3.10.1938 hielten wir unseren Einzug ins Sudetenland und haben nunmehr unser erstes Quartier (Bunaburg, Tetschen. Bodenbach) bezogen. Ihr könnt Euch keine Vorstellung machen, welche Begeisterung hier herrscht und mit welchem Jubel wir empfangen wurden! Ich kann es nicht verstehen, daß dies nunmehr befreite Gebiet, in dem nur Deutsche wohnen, nicht zu Deutschland gehören soll! Als wir einmarschierten, wurden wir von einem Blumenmeer überflutet, die Straßen bildeten einen Blumenteppich! Die Begeisterung der Bevölkerung, dazu die wunderbare Landschaft, kann ich nicht mit Worten schildern u.s.w.“, so schreibt der Unteroffizier Mohr, mein Sohn, über dieses unvergeßliche Ereignis.
Um die Not der befreiten Brüder zu lindern, finden durch die N.S.V. Sammlungen in unserer Ortsgruppe statt, die nie dagewesene Resultate zeigen. Durch diese Spenden scheint das deutsche Volk dem Führer eine kleine Dankesschuld abtragen zu wollen.
Da die politische Spannung nicht nachläßt, wird die N.S.V. im Dezember 1938 beauftragt, alle Bewohner der Gemeinde zwecks Beschaffung von Gasmasken zu erfassen. Nach der Haushalts-Statistik vom 31. Dezember 1938 zählt unsere Gemeinde: 38 Hausstände mit 99 männlichen und 93 weiblichen Personen, die sich wie folgt nach Altersstufen verteilen:
männl.: bis 6 Jahre – 11 Personen; 6-18 Jahre – 24 Pers.; 18-45 Jahre – 40 Pers.; über 45 Jahre – 22 Personen.
weibl.: bis 6 Jahre – 13 Personen; 6-18 Jahre – 20 Pers.; 18-45 Jahre – 39 Pers.; über 45 Jahre – 19 Personen.
Der Blitzkrieg gegen Polen.
Im Laufe des Sommers 1939 – die Tschechei ist am 1.3.1939 nach Besetzung durch deutsche Truppen „Protektorat des Deutschen Reiches“ geworden – nimmt die Unterdrückung der Volksdeutschen in Polen von Tag zu Tag zu. Deutsche Geschäfte werden geschlossen, furchtbare Qualen hat die deutsche Bevölkerung zu erdulden, ein Flüchtlingsstrom setzt sich über die Reichsgrenze in Bewegung. Diesen Zuständen kann die deutsche Reichsregierung nicht länger untätig zusehen. Seite 265.
Auch an unserer Gemeinde gehen die Kriegsereignisse nicht spurlos vorüber. Trotz der Kriegserklärung der Großmächte Frankreich und England und der drohenden Luftangriffe werden keine Gasmasken an die Bevölkerung verteilt, doch wird eine sofortige allgemeine Verdunkelung angeordnet, die seitens der Bewohner strenge befolgt wird. An geschützt gelegenen Stellen unseres Dorfes werden Luftschutzgräben ausgeworfen, in denen die Einwohner bei Fliegerangriffen Zuflucht finden können. Der Schulbetrieb wird auf Anordnung wegen der dringenden Erntearbeiten bis auf weiteres geschlossen. Bereits Ende August hat die Gemeinde der Militärbehörde neun Pferde [11] und sechs Bauwagen zur Verfügung zu stellen. Für Pferde werden 900 – 1.400 RM, für Wagen 500 – 600 RM vergütet. Eine allgemeine Mobilmachung, die man erwartete, erfolgte nicht, vielmehr werden die Wehrpflichtigen nach und nach zu ihren Truppenteilen einberufen: Otto Schnack, Hans Studt, Ernst Studt – Brüder -, Hugo Steenbock, Johannes Lohse, Erhard Plambeck, Sahling – Knecht bei Johs. Harbeck -, Kaim – bei Gebr. Schnack – und Hans Blunck. Ernst Harbeck zieht ebenfalls mit seinem Truppenteil gen Osten und ebenso die Längerdienenden: Kurt Mohr, Walter Behnke, Heinrich Behnke, Hans Kock, Heinrich Kock, Ernst Kock (drei Brüder), Ernst Kröger, Hinrich Kröger, Wilh. Kröger (Brüder).
Um eine gerechte Verteilung der Lebensmittel und Kleidung herbeizuführen, wird das Kartensystem eingeführt. Die Zuteilung ist nicht zu reichlich, doch immerhin hinreichend. Jeder Volksgenosse erklärt sich gerne mit diesem fürsorglichen Eingriff der Regierung einverstanden; denn mancher hat die trostlose Zeit des Weltkrieges in Erinnerung, in der stets sämtliche Maßnahmen zu spät kamen. Jeder ist erbost auf England, das dieses Blutvergießen verschuldet hat.
Täglich überfliegen deutsche Flugzeuge unser Dorf, oft in Ketten, zuweilen sogar in ganzen Geschwadern. Feindliche Flieger kommen zuweilen während der Nacht, um Flugblätter aus schwindelnder Höhe abzuwerfen. Auf die Bevölkerung, die fest von der gerechten Sache des Führers überzeugt ist, kann der lächerliche Inhalt dieser Zettel keinen Einfluß ausüben. Jeder geht seiner Arbeit nach und tut mehr denn je seine Pflicht und Schuldigkeit. Erwähnen muß ich den Einsatz unserer Jugend, die bei der Ernte und insbesondere bei Einbringung der Hackfrüchte Vorbildliches geleistet hat. Unter der Bevölkerung herrscht nicht die äußere Begeisterung wie bei Ausbruch des Weltkrieges 1914, vielmehr geht jeder still und ernst seiner Arbeit nach – doch im Ganzen ruht das volle Vertrauen zum Führer und der Glaube an den Sieg! „Siegen kann nur einer, und das sind wir!“
Die Dankbarkeit der Bevölkerung kommt durch außergewöhnliche Geldspenden zum Winterhilfswerk 1939/40 zum Ausdruck. 106 Konservendosen, gefüllt mit Obst und Gemüse, 40 gefüllte Einpfunddosen mit Fleisch und Wurst und 35 Pfund Backobst werden der Kreisamtsleitung Segeberg für Kriegslazarette zur Verfügung gestellt.
Eine Kleidersammlung, die im Vorjahr erfolgreich durchgeführt wurde, kann nicht abgehalten werden, da jeder auf die knappe Zuteilung seiner Kleiderkarte angewiesen ist und seine abgetragene Kleidung daher nicht entbehren kann. Mit Einwilligung des Bürgermeisters werden auf Veranlassung der Kreisleitung der N.S.D.A.P. den Lazaretten aus der Schülerbibliothek die Bücher zur Verfügung gestellt.
[12] Stündlich laufen nun Siegesmeldungen ein, die mit stiller Freude und inniger Begeisterung vom Volke aufgenommen werden. Jeder, aber ganz besonders die Jugend, ist stolz auf den heldenmütigen Einsatz der deutschen Flieger-, Panzer- und motorisierten Truppen, unter denen auch Söhne unserer Gemeinde kämpfen. Mit Abscheu vernehmen wir die Greueltaten und Morde, die die Polen an Volksdeutschen begangen und dadurch bewiesen haben, daß der Staat Polen keine Existenzberechtigung unter den zivilisierten Völkern beanspruchen kann.
Allgemeine Freude und Genugtuung herrscht über den Abschluß des Abkommens mit Rußland. Keiner kann diesen außenpolitischen Erfolg der Regierung fassen – verstehen und begrüßen tut ihn jeder!
In kaum drei Wochen ist der Blitzkrieg in Polen beendet. Vor allen Häusern flattern acht Tage lang die Siegesfahnen. Daß dieser Krieg auf unserer Seite so geringe Opfer gefordert hat, ist kaum zu verstehen. Aus unserem Dorfe ist trotz der starken Beteiligung keiner gefallen noch verwundet. Bereits Mitte Oktober sind unsere Polenkrieger in der Heimat auf Urlaub und berichten von ihren Erlebnissen. (S. 265 – 269.)
„Ich hatt‘ einen Kameraden!“
Die Angehörigen der Gemeinde waren überglücklich, daß der uns aufgezwungene Krieg bisher keine Opfer aus unserem Dorfe forderte. Da überraschte uns alle die traurige Nachricht, daß durch einen schweren Unglücksfall am 31.3.1940 der Unteroffizier Otto Schnack, geb. 18.12.1913, jüngster Sohn des Erbhofbauern Heinrich Schnack, den Reitertod gefunden hatte. Er war stets ein guter Kamerad, ein schneidiger und vorbildlicher Soldat und ein langjähriger Kämpfer der Bewegung. Nachdem die Leiche von Verden a./A. überführt worden war, fand sie auf dem Friedhof Bad Bramstedt, auf dem Erbbegräbnis der Ahnen, die letzte Ruhestätte.
Wohl selten hat unsere Gemeinde eine solche Trauerfeier erlebt! Nach kurzen, packenden Abschiedsworten des Pastors Redecke aus Stellau im Elternhaus bewegt sich der Leichenzug aus dem Dorfe. Der Sarg, geschmückt mit der Reichskriegsflagge und dem Stahlhelm, steht auf dem einfachen, mit frischem Tannengrün behangenen Bauernwagen, der von den Lieblingspferden des Dahingeschiedenen bespannt ist. Auf den vielen beschleiften Kränzen liest man die letzten Grüße des Reitersturmes in Kellinghusen, der N.S.D.A.P. [13] der Ortsgruppe Föhrden Barl, der Eltern und Geschwister und seiner nahen Anverwandten. Dem Leichenzug voran marschiert die Freiwillige Feuerwehr, zu beiden Seiten des Sarges schreiten die Träger: sechs Kameraden des Reitersturmes – zur Hälfte in feldgrau – , und hinter dem Sarge folgen die schwergeprüften Eltern, eine Abordnung des Truppenteils mit zwei riesigen Kränzen, und viele Freunde, Verwandte und Bekannte geben dem Toten bis zum Ausgang des Dorfes das letzte Geleit.
Die eigentliche Leichenparade findet in Bad Bramstedt von der Kirche aus statt. Vor der Kirche haben eine 36 Mann starke Musikkapelle, eine Abordnung des bramstedter Kyffhäuserbundes, Vertreter der Amtsfeuerwehr und Amtsbezirkes Weddelbrook, des Reitersturmes Kellinghusen, der S.A. und der N.S.D.A.P. u.a. Aufstellung genommen. Nachdem die Leiche die Kirche verlassen hat, senken sich die Fahnen und dumpf und feierlich setzt die Trauermusik ein. Zum Friedhof bewegt sich ein Trauerzug, wie ihn bisher nur wenige gesehen haben. Durch ein Spalier wird der Sarg zur Gruft getragen und unter den Klängen des Liedes vom „guten Kameraden“ der heimatlichen Erde übergeben. Drei Salven krachen über das Grab! Darauf legen die Formationen ihre Kränze nieder. Hauptsturmführer Nickel, Bad Bramstedt, spricht zu Herzen gehende Abschiedsworte und schildert den Verstorbenen als guten Kameraden, als vorbildlichen Reiter und Kämpfer für Führer, Volk und Vaterland. Wir werden den teuren Toten, der nunmehr in die Reihen Horst Wessels eingetreten ist, nie vergessen! Noch lange verweilen wir in stiller Andacht am Grabe des allzu früh Dahingerafften.
Die Jugend unseres Dorfes verliert in dem Verstorbenen, der noch vor wenigen Jahren mein Schüler war und später als Freiwilliger im Reiterregiment in Schleswig und Parchim diente, ihren Reitlehrer, die Eltern ihren guten Sohn, der in Kürze den Erbhof übernehmen sollte, die Partei ihren Mitkämpfer, die Feuerwehr und Wehrmacht einen guten Kameraden und mein Sohn seinen besten Freund!
Wir werden Dich, mein lieber Otto Schnack, nie vergessen und stets in Ehren halten!
Der Kriegswinter 1939/40 gehört wohl zu den härtesten seit vielen Jahren, und jeder, der diese Kälte miterlebt hat, wird diese furchtbaren Wintermonate nicht vergessen! Wohl liegen unsere tapferen Soldaten in ihren Winterquartieren oder in den geschützten Bunkern des Westwalles. Die Bevölkerung, die ihre Soldaten wie ihre Kinder betreut, teilt alles mit ihnen: Freud und Leid. Urlauber erzählen so gerne von der wirklichen Volksgemeinschaft, die zwischen ihnen und ihren Quartiergebern herrscht und wie sie das Weihnachtsfest gemeinsam fristen. [14] Aber auch die Heimat gedenkt in Liebe und Dankbarkeit ihrer Soldaten. Die Post ist kaum in der Lage, die undenkbar vielen Pakete zu befördern. Der Gau, die Ortsgruppe der N.S.D.A.P., die Frauenschaft, die Freiwillige Feuerwehr, die Spar- und Darlehnskasse senden Liebesgabenpakete mit herzlichen Weihnachtsgrüßen aus der Heimat. Die vielen Dankschreiben legen Zeugnis ab von der regen Verbundenheit zwischen Front und Dorfgemeinschaft!
Der Frost richtet große Schäden an: Die Wintersaat friert teilweise aus, in den Großstädten tritt ein Mangel an Kartoffeln ein, denn die Mieten dürfen wegen der Kälte nicht geöffnet werden, die Wasserstraßen sind monatelang zugefroren und die Eisenbahn ist nicht in der Lage, den Verkehr zu bewältigen, viele Heizungen und Wasserleitungen sind beschädigt und können erst nach Wochen repariert werden, das Wild leidet schreckliche Not; denn der Schnee liegt wochenlang 1/2 m hoch, die Bramau ist drei Monate lang zugefroren, worunter die Wasservögel, die zu Tausenden zu uns gekommen sind, schwer zu leiden haben, die Tauben kommen in die Gärten, um von dem Kohl zu picken.
In vielen Haushaltungen geht die Feurung auf die Neige. Die meisten Schulen werden aus Mangel an Feurung geschlossen. Ich habe die Kinder wochenlang in meiner Wohnung unterrichtet. Erst Mitte März tritt Tauwetter ein und die ganze Menschheit atmet auf!
8.11. Um eine gerechte Verteilung der Lebensmittel und Kleidung für jeden Volksgenossen sicherzustellen, wird von der Regierung sofort das sogenannte Kartensystem eingeführt. Mit großer Sorgfalt werden die Karten monatlich vom Bürgermeister an die Bevölkerung ausgegeben. Jeder Volksgenosse kann auf seinen Karten wöchentlich beziehen ca.: 500 g Fleisch, 250 g Fett, 2000 g Brot, 325 g Zucker und monatlich werden geringe, doch ausreichende Mengen an Reis, Grütze, Kaffee, Tee und dergleichen verteilt. Schwerarbeiter erhalten Zusatzkarten und Reisende und Urlauber beziehen ihre Lebensmittel auf Reisemarken. Einen kleinen Vorteil hat der Gartenbesitzer und insbesondere der Selbstversorger, der nach Einholung einer Schlachtkarte oder eines Mahlscheines und dergleichen sich aus seinen Vorräten versorgt. Die Milch wird auf der Meierei restlos verbuttert, und an die Bevölkerung darf nur „abgerahmte Vollmilch“ abgegeben werden. Eine Ausnahme machen Kranke und kleine Kinder, denen auf Milchkarten Vollmilch verabfolgt werden darf.
[15] Die Regierung hat den jetzigen Krieg kommen sehen und daher die Volksernährung rechtzeitig sichergestellt. Sämtliche leerstehende Läger, Schweineställe und Speicher wurden bereits vor drei bis vier Jahren zwecks Einlagerung von Getreide und Mais beschlagnahmt. In unserer Gemeinde lagerten in den Schweineställen der Bauern Albert Feil und Johannes Kröger größere Roggen- und Maisvorräte.
Kleidung wird einzig auf Kleiderkarte verabfolgt. Diese weist 150 Punkte auf und jedes Kleidungsstück hat einen bestimmten Punktwert: Anzug 80, Schürze 12, Hemd 20, Hose 28, Weste 10, Winterjoppe 60, Wintermantel 120 Punkte u.s.w. Schuhe, Bett- und Tischwäsche werden einzig auf Bezugsscheine, die beim Bürgermeister anzufordern sind, abgegeben. Kinderreiche Familien und landwirtschaftliche Arbeiter werden bei der Ausgabe von Bezugsscheinen von Stiefeln und Schuhen bevorzugt behandelt.
Um den feindlichen Fliegern die Orientierung zu erschweren,wird eine allgemeine Verdunkelung von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang angeordnet. Die Durchführung stößt anfänglich auf große Schwierigkeiten, da die Bevölkerung sie für lächerlich hält. Nach Abhaltung von Kursen, Belehrung durch die Presse und nach Einflug feindlicher Flieger gelangt die Bevölkerung schnell zur Einsicht. In jedem Hause wird eine Hausfeuerwehr gegründet. Auf dem Boden stehen ein Kasten mit Sand, eine Patsche, eine Schaufel und eine Tonne mit Wasser bereit, um abgeworfene feindliche Brandbomben sofort bekämpfen zu können. Die H.J. wird, da viele Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr zum Heeresdienst einberufen sind, im Feuerlöschwesen ausgebildet.
Nach der Niederwerfung Frankreichs nehmen die feindlichen Flieger-Großangriffe auf die deutschen Großstädte und Rüstungsbetriebe von Woche zu Woche an Heftigkeit zu und des Abends hört man im Süden, Norden und Westen das Donnern der „Flak“ und sieht man das Aufblitzen und Krepieren der Geschosse. Nicht selten wird die ganze Gegend durch Raketen, die durch Fallschirme etwa zehn Minuten getragen werden, taghell beleuchtet, um einen sicheren Bombenabwurf zu gewährleisten. Auf Bauerngehöfte, Strohmieten, Tannenwälder u.s.w. werden nicht selten Brandplättchen abgeworfen, die bisher jedoch nur geringen Schaden anrichteten. In der Nacht patrouilliert im Dorfe eine Nachtwache von zwei Mann, die die Verdunkelung zu prüfen und die feindlichen Flieger zu beobachten hat. Um den Schulkindern bei einem unerwarteten Fliegerangriff Schutz zu gewähren, werden auf dem Schulhof Laufgräben ausgehoben. s. S. 270.
[16] Wie an der Front der Soldat, so tut in der Heimat jeder Volksgenosse seine Pflicht und Schuldigkeit. Pflug und Schwert arbeiten Hand in Hand. Der Soldat schützt die Heimat vor Verwüstungen und schenkte uns den deutschen Siedlungs- und Wirtschaftsraum, der für das übervölkerte Vaterland eine dringende Notwendigkeit ist. Der deutsche Bauer sorgt und schafft von morgens früh bis abends spät, um die deutsche Volksernährung sicherzustellen. Es mangelt hier und da an Arbeitskräften, an Pferden u.s.w., doch da der eiserne Wille vorhanden ist, werden sämtliche Schwierigkeiten restlos überwunden. Volksdeutsche aus Jugoslawien, die sich dort vor etwa 150 Jahren ansiedelten, finden in unserer Gemeinde Arbeit, und ebenso stellt das uns befreundete Ungarn Arbeitskräfte zur Verfügung. Die größeren Schulkinder werden zur Arbeit herangezogen und haben durch ihren Fleiß ebenfalls dazu beigetragen, daß der Acker bestellt und die Ernte geborgen worden ist. Nach der Niederwerfung Polens vermittelt das Arbeitsamt arbeitslose Volksdeutsche aus dem Industriegebiet, mit denen die Arbeitgeber jedoch trübe Erfahrungen machen. Die 20 in unserer Gemeinde untergebrachten französischen Kriegsgefangenen gelten dagegen als willige und fleißige Arbeiter.
Zur Aufrüstung und Fortführung des Krieges sind ungeheure Mengen von Rohstoffen erforderlich. Daher wird eine laufende Sammlung von Altmaterial durch die Schuljugend, die H.J. und S.A. angeordnet. Undenkbare Mengen von Alteisen, Lumpen, Papier u.s.w. werden zusammengetragen und der Produktion wieder zugeführt. Zum Geburtstag des Führers findet eine freiwillige Abgabe von Geräten und Schmucksachen aus Kupfer, Bronze, Nickel, Blei und Zinn statt. In unserer kleinen Gemeinde werden ca. 80 kg beim Ortsgruppenleiter Blunck zwecks Weiterleitung eingeliefert. Alte Messing- und Kupferkannen, stark versilberte wertvolle Hochzeitsgeschenke, viele alte Kupfer- und Nickelmünzen werden dem Vaterlande geopfert.
Da unsere Heimat zur gefährdeten Zone gehört, wurden auf Anordnung Hermann Görings sämtliche Schulen am 12. Juli b.a.w. geschlossen und die Sommerferien bis Mitte September verlängert. Der Lehrer und auch die größeren Schulkinder wurden in der Landwirtschaft als Erntehelfer eingesetzt.
Um das Interesse der Schuljugend für die Fliegerei zu fördern, soll in sämtlichen Schulen der Flugzeug-Modellbau betrieben werden. Für die Lehrer wurde daher ein 5-tägiger Kursus in Bad Bramstedt abgehalten, an dem auch Lehrer Mohr [17]teilnahm.
Im Dezember 1940 wird das „alte Schulhaus“ von dem Jagdaufseher Strohbeen an Frau Steinberg für 5.500 RM verkauft.
Zum Weihnachtsfeste 1940 werden – wie in den Vorjahren – die eingezogenen Soldaten mit vielen Paketen aus der Heimat beschert, u.a. sendet auch die N.S.D.A.P. der Ortsgruppe ein schönes Weihnachtspaket, dem ein Brief, unterzeichnet vom Kreisleiter Stiehr, Ortsgruppenleiter Blunck und Ortsgruppenamtsleiter der N.S.V. Mohr beigelegt ist. In dem Schreiben kommt der Dank der Heimat und ihre enge Verbundenheit mit der Front zum Ausdruck. Vielen Feldgrauen ist es vergönnt, das Weihnachtsfest im Kreise ihrer Lieben zu verleben. Überall in den Garnisonen, an der Front und im besetzten Gebiet werden Feiern abgehalten. Der Führer, Rudolf Heß und der Oberbefehlshaber des Heeres Brauchitsch verleben das Fest der Liebe bei ihren Soldaten an der Front.
Weihnachten 1940 sind zum Heeresdienst eingezogen:
Soldat Ernst Studt, Feldpost N. 18327a
" Herbert Böttcher, " 35771
" Heinrich Fengler, " 27008
" Hugo Blunck, " 15935
" Josef Wiebela, " 18230
" Claus Thies, " 082496
Obergefreiter Hans Blunck, " 10114
" Ernst Harbeck, " 11845B
" Ernst Sahling, Nachr.d. Westerland.
" Wilh. Kröger , " 14519
Luftgau Postamt Hbg. I.
Schütze Fritz Fölster, " 05478C
" Johs. Rühmann, " 05478C
" Johs. Kröger, " 05478C
Oberwachtmeister Kurt Mohr, 2. Ers.Batt.A.R. 20 Itzehoe
Wachtmeister Walther Behnke, " 14334
Unteroffizier Ernst Kröger, " 19678
Spn. Heinr. Rühmann. Neumünster
Beschlagschmied Hinrich Kröger, Feld.P. 17917B
Wachtmeister Ernst Kock, 2. Ers.B. A.R. 75 Eberswalde.
Reiter Artur Johannsen, Reiter Reg. 13 Lüneburg
" Hans Karstens, " " " "
Soldat Hans Fölster, FeldP. 18332
Matrose Ernst Fölster, " 33228.
D.R.Kr.Schwester Erna Schnack, " 09407.
Oberwachtmeister Hans Kock,
" Heinr. Kock,
Oberfeldwebel Heinrich Behnke,
Unteroffizier Willi Behnke.
Bem. Ferner waren eingezogen: Hugo Steenbock, Johannes Lohse, Hans Studt und Erhard Plambeck, die jedoch im Laufe des Jahres wegen Erreichung der Altersgrenze aus dem Heeresdienst entlassen wurden.
[18] Rückblick auf die militärische und politische Lage zur Jahreswende 1940/41.
Mit Stolz und engem Interesse verfolgte die Jugend und mit ihr die ganze Bevölkerung unserer Gemeinde die Kriegsereignisse des verflossenen Jahres, die einzig in der Geschichte dastehen. Noch im Frühjahr stand die gesammelte Kraft der deutschen Wehrmacht in und hinter dem Westwall und harrte von Woche zu Woche ungestümer des Befehls zum Angriff.
In der Nacht 8./9. April d.J. fuhren während der ganzen Nacht und am nächsten Morgen motorisierte Truppen durch unser Dorf und in aller Frühe und während der folgenden Tage donnerten hunderte von schwerbeladenen Flugzeugen über unsere Gegend gen Norden. Um zehn Uhr erfuhren wir dann, daß Dänemark und Norwegen von deutschen Truppen besetzt worden seien. Dieses kühne Unternehmen setzte die ganze Welt in Staunen und Verwunderung. Die Genialität der Führung entsprach der Tapferkeit und Widerstandskraft der Truppen und ihrer Befehlshaber. Freilich wären diese Erfolge nicht denkbar gewesen ohne ein Höchstmaß von Sorgfalt bei der Planung und Vorbereitung, sowie ohne den beispiellosen Einsatz der Heimat. Deutsches Soldatentum bewährt sich im Heldenkampf der „Blücher“ wie vor Narvik, Namsos und Andalsnes.
Und dann begann am 10. Mai der Kampf im Westen. Was unsere Truppen an dieser Front leisteten, war fast dazu angetan, den Ruhm unserer Kämpfer im Norden in den Schatten zu stellen. Die Armeen Hollands und Belgiens werden in wenigen Tagen zur Kapitulation gezwungen, das britische Expeditionskorps in überstürzter Flucht unter Zurücklassung der gesamten Waffen und Geräte über den Kanal geworfen, die französische Armee wird in einem unerhörten Siegeslauf vollständig aufgerieben und die für uneinnehmbar gehaltene Maginotlinie durchbrochen. Der vor kurzem noch stärksten Militärmacht Europas bleibt kein anderer Ausweg, als um Waffenstillstand zu bitten.
Seitdem hat die deutsche Wehrmacht vom Nordkap bis zur Pyrenäengrenze eine Front bezogen, die allein dem Entscheidungskampf gegen den letzten Gegner, England, dient. Aus dieser Front heraus fallen die Schläge zur See und in der Luft, greifen wir England an, das noch nie in seiner Geschichte so hart bedrängt worden ist.
Währenddessen hat Deutschland unter seinem genialen Führer Adolf Hitler seine militärischen Erfolge durch eine starke politische Aktivität ergänzt. Das deutsche Volk hat in diesem Jahre ein entscheidendes Stück auf dem Wege des Sieges hinter sich gebracht. Die englischen Trabanten in Europa sind – ausgenommen Griechenland – ausgeschaltet. Der Entscheidungskampf um das [19] englische Mutterland hat sich zur See und in der Luft entscheidend zum Nachteil Englands gewandt. Die Schiffsverluste wachsen von Woche zu Woche. Die kriegswirtschaftlich unentbehrliche Produktion der englischen Industrie schmilzt im raschen Tempo zusammen.
Die innige Verbundenheit zwischen Volk und Führer zeigt sich ganz besonders in den Opfern, die jeder Volksgenosse durch freiwillige Spenden zum Winterhilfswerk und nationalsozialistischer Volkswohlfahrt auf sich nimmt. Die Höhe der Opfer steigt von Jahr zu Jahr und erreicht während des Krieges ihren Höhepunkt. Bis zur Einführung des Kartensystems werden außer der Geld- auch noch bedeutende Sachspenden (Spenden der Landwirtschaft, Pfund- und Kleidersammlung) aufgebracht. Diese bestehen z.B. im Winter 1936/37 in 78 Zentnern Kartoffeln, 35,5 Zentnern Roggen, 24 kg Mehl, 41 kg Kolonialwaren, 6,5 kg Zucker, 13 kg Hülsenfrüchten, 13 kg Fleisch und geräucherte Wurst, 40 Konserven Fleisch, 100 Konserven Gemüse und Obst u.s.w., dazu viele abgetragene, gut erhaltene Kleidungsstücke, die restlos der Kriegsamtsleitung Segeberg zwecks Behebung des Elends in den Notstandsgebieten übersandt wurden.
GeldspendenJahr W.H.W. N.S.V. D.R.Kreuz
RM Pf RM Pf RM Pf
1934/35 570 12 104 89
1935/36 470 30 109 08
1936/37 344 20 80 57
1937/38 537 40 60 68
1938/39 663 47 145 19
1939/40 1.174 20 167 42 894 10
1940/41 2.076 39 1.112 30
[20] Der Gemeindeetat des Jahres 1940/41 beläuft sich in Einnahme und Ausgabe auf 10.560 RM. In dieser Summe ist die Kriegssteuer der Gemeinde, die 1939 noch 2.025 RM betrug und für 1940 auf 1.100 RM ermäßigt wurde, enthalten.
Wie im Vorjahre, haben auch in diesem Jahre die Bauern unserer Gemeinde Naturalien an die Heeresverwaltung zu liefern. Nach Angabe des Bürgermeisters Feil betragen diese: 414 Zentner Hafer, 200 Zentner Stroh und 320 Zentner Heu. Da die Haferernte im Herbst 1940 äußerst schlecht war – Trockenheit – werden die Bauern kaum in der Lage sein, die Hafermengen zu liefern.
Um Kinderreiche Mütter zu ehren, stiftete der Führer das „Mütterehrenkreuz“, das in drei Stufen – Gold, Silber und Bronze – verliehen wird. Folgende Mütter werden seit 1938 mit dem Ehrenkreuz ausgezeichnet:
Gold Dora Fölster, Ehefrau d. verstorbenen Kätners Markus Fölster,
m. Ida Studt, " " Erbhofbauern Johannes Studt,
Kr. Helene Kröger, " " " Johannes Kröger,
Maria Blunck, " " Arbeiters Wilhelm Blunck,
Silber Dora Fölster, " " Kätners Rudolf Fölster,
m. Helene Studt, " " Rentners Markus Studt, gest. 1925,
Kr. Maria Steenbock, " " verst.Gastw. Peter Steenbock,gest.1939,
Martha Behnke, " " Wegewärters Johannes Behnke,
Anna Johannsen, " " verst.Landmannes Wilhelm Kock, 4 S, 1 T,
verw. Kock, zweite Ehe mit Erbhofbauer
August Johannsen, 1 S.
Bronze Dora Blunck, " " Landmannes (gest.1914) Johannes Schnack,
m. 4 T,verw.Schnack, zweite Ehe Erbhofbauer
Kr. Gustav Blunck, Ehe kinderlos.
Anne Rohwedder, Ehefr. " Landwirtes Rohwedder aus Pofeld, 4 K,
Auguste Tonder, " " Erbhofbauern Hinrich Tonder, 5 K,
Alma Karstens, " " " Johannes Karstens, 4 K
Ida Feil, " " " Albert Feil, 4 K,
Helene Rühmann, " " " Hans Rühmann, 4 K,
Alma Thies, " " verst. Landwirtes Hermann Thies, 4 K,
Anne Schnack, " " Erbhofbauern Heinrich Schnack, 4 K,
[21] Elise Harbeck, " " Erbhofbauern Heinrich Harbeck, 4 K,
Frida Feil, " " verst. Landwirtes Wilhelm Rühmann,4 K,
verw. Rühmann, zweite Ehe " Karl Feil,
Ehe kinderlos.
Unsere nicht so waldreiche Gemarkung hatte nach der Machtübernahme im Jahre 1933 noch etwa 30 ha Wälder, die der Nachwelt restlos erhalten bleiben sollen. Sie sind unter Aufsicht des Staates gestellt und müssen auf Anordnung der Forstverwaltung von den Besitzern gehegt und gepflegt werden. Die Waldbesitzer unserer Gemeinde sind angewiesen und verpflichtet, im Laufe des Winters 1940/41 100 Festmeter Holz zu schlagen und der Volkswirtschaft zuzuführen.
Auf der Zuchtviehauktion in Neumünster kaufte die Stierhaltungsgenossenschaft zu Föhrden Barl einen wertvollen, gekörten, einjährigen rotbunten Zuchtbullen für 1.500 RM. Der beste Zuchtbulle erzielte auf der Auktion einen Preis von 9.000 RM (1. November 1940).
[Es folgt eingeschoben die Abschrift einer Schülerin:]
Der Kriegswinter 1940/41 war annähernd so hart wie der des Vorjahres. Der Frost setzte bereits Mitte Dezember ein. Die Kälte nahm von Woche zu Woche zu und erreichte ihren Höhepunkte Mitte Januar. Nicht selten zeigte das Thermometer einen Tiefstand von 20°deg; unter Null.
Mitte Januar wurde die Erde alsdann in eine 30-50 cm hohe Schneedecke eingehüllt, deren obere Schicht sich nach eintägigem Tauwetter recht bald in eine zwei cm dicke Eisschicht verwandelte. Entsetzlich hatte das Wild, das [22] nirgends Nahrung finden konnte, zu leiden. Die Fasanen suchten die von den Jägern im Herbste errichteten Futterhütten auf. Die Rebhühner, Tauben und Hasen stellten sich zahlreich in den Gärten ein, um am Grünkohl ihren Hunger zu stillen. Manches Stück Rehwild fand in der bitteren Kälte den Tod. Am 8. Februar trat dann plötzlich Tauwetter ein, und die ganze Natur atmete auf.
Eine schwere Heimsuchung
Die Temperatur war so milde, daß der Schnee in wenigen Stunden geschmolzen war. Ungeheure Wassermassen strömten der Au zu, so daß sich das Wiesental in kurzer Zeit in ein wogendes Meer verwandelte, aus dem hier und da ein Busch oder Pfahl herausragte.
In der Nacht vom 9./10. Februar werden die Anwohner der Bramau durch ein mächtiges Dröhnen und Krachen geweckt. Auf der Au und im Wiesental herrscht ein schrecklicher Eisgang. Große dicke Eisschollen prallen mit donnerartigem Getöse gegen die Pfeiler der Brücke.
Ich begebe mich mit den Kindern an Ort und Stelle, um diesem grausigen Schauspiel beizuwohnen. Das Wasser steigt von Minute zu Minute, so daß die Eisschollen recht bald kaum noch Platz haben, unter der Brücke hindurchzugleiten. Mit allen Mitteln versuchte man zu verhindern, daß die Schollen sich festsetzen oder aufrichten und so den Wassserlauf versperren. Immer höher steigt das Wasser und bespült bereits an einzelnen Stellen die Chaussee. Die Strömung und auch der Eisgang nehmen dauernd zu. Die Schotten der Schleuse, Einfriedigungspfähle, Latten und Bretter [23] werden von den Wassermassen stromabwärts fortgeführt. Schon stoßen die Eisschollen gegen die eisernen Träger der Brücke. Durch den dauernden Anprall der Eisschollen muß sich einer der mächtigen, in Zement gemauerten Pfeiler der Brücke, dessen Gewicht auf 40.000 kg geschätzt wird, gelöst haben und wird von den Eismassen fortgerissen. Damit ist die größte Gefahr beseitigt, denn nunmehr hat das Wasser freien Lauf.
Nach 24-stündigem Eisgang beginnt der Wasserstand zu sinken.
Schreckliche Verheerungen hat der Eisgang in Wrist-Stellau angerichtet. Ich begebe mich an Ort und Stelle, um mir dieses nie erlebte Schauspiel anzusehen. Schon der Eisgang im Wiesental bietet einen schaurigen Anblick. Das Wasser plätschert an der Kurve am Eingang von Wrist bereits am Chausseerande. Die tieferliegenden Häuser, in die das Wasser bereits eingedrungen ist, müssen geräumt werden. Die Bauern hatten es im Herbste versäumt, die durch den Deich führenden Furten („Stöps“) mit Sand zu dichten, und so sind die Wassermassen nach Wrist hineingeströmt. Die Bramaubrücke wird dauernd von den mächtigen Eisschollen bedroht. Das Militär, das in der Gemeinde einquartiert ist, und die Feuerwehr sind bei den Rettungsarbeiten eingesetzt. Die vielen Fuhrwerke können kaum soviel Sand herbeischaffen, um die schadhaften Stellen im Deiche zu dichten. Bei dem Bauern Jaswick strömen ungeheure Wassermassen durch die Einfahrt zur Au, und in wenigen Stunden hat sich der östliche Teil der Gemarkung Stellau bis zur Chaussee Stellau-Bokel [24] mit Wassermassen gefüllt. In den Häusern am Deich steigt das Wasser von Stunde zu Stunde. Menschen und Tiere werden durch eine starke Zugmaschine des Militärs in Sicherheit gebracht. Das Wasser flutet im breiten Lauf bald über die Chaussee. Sollte das Wasser noch um zehn Zentimeter steigen, dann wird es unmöglich sein, eine Katastrophe zu verhindern, und ganz Wrist wird überflutet werden. Doch das Wasser hat seinen höchsten Stand erreicht, und die größte Gefahr ist vorüber! Diese Überschwemmung gehört wohl zu den größten aller Zeiten.
Die Ursache der Katastrophe ist in der Urbarmachung der Moore, den Kultivierungsarbeiten im oberen Stromgebiet der Bramau und in der Geradelegung der Wasserläufe zu suchen. (Dorfb. 13/II. 41)
Föhrden Barl, 13.II.1941 Mohr (Abschrift v. Annelise Petterson, Schülerin.)
[Es folgt wieder von W. Mohr geschriebener Text]
[25] Die Spar- und Darlehnskasse, e.G.m.u.H.
Daß die Bewohner unserer Gemeinde die schweren Zeiten der Geldentwertung und den Niedergang der deutschen Wirtschaft so glücklich überstanden haben, so daß jedem Volksgenossen seine heimatliche Scholle erhalten geblieben ist, verdanken wir neben dem Fleiß unserer Bauern, der nationalsozialistischen Gesetzgebung insbesondere unserer Spar- und Darlehnskasse. In ihrem Geld- und Warenumsatz, ihren Jahresbilanzen, den Spareinlagen und der ausgewiesenen Gewinne bzw. Verluste spiegelt sich die Wirtschaft unserer Gemeinde in den verflossenen 20 Jahren wieder.
Die Spar- und Darlehnskasse wurde am 7. November 1921 auf Wunsch einiger Einwohner unseres Dorfes durch den Verband der Schleswig-Holsteinischen Genossenschaften in Kiel ins Leben gerufen. Auf der Gründungsversammlung traten zunächst 18 Mitglieder der Genossenschaft bei: der Gastwirt Johannes Blöcker, der Lehrer Wilhelm Mohr, der Landmann Johannes Harbeck, der Gastwirt Peter Steenbock, der Rentner Markus Studt, der Händler und Landmann Heinrich Hahn, der Landmann Heinrich Schnack, der Landmann Johannes Studt, der Landmann August Johannsen, der Landmann Wilhelm Rühmann, der Landmann August Meier, der Landmann Johannes Karstens, der Kätner Karl Plambeck, der Kätner [26] Heinrich Zornig, der Landmann Gustav Blunk, der Landmann Heinrich Reimers, der Kätner Rudolf Fölster und der Landmann Markus Steffens – alle wohnhaft in Föhrden Barl.
Zum Vorsitzenden wurde Johannes Harbeck, zu seinem Stellvertreter August Johannsen, zum Geschäftsführer der Rentner Markus Studt und in den Aufsichtsrat der Lehrer Wilhelm Mohr, der Gastwirt Johannes Blöcker und der Kätner Karl Plambeck gewählt. Die Eintragung in das Genossenschaftsregister beim Amtsgericht in Bad Bramstedt erfolgte am 14.12.1921. Bald nach der Gründung erklärten weitere Mitglieder ihren Beitritt. Der Landmann Heinrich Harbeck, der Altenteiler Claus Harbeck, der Landmann Ernst Runge, der Landmann Wilhelm Runge, der Landmann Karl Feil, der Landmann Johannes Kröger und der Kätner Markus Fölster.
Nach Ableben des Rentners Markus Studt wurde durch die Mitgliederversammlung vom 15.5.1922 der Lehrer Wilhelm Mohr zum Geschäftsführer und für diesen der Landmann Karl Feil in den Aufsichtsrat gewählt. Wir erlebten damals die größte Geldentwertung aller Zeiten. Darüber berichtet uns Lehrer Mohr in seinem Aufsatz: „Ruhrkampf und Geldentwertung“. Die Inflation spiegelt sich besonders in der dauernden Erhöhung der Geschäftsguthaben wieder. Diese wurden bereits am 6.10.1922 auf 10.000 RM heraufgesetzt, mußten bereits am 17.11.1922 auf 100.000 RM, [27] am 14.7.1923 auf 1 Million und dann schon wieder am 22.9.1923 auf 20 Milliarden Mark erhöht werden. Die Zinsen für Guthaben in laufender Rechnung betrugen 18%, für festgelegte Gelder wurden 24% vergütet. Der Vorstand und Aufsichtsrat waren befugt, Kredite bis zu 50 bzw. 100 Milliarden Mark zu bewilligen. Ende Oktober 1923 erreichte die Geldentwertung ihren Höhepunkt. Nach Einführung der Gold- und Rentenmark erhielten wir zum 1. November 1923 stabile Zahlungsmittel. Eine Billion Papiermark wurde einer Rentenmark gleichgerechnet.
Von der Mitgliederversammlung am 19.12.1923 wurde nunmehr das Geschäftsguthaben der einzelnen Mitglieder auf 200 Rentenmark festgesetzt. Da man dem neuen Zahlungsmittel kein volles Vertrauen schenkte, wurde der Kredit in „Roggenwert“ bewilligt und zwar können durch Vorstand und Aufsichtsrat Kredite von 300 bzw. 900 Zentner „Roggenwert“ bereitgestellt werden. Die Gesamtanleihegrenze darf 4.000 Zentner „Roggenwert“ nicht überschreiten.
Am 26.11.1924 wurde zum ersten Mal die Golderöffnungsbilanz bekanntgegeben. Besitz und Schulden betrugen 37.711,01 RM. Am 26.11.1924 wird die vom Vorstand und Aufsichtsrat zu bewilligende Kreditgrenze auf 3.000 bzw. 15.000 Goldmark festgesetzt. Die Höhe des Gesamtanleihebetrages auf 80.000 Goldmark.
In treuer Pflichterfüllung waren Vorstand [28] und Aufsichtsrat bemüht, Diener der Allgemeinheit zu sein, und so genoß die Genossenschaft bei ihren Mitgliedern das größte Vertrauen. Die Umsätze im Geld- und Warengeschäft nehmen von Jahr zu Jahr zu. Der höchste Warenumsatz wurde im Jahre 1928/29 erreicht. Derselbe betrug wertmäßig 3.718.293,98 RM.
Einen argen Rückschlag erlitt die Genossenschaft im Geschäftsjahr 1930/31 durch den Brand der Mußfeld’schen Mühle in Wirst. In der Mühle lagerte ein großer Teil Futtermittel. Auch war den Gebr. Mußfeld von der Kasse ein größerer Waren- und Wechselkredit gegeben, wofür allerdings Bürgschaft geleistet war. Als die Mühle nun einem Großfeuer zum Opfer fiel, wurde das Warenlager ein Raub der Flammen. Wie sich dann herausstellte, hatte M. einen Teil der Lagerware für sich verbraucht, und so wurde die uns zustehende Versicherungssumme sehr stark gekürzt. M. stand im Verdacht, Brandstiftung begangen zu haben und geriet in Untersuchungshaft, mußte dann aber wegen mangelnder Beweise freigesprochen werden. Die Sparkasse erlitt einen direkten Schaden von 900 RM nebst Zinsen des angelegten Kapitals.
Nunmehr wurde Gustav Blunk – Gebr. Schnack mit der Vermahlung des Futtergetreides der Genossenschaft beauftragt.
[29] Im Geschäftsjahr 1933/34 hatte die Spar- und Darlehnskasse immerhin noch einen Warenumsatz von 9.073 Zentner in Futtermittel, 5.691 Zentner in Kunstdünger u.v.m.
Als infolge des Brandes der Mußfeld’schen Mühle einige zaghafte Mitglieder im Jahr 1932 ihren Austritt erklärten, mußten die im Besitze der Kasse befindlichen Goldpfandbriefe – 16.000 Goldmark – mit einem Kurs von 58,5% in die Bilanz eingetragen werden, ferner wurden die eventuell entstehenden Verluste, die durch unsichere Forderungen und im Warengeschäft erwachsen könnten, in Summa mit 7.375,30 RM eingesetzt. Diese Verluste mußten durch die vorhandenen Reserven und die Geschäftsguthaben der Mitglieder gedeckt werden. So kam es, daß die ausscheidenden Genossen ihre Geschäftsguthaben verloren. Aus dem Gewinn, der beim Verkauf der Wertpapiere erzielt wurde, konnten später die Geschäftsguthaben der treuen Mitglieder wieder aufgefüllt werden.
Infolge der schlechten Wirtschaftslage nahm die Verschuldung der Landwirtschaft dauernd zu, so daß die Genossenschaft genötigt war, einigen Mitgliedern den Kredit zu sperren, um nötigenfalls zwangsweise gegen die Schuldner vorzugehen. Da kam mit der Machtübernahme der N.S.D.A.P. der Umschwung. Um die Volksernährung sicherzustellen, wurden die überschuldeten Bauernhöfe unter staatlichen Schutz gestellt, [30] im Laufe der nächsten Jahre umgeschuldet und zu Erbhöfen erklärt. Um diese Entschuldung ohne Gefährdung der Sparkasse durchführen zu können, wurde vom Reiche eine einmalige Genossenschaftsbeihilfe in Höhe von 16.200 RM bewilligt. Im Jahre 1940 war die Umschuldung restlos durchgeführt.
Die Spar- und Darlehnskasse war seit ihrem Bestehen zu jeder Zeit bereit, aus ihren Überschüssen für gute Zwecke Gelder bereitzustellen. In einer Mitgliederversammlung am 22.9.1925 wurden dem Turnverein Föhrden Barl/Hagen Mittel zur Beschaffung von Turngeräten bewilligt. Um den Sparsinn der Jugend zu fördern, schenkte die Sparkasse jedem Sparer bei der ersten Einlage fünf RM!
Für treue Dienste wurden nach fünf- und zehnjähriger Dienstzeit bei ein und demselben Besitzer Ehrenurkunden verliehen und Geldgeschenke in Höhe von 25 bzw. 50 RM überreicht. Dadurch versuchte man, die landwirtschaftlichen Arbeiter seßhaft zu machen. Um den Sparsinn der Jugend zu fördern, wurden an die Kinder schön geformte Sparbüchsen ausgegeben, die nur durch den Geschäftsführer der Kasse geöffnet werden können. Beim Gastwirt Blöcker wird eine geeichte Viehwaage aufgestellt. Dadurch soll den Bauern die Ablieferung von Vieh erleichtert werden. Leider wird die Waage nicht genügend benützt. Zum Kindervergnügen stellte die [31] Sparkasse regelmäßig die beiden ersten Gewinne – meistens zwei Uhren mit Widmung – zur Verfügung. Um die Mitglieder mit der engeren Heimat und deren Schönheiten bekannt zu machen, wurde in jedem Jahr eine größere Autofahrt unternommen. Diese Fahrten führten uns an die Lübecker Bucht, nach Mölln, in den Sachsenwald, ins östliche Holstein, nach Büsum, in den Adolf-Hitler-Koog u.s.w. So war die Sparkasse seit ihrem Bestehen bemüht, der Allgemeinheit zu dienen und versuchte während einer Zeit, in der unser Vaterland geknebelt am Boden lag, eine wahre Volksgemeinschaft aufzurichten.
Leider fand die uneigennützige Arbeit des Vorstandes und Aufsichtsrates nicht immer den gebührenden Dank. Wegen persönlicher Meinungsverschiedenheiten, Schulfragen, Rückzahlungen von Kreditüberschreitungen und Dickköpfigkeit kam es dann und wann zu Reibereien, die den Austritt einzelner Mitglieder zur Folge hatten.
Wir wollen hoffen und wünschen, daß die Spar- und Darlehnskasse noch viele Jahre zum Segen der Gemeinde weiter bestehen möge.
Organe der Spar- und Darlehnskasse:
a) Vorstand
Erster Vorsitzender: 1921 - 1939 Johannes Harbeck,
1939 - Albert Feil,
Zweiter " 1921 - 1926 August Johannsen,
1926 - Johannes Karstens,
Geschäftsführer: 1921 - 1922 Markus Studt,
[32] 1922 - 1936 Wilhelm Mohr,
1936 - Hans Schnack,
b) Aufsichtsrat
Vorsitzender 1921/22 Wilhelm Mohr,
1922 - 1928 Karl Feil,
1928 - Heinrich Harbeck,
Beisitzer: 1921 - 1928 Johann Blöcker u. Karl Plambeck
1928 - 1929 Gustav Blunk, J. Kröger,
1929 - 1932 Wilhelm Runge,
1929 - 1936 Heinrich Schnack,
1936 - 1938 Albert Feil,
1936 Erhard Plambeck,
1938 Heinrich Rühmann.
—————————————–
[33] Sommer 1941
Obgleich die Einberufungen zur Wehrmacht immer zahlreicher werden, hat kein landwirtschaftlicher Betrieb unter Mangel an Arbeitskräften zu leiden. Durch das Arbeitsamt werden hinreichend kriegsgefangene Franzosen und freie Arbeiter aus Polen zur Verfügung gestellt. Wenn auch die Kunstdüngerzuteilung stark beschränkt werden muß, so werden die Felder wie in Friedenszeiten rechtzeitig und ordentlich bestellt. Frauen und größere Kinder helfen überall, wo es ihnen möglich ist, und auch die Lehrer und Beamten, H.J. und B.d.M. folgen gerne dem Rufe des Führers, während der Ferien ihre Arbeitskraft der Landwirtschaft zur Verfügung zu stellen, damit die Volksernährung des gesamten Volkes gewährleistet wird.
Die Wiesen liefern einen lohnenden Heuertrag, der auch schnell und gut geborgen wird. Durch die langanhaltende Trockenheit im Juni/Juli haben die Getreidefelder schwer zu leiden. Hafer und Buchweizen vertrocknen auf dem Halm und der Roggen wird notreif, so daß die Erträge weit unter normal gelten. Die Kartoffeln beginnen nach einer längeren Regenperiode in der ersten Hälfte des Monats August nochmals zu wachsen, wodurch deren Lagerfähigkeit stark beeinträchtigt wird. Die Weiden halten im allgemeinen der Trockenheit stand. Dank der recht guten Heu- und Rübenernte wird es den Bauern unserer Gemeinde möglich sein, ihr Vieh – wenn auch ohne Kraftfutter – durch den Winter zu bringen. Die Bauern sind verpflichtet, ihre Milch, ihr Fettvieh, den Roggen, die Eier u.s.w., soweit diese Produkte nicht beschränkt im Haushalt Verwendung finden, restlos abzuliefern. Ja, ihnen wird noch zugemutet, Heu, Stroh und Hafer an die Wehrmacht abzugeben, wovon sie erst in letzter Stunde entbunden wurden. In Gebieten mit schweren Böden war die Getreideernte sehr gut. Aus welchem Grunde erfolgte keine gerechte Ver- bzw. Zuteilung des Kraftfutters? M.E. hat die Leitung der Orts-, Kreis- und Landesbauernschaft gründlich versagt!
Die Heimat bemüht sich, der Front zu dienen und das Los unserer tapferen Soldaten zu erleichtern. Briefe und Päckchen wandern täglich zur Front, so daß die Post es kaum bewältigen kann, die vielen Sendungen zu befördern. Die sogenannten „Feldpostmarder“ werden mit dem Tode bestraft .
[34] Nicht selten wird unser Dorf des Nachts von feindlichen Bombengeschwadern, die Angriffe auf Hamburg und Kiel durchführen, überflogen. Bei Verfolgung durch Nachtjäger oder nach Beschädigung durch die Flak werfen die Flugzeuge vorzeitig ihre Spreng- und Brandbomben ab. Kurz nacheinander werden in unmittelbarer Nähe des Dorfes, auf „Wieten Moos“ und auf „Old Föhrden“ Sprengbomben und im „Bargholz“ Brandbomben geworfen. Durch ein nach hier entsandtes Sprengkommando aus Lübeck werden wenige Tage später die Blindgänger mit Erde abgedeckt. Durch den Landrat wird angeordnet, daß die Gemeinden „Brandwachen“ einrichten. In unserer Gemeinde besteht diese Wache aus zwei Mann, die während der festgelegten Verdunkelungszeit ihre Rundgänge im Dorfe machen. Jeder Volksgenosse im Alter von 15 – 60 Jahren wird zu diesem Ehrendienst herangezogen.
Mit regem Interesse werden die Kriegsereignisse auf dem Balkan und auf den Weltmeeren, das Heldentum unserer Fallschirmjäger auf Kreta und die Tapferkeit und der Opfermut unserer siegreichen Truppen im Osten verfolgt. Jeder in der Heimat blickt mit stolzer Siegeszuversicht in die Zukunft und schreckt vor keinem Opfer zurück, das das Los unserer tapferen Soldaten bessern könnte. Dies zeigt sich in den Spenden für das „Deutsche Rote Kreuz“. Bei einer Einwohnerzahl von z.Zt. 165 Einwohnern spendet die Gemeinde im Laufe des Sommers 1.112,30 RM.
Im Herbst 1941 wird der Soldat Claus Thies vor Leningrad verwundet. Wegen besonderer Tapferkeit wird der Wachtmeister Walter Behnke, Sohn des Wegewärters Johannes Behnke, mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse ausgezeichnet.
Winter 1941/42.
Wir haben heute den 7. März 1942. Noch immer herrscht eine grimmige Kälte und das Thermometer zeigt einen Tiefstand von 15 – 20° unter Null. Ein schneidender Wind pfeift aus dem Osten. Die Pumpen und Wasserleitungen sind größtenteils eingefroren. Meine Frau kommt soeben von unserem Nachbarn, dem Bauern Johannes Harbeck, der erzählte, daß den Schweinen das Futter im Trog gefroren sei. Fast 2 1/2 Monate ist nunmehr die Bramau zugefroren.
[35] Schon seit Januar ist die Erde in eine ½ bis 1 m hohe Schneedecke gehüllt. Kriegsgefangene und Polen mußten tagelang Schneeschaufeln, um die Straßen wieder passierbar zu machen. Nicht selten bleiben Fuhrwerke und Lastkraftwagen in den Schneewehen stecken! Das Wild leidet große Not und hat sich schon seit Wochen in die Nähe der Wohnungen begeben, um in den Gärten seinen Hunger zu stillen. Der Kreisjägermeister ruft die Jäger und Bauern zur Wildfütterung auf. Doch womit? Denn die allermeisten Bauern haben kaum genügend Futter für ihr Vieh und das Getreide ist für die Volksernährung dringend nötig und daher ablieferungspflichtig. 10. März Tauwetter!
Seit dem 15. Februar mußte der Unterricht eingestellt werden, da die Schulfeurung vom Wirtschaftsamt beschlagnahmt wurde. Die Kinder kommen jeden Morgen 1 ½ Stunden zur Schule, um ihre Hausarbeit vorzuzeigen und werden dann möglichst bald wieder entlassen. Voll Mitleid und inniger Dankbarkeit gedenkt die Heimat ihrer tapferen Soldaten im fernen Osten, die dort trotz der furchtbaren Kälte und schweren Kämpfen in Schnee und Eis ausharren und die Heimat beschützen. Mit Bewunderung und der festen Zuversicht auf den Endsieg verfolgen wir die großen Erfolge unseres neuen Bundesgenossen im fernen Ostasien. Niederlage auf Niederlage müssen hier unsere Feinde einstecken. Über Singapur und den Philippinen u.s.w. weht bereits die japanische Flagge, schon klopfen die Waffen Japans an die Tore Australiens und Indiens!
Die Lebensmittelzuteilung an die Bevölkerung ist kaum ausreichend, doch richtet sich jeder damit ein und gibt sich zufrieden. Presse, Rundfunk und Schulung sorgen für Aufklärung und heben die Stimmung im Volke, das nunmehr zu einer innigen Volksgemeinschaft verwachsen ist. Diese zeigt sich bei der Pelz- und Wollsachensammlung, zu der der Führer die Heimat Mitte Dezember aufruft. Jeder hat die Stimme der Ostfront vernommen und gibt gerne und mit Freuden. Unbemittelte alte Frauen, die durch das W.H.W. unterstützt werden, wollen nicht hinter den begüterten Volksgenossen zurückstehen und legen willig ihre Pelze, Strümpfe und dergleichen auf den Altar des Vaterlandes. Nur bei dem Bauern Hinrich Schuldt, Heidkaten, klopfen die Sammler vergeblich an die Tür. Die Spende, die durch die Partei durchgeführt wurde, erbrachte in unserer Ortsgruppe mit 39 Haushaltungen 95 Einzelstücke, darunter Fußsäcke, wertvolle Pelze, 15 Paar Strümpfe und dergleichen mehr.
[36] Rege Arbeit leistet die Frauenschaft unter der Leitung von Frau Minna Schnack. U.a. wird eine Flaschen- und Lumpensammlung durchgeführt. Rund 300 Flaschen können der Wehrmacht übergeben und viele wertvolle alte Wollsachen der Verarbeitung zugeführt werden. Viele Konserven mit Gemüse und Fleisch, aus Abfallstoffen hergestellte Hausschuhe und Pantoffeln, Flaschen mit Fruchtsaft u.s.w. werden dem Lazarett in Bad Bramstedt (Kurhaus), in dem z.Zt. 500 Verwundete mit schweren Frostschäden untergebracht sind, zugeleitet.
Das W.H.W. sorgt für Notleidende, insbesondere für die Alten unserer Gemeinde. Jeder Volksgenosse soll auf Anweisung des Führers in der Lage sein, die Lebensmittel, Kleidung, Feurung (und Miete), soweit ihm diese auf Karte zustehen, zu kaufen. Im Laufe des Winters gelangten 845 RM – Wertgutscheine – zur Ausgabe. Durch Sammlungen werden dem W.H.W. wiederum 2.627,- RM zur Verfügung gestellt.
Die Schuljugend beteiligt sich eifrig an der Altmaterialsammlung und ist bemüht, hierdurch dem Vaterlande zu dienen. Von 1.4. bis 31.12.1941 gelangen zur Ablieferung: 152 kg Knochen, 86 kg Lumpen, 586 kg Papier, 2.380 kg Schrott, 27 kg Sonstiges, 141 kg Gummi.
Um eine gerechte Verteilung der Rauchwaren sicherzustellen, wurde ab 15.2.1941 die Raucherkarte eingeführt. Auf einen Tagesabschnitt kann man drei Zigaretten oder ein Zigarillo, auf zwei Tagesabschnitte eine Zigarre und auf zehn Abschnitte 50 g Tabak beziehen. Für starke Raucher wenig genug! Auch Frauen über 25 Jahre erhalten auf Antrag eine Raucherkarte, die jedoch nur zum Bezuge der Hälfte der Rauchwaren berechtigt.
Am 3.12.1941 fand eine Viehzählung statt, die in unserer Gemeinde folgendes Ergebnis zeigte: 35 Betriebe mit 118 Pferden, 818 Rindern – darunter 281 Milchkühe -, 14 Schafen, 195 Schweinen, 3 Ziegen, 796 Hühnern, 51 Gänsen, 14 Enten, 18 Bienenvölkern.
Gelegentlich der Schweinezählung am 5.3.1942 wurden in 27 Betrieben nur noch 81 Schweine gezählt.
Am 1. Januar 1942 ging das Ortsnetz mit sämtlichen Hausanschlüssen für 4.000 RM an die Strom-Versorgungs-Gesellschaft in Rendsburg über.
Die Gemeindevertretung beschloß die Anschaffung einer Motorspritze – Preis 5.500 RM.
[37] Mitte Februar 1942 wird durch die Luftwaffe ein Scheinwerfer und ein Horchgerät, zu denen eine Zweigleitung unseres Ortsnetzes führt, auf der sogenannten „Damkoppel“ des Bauern Johs. Harbeck aufgestellt. Die zwölf Mannschaften sind in Baracken untergebracht und müssen sich selbst verpflegen.
Der Rektor i.R. Harbeck auf Gayen wird mit meiner Zustimmung passende Abschnitte aus der Föhrdener Schulchronik in seinem Buche „Chronik des Kirchspiels Bad Bramstedt“ veröffentlichen!
Wie bereits erwähnt, betrug die Gesamtspende der Ortsgruppe mit z.Zt. 159 Einwohnern – zum W.H.W. 1941/42 – 2.627,- RM. In jedem Monat fanden meistens drei Sammlungen statt. Um der Nachwelt die Opferfreudigkeit der einzelnen Vg. zu zeigen, bringe ich eine Abschrift der Haussammelliste der Opfersonntage W.H.W. 1941/42.
Name des Spenders Beruf Sept.Okt. Nov. Dez. Jan. Febr.März
Hausgemeinschaft RM RM RM RM RM RM RM
Hans Rühmann Bauer 4,– 3,– 4,– 4,– 4,– 4,– 4,–
Johs. Rühmann “ 1,50 2,– 2,– 2,– 2,– 1,50 1,50
Fr. Fölster “ 4,– 4,– 4,– 3,– 4,– 3,– 3,–
Hans Studt “ 2,– 2,30 2,30 2,30 2,– 1,50 1,50
Schwartzkopff “ 3,50 3,– 3,– 3,– 2,– 4,– 2,–
2,–
Prinz
G. Blunck “ 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– 3,–
Steinberg/Mohr Arbeiter 2,50 1,50 1,50 — 1,50 1,50 1,50
Herbert Schnack Bauer 6,– 5,– 4,– 4,– 4,– 4,– 4,–
Hans Schnack “ 3,30 2,30 2,30 2,30 2,30 2,– 2,–
Heinrich Schnack “ 3,50 2,50 2,50 2,– 2,50 2,– 2,50
Heinrich Reimers “ 5,– 5,– 4,60 4,– 4,50 4,– 4,–
Hermann Blöcker Gastwirt 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,–
Johs. Harbeck Bauer 4,– 3,50 4,– 3,– 4,– 3,– 3,50
Heinrich Harbeck “ 5,– 2,– 3,– 4,– 3,– 4,– 2,50
Wilh. Mohr Lehrer 4,– 4,– 4,– 5,– 5,– 5,– 5,–
[38] Hel. Studt Rentner 0,30 0,60 0,40 0,30 0,60 0,50 0,30
Johs. Lucht E-Beamter 2,– — 2,– 1,– — 1,– 1,–
Herbert Mehr Angestellter — 0,50 0,30 — 1,– — 1,50
Friedrich Seider Bauer 5,– 5,– 3,50 3,50 3,50 3,– 3,50
Hinrich Schuldt “ 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,50
Sparkasse — 5,– 5,– 5,– 5,– 5,– leer —
August Johannsen Bauer 4,– 4,– 4,– 4,– 4,– 3,– 3,–
Johs. Karstens “ 4,– 4,– 4,– 5,– 4,– 4,– 4,–
Rudolf Fölster Kätner 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
Erhard Plambeck “ 2,– 2,– 2,– 3,– 2,– 2,– 1,50
Alma Thies Bauer 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– 3,–
Albert Feil “ 4,– 4,– 4,50 7,– 5,50 4,– 4,–
Johs. Lohse “ 7,50 7,– 7,– 7,– 7,– 7,– 10,–
Wilh. Runge Altenteiler 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– 3,– }
Johs. Kröger Bauer 5,– 5,– 5,– 5,– 5,– 5,– 5,–
Johs. Behnke Wegewärter 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,–
Hugo Steenbock Gastwirt 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Bernhard Feil Bauer 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,–
Martin Kelting “ 4,– 4,– 4,– 4,– 4,– 4,– 5,–
Heinrich Rühmann “ 1,– 1,– 1,– 2,– 1,– 1,– 1,–
Markus Steffens Altenteiler 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– }7,–
Wilh. Krohn Bauer 5,– 5,– 5,– 6,– {6,– 6,–
Hinrich Tonder “ 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,– 2,–
u.a. Karl Feil “ 1,– 1,– 1,– 2,– 1,– 1,– 0,50
“ 0,40 1,– 1,– 1,– 1,– 1,– 1,–
___________________________________________________________________________
[Sept. Okt. Nov. Dez. Jan. Febr. März]
118,50 107,60 111,90 116,10 111,40 101,50 106,80
Sammler
Johannsen Hs.Studt E.Plambeck Lohse B.Feil Kelting Hg.Steenbock
Hs.Rühmann R.Fölster Schwartzkopf H.Harbeck J.Harbeck Reimers Hr. Schuldt.
[39] Am 21. März wurden nach beendeter achtjähriger Schulzeit ein Knabe und zwei Mädchen entlassen. In seiner Abschiedsrede gedachte der Lehrer der in ewiger Erinnerung bleibenden Schulzeit, in die die größten Ereignisse der deutschen Geschichte aller Zeiten fallen. Nunmehr gilt es, durch Fleiß, Opferbereitschaft, Treue und Gehorsam dem Vaterlande in größter Pflichterfüllung zu dienen. Nicht nach Stand und Besitz sind die Menschen einzuschätzen, sondern nach ihren Leistungen im Dienste für Volk und Führer! – Auf Gesunderhaltung des Körpers, musterhaftes Vorleben und Rassereinheit hat jeder den größten Wert zu legen; denn auch „Du“ bildest das Glied einer ewigen Kette deines Geschlechtes! Jedes Mädchen sollte daran denken, daß sie einst als deutsche Mutter und jeder Knabe, daß er einst als Vater und Vorbild die höchsten Pflichten im Familienleben zu erfüllen haben. Den Eltern, denen die Kinder alles zu verdanken haben, ist jederzeit – ganz besonders im Alter – die größte Liebe und Ehrerbietung zu erweisen!
Am Sonntag, den 22. März 1942 wurden sämtliche Schulentlassene in Bad Bramstedt im Kaisersaal in Anwesenheit der Gliederungen der Partei, Eltern und Lehrern feierlich auf den Führer verpflichtet.
Im Frühjahr 1942 machen sich die Auswirkungen des starken Winters im Saatenstand stark bemerkbar. Von den 84 ha, die mit Roggen bestellt waren, müssen wegen Auswinterung der Saat 70 ha umge-brochen und mit Sommergetreide besät werden. Wie bei uns in der Heimat sieht es in weiten Gebieten unseres geliebten Vaterlandes und in den von unseren Truppen eroberten Ostgebieten aus. Auf ungeheure Schwierigkeiten stößt man bei der Beschaffung der Saat, doch auch diese werden überwunden. Übermenschliches hat die Landbevölkerung, unterstützt von den arbeitswilligen französischen Kriegsgefangenen und Polen in den wenigen Wochen, die zur Bestellung zur Verfügung standen, geleistet. Das Wetter im Frühjahr war anfangs für die Landwirtschaft recht günstig, so daß sämtliche Feldarbeiten flott vonstatten gehen. Das Vieh kann bereits Ende April auf die Weide getrieben werden. Später setzt eine trockene Periode ein, der eine volle Mißernte zu folgen scheint. In letzter Stunde setzt dann ein mehrwöchiger Regen ein, der alles wieder gut macht. Die Landwirtschaft bekommt eine Ernte, wie man sie seit Jahren nicht erlebt hat. Besonders Hafer und Kartoffeln bringen reiche Erträge, so daß die Bevölkerung im kommenden Jahr wieder hinreichend mit Lebensmitteln versorgt werden kann.
[40] Nachdem jeder Bauer seiner Ablieferungspflicht nachgekommen ist, können noch hinreichende Mengen an Getreide für die Viehhaltungen zur Verfügung gestellt werden. Da nach Antrag Ostarbeiter eingesetzt werden, stehen hinreichende Arbeitskräfte zur Verfügung. Die Bauern sind mit den Leistungen dieser Arbeiter recht zufrieden, wenn auch die Verständigung auf mancherlei Schwierigkeiten stößt.
Die Zahl der Einberufenen nimmt von Monat zu Monat zu. Siebzehnjährige Jünglinge werden zum Arbeitsdienst, dem sich die militärische Ausbildung anschließt, eingezogen. Das ganze deutsche Volk, sei es in der Heimat hinter dem Pflug oder hinter der Drehbank, setzt sich mit den Frontsoldaten ein, um den Endsieg zu erringen. Hunderttausende von deutschen Mädchen leisten als D.R.Kr. Schwestern, auf Schreibstuben, beim Nachrichtendienst u.s.w. treue Dienste.
Immer weiter dringen unsere siegreichen Truppen nach Osten vor und stehen bereits an der Wolga und im Kaukasus. Den tapferen Soldaten folgen die Ingenieure und landwirtschaftlichen Kommissare – meistens Bauernsöhne – auf dem Fuße, und so ist es in kürzester Zeit gelungen, diese weiten fruchtbaren und reichen Gebiete der deutschen Wirtschaft nutzbar zu machen. Viel Getreide und große Mengen an Lebensmitteln konnten bereits der Heimat zur Verfügung gestellt werden, und nur so war es möglich, die Lebensmittelrationen zu erhöhen und der Bevölkerung zum Weihnachtsfeste durch Sonderzuteilungen eine Freude zu machen.
Bei den schweren Kämpfen im Osten muß während der Sommermonate Claus Thies – ehemaliger Schüler – Sohn der Witwe Alma Thies sein Leben für das Vaterland opfern. Sein Bruder Ernst Thies, Hans Fölster, Sohn des Kätners Rudolf Fölster, Hans Karstens, Sohn des Bauern und Weltkriegs-Beschädigten Johannes Karstens, werden mehr oder weniger schwer verwundet. Artur Johannsen, Sohn des Bauern August J. und Fengler, Verlobter der Bauerntochter E. Reimers, erleiden schwere Frostschäden.
Für Tapferkeit vor dem Feinde werden ausgezeichnet: Wilhelm Kröger – Unteroffizier – mit EK I, Hans Fölster, Hans Kock, Heinrich Kock und Artur Johannsen mit EK II, und Ernst Harbeck erhält das Verdienstkreuz mit Schwertern. Das Knopfloch der meisten Frontsoldaten schmückt das Band der Winter-Ostfront Medaille 1941/42.
[41] Während die Vereinigten Staaten von Amerika bisher hauptsächlich gegen unseren japanischen Verbündeten kämpften und von diesem harte Schläge einstecken mußten und Rußland und England durch Lieferungen von Kriegsmaterial unterstützte, landeten nach Verrat französischer Generale und Admirale am 8. November 1942 amerikanisch-englische Truppen in Französisch Nordafrika. Südfrankreich und die Insel Korsika werden von deutschen und italienischen Truppen besetzt. Diese landen ebenfalls in Tunis, wo recht bald schwere Kämpfe entbrennen. An diesen nehmen auch einige Söhne unserer Gemeinde teil. Trotz der furchtbaren Winterstürme bleiben unsere U-Boote dauernd am Feind und fügen diesem unersetzliche Verluste zu. Wir fragen uns zur Jahreswende 1942/43:
Sind die jetzigen feindlichen Großangriffe im Osten, die unter den schwersten Feind- und Materialverlusten abgewiesen werden, die letzten Zuckungen des gewaltigen Riesen? Wird Rußland den jetzigen Winter überstehen, wird nicht nach dem Verlust der fruchtbarsten Gebiete in Rußland eine furchtbare Hungersnot ausbrechen? Wird es unseren U-Booten gelingen, den Nachschub unserer Feinde zu unterbinden? Was plant Japan? u.a.
Am 30. August 1942, nach Beendigung der Sommerferien, traten drei Neulinge: ein Knabe und zwei Mädchen in die Schule ein. Wegen Erkrankung des Lehrers Mohr an einer schweren Nervenentzündung übernimmt Lehrer Fick in Hagen die Vertretung. (Oktober – Dezember.)
10. April 1943.
Während der letzten Monate nahm die Heimat bangen Herzens, jedoch mit vertrauensvoller und fester Siegeszuversicht Anteil an den schweren Abwehrkämpfen unserer tapferen Söhne, die das Vaterland im Osten gegen einen an Menschen und Material weit überlegenen bestialischen Feind heldenmütig verteidigen. Der Untergang der unvergeßlichen ruhmreichen 6. Armee unter Führung des Generalfeldmarschalls Paulus rüttelt auch den letzten Außenstehenden des deutschen Volkes auf. Jeder erkennt nunmehr, in welcher großen Gefahr die Ostfront und damit die deutsche Heimat geschwebt hat. Des Führers Aufruf zum „Totalen Krieg“ findet bei jedem Deutschen lebhaften Widerhall. Weite, im vorigen Sommer eroberte, mit dem Blut der tapfersten und treuesten Söhne unseres Volkes getränkten Gebiete mußten geräumt und aufgegeben werden. Am Donez und dem unteren Kuban wurde dem Mongolensturm schließlich Halt geboten. In den schweren Abwehrkämpfen im Osten findet im März 1943 der Obergefreite Artur Johannsen im jugendlichen Alter von 22 Jahren, Inhaber des EK II, des Infanterie-Sturm-Abzeichens und der Ostmedaille den Heldentod. (Rshew).
[42] Sein Vater, der Erbhofbauer August Johannsen, verliert in ihm seinen einzigen, guten und hoffnungsvollen Sohn, der später den väterlichen Erbhof übernehmen sollte. In seinen letzten Briefen, die er an seinen Vater schrieb, kommt seine feste Siegeszuversicht zum Ausdruck. Artur! Auch Du gabst das Höchste, Du tatest bis zum letzten Lebenshauch Deine Pflicht und opfertest Dich für uns, für Führer, Volk und Vaterland!
In Tunis tobt in diesen Tagen eine schwere Abwehrschlacht gegen eine große feindliche englisch-amerikanische Übermacht. Unsere U-Boote erteilen den feindlichen Zufuhren harte Schläge. Schwer hat die Heimat unter den feindlichen Bombenangriffen zu leiden, doch ertragen die Heimgesuchten die schweren Prüfungen mit erbitterter Rache im Herzen. Auch in unserer Gegend stürzen mehrere Feindflugzeuge ab, in Großenaspe, Sarlhusen, Lentföhrden u.s.w.
Millionen von Männern, deren Arbeitsplätze nunmehr von Frauen besetzt werden, strömen zu den Waffen. Die Bauern Alb. Feil,Hans Rühmann und Martin Kelting werden zum Wehrdienst einberufen und die 17jährigen Claus Harbeck und Hermann Fölster zur Waffen-SS eingezogen. Die Geschäfte des Bürgermeisters führt nunmehr der Ortsgruppenleiter G. Blunck und die Kassenwaltung der Gemeinde übernimmt H. Harbeck. Die feste Siegeszuversicht der Heimat kommt in den hohen Spenden zum W.H.W. 1942/43 zum Ausdruck. Im Laufe der Wintermonate werden 2.835 RM gespendet, an Bedürftige gelangen 1.070 RM in Form von Wertgutscheinen zur Verteilung. Acht Volksgenossen verpflichteten sich bereits, im Laufe des Sommers acht erholungsbedürftige Soldaten 14 Tage unentgeltlich aufzunehmen.
Da die Viehmärkte ungenügend beschickt werden, wird den Bauern zur Pflicht gemacht, Vieh abzuliefern. Ebenso müssen wegen Mangel an Zugtieren entbehrliche Pferde der Wehrmacht und den landwirtschaftlichen Betrieben gestellt und für Taxtpreis überlassen werden.
Am 27. März wird ein Mädchen aus der Schule entlassen.
Bei den schweren Kämpfen im Osten zeichneten sich durch hervorragende Tapferkeit aus: Ernst Kröger, Sohn des Bauern Johs. Kröger, sowie (Wilhelm) Julius Kröger und der Obergefreite Hans Karstens, Sohn des Bauern Johannes Karstens. Sie wurden mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet.
Am 1. Mai 1943 waren an ausländischen Arbeitern in der Gemeinde beschäftigt:
Kroaten Kr. Franzosen Polen Ukrainer Russen:
m. w. m. m. w. m. w. m. w.
1 – 22 4 6 2 2 2 4
[43] Blut und Rasse.
Bevölkerungsbewegung innerhalb der Gemeinde Föhrden Barl (ab 1870)
Deutschland wird ewig sein und niemals untergehen, wenn es seine Rasse rein hält und es wieder ein „lachendes Kinderland“ wird. Diese alten Naturgesetze haben alte Kulturvölker, seien es die alten Babylonier, Griechen und Römer, oder nennen wir germanische Volksstämme: die Goten und Vandalen, nicht beachtet. Ihr Blut war ihnen nicht heilig, sie betrachteten die Scholle, die ewige Mutter Erde nicht als die Quelle, aus der immer wieder neue Kraft quillt, sondern strebten nur nach äußerer Macht und äußerem scheinbaren Reichtum, vermischten sich mit anderen Völkern, die sich viel stärker vermehrten, und die unausbleibliche Folge war: ihr Untergang. Einen ähnlichen Vorgang können wir augenblicklich beim französischen Volk wahrnehmen.
Und – steht es um das deutsche Volk viel besser? Wieviele kinderlose Ehen oder solche mit ein oder zwei Kindern, sogenannten „Sorgenkindern“, gibt es bei uns! Das „Zweikindersystem“ hat teilweise bereits die erbgesunde Bauernfamilie angesteckt. Millionen ziehen im Laufe weniger Jahre aus leichtverständlichen Gründen vom Lande in die Großstadt und gehen dort spätestens nach zwei oder drei Generationen unter.
Was nützen die weiten fruchtbaren Gebiete im Osten, für die das Blut unserer besten Söhne vergossen wird, wenn es nicht gelingt, sie im Laufe der nächsten 50 Jahre mit deutschen Menschen zu besiedeln? – Dann hätte der Bolschewismus doch schließlich gesiegt! Das darf auf keinen Fall erfolgen! Durch Aufklärung und Belehrung, durch die Begünstigung kinderreicher Familien bei der Gesetzgebung des Staates muß alles geschehen, um eine „kinderbejahende Mutter“ zu gewährleisten.
An Hand des Schülerverzeichnisses war es mir möglich, die Bevölkerungsbewegung innerhalb unserer Gemeinde in den letzten 70 – 80 Jahren festzustellen. Aus derselben ist zu erkennen, daß unsere Bauern im allgemeinen reich mit Kindern gesegnet waren, diese jedoch in den meisten Fällen als Beamte, Angestellte, Handwerker oder Gewerbetreibende in die Stadt gezogen sind. Uns fehlte der Wirtschafts- und Lebensraum!
Meine nunmehr folgende Untersuchung der Bevölkerungsbewegung erstreckt sich nur auf alteingesessene Familien, sogenannte „vorübergehend Ansässige“ habe ich absichtlich nicht berücksichtigt.
[Es folgen auf den Seiten 44 – 49 Übersichten zur Bevölkerungsbewegung (s. anliegende Tabelle).]
[50] In der Gemeinde bestanden seit dem Jahre 1870 39 kinderreiche (d.h. Ehen mit drei und mehr Kindern), 28 kinderarme Ehen und zwei Ehen blieben kinderlos.
7 Familien, je 1 Kind, 4 Familien, je 5 Kinder, 2 Familien, je 9 Kinder,
21 “ “ 2 Kinder, 5 “ “ 6 “ , 1 “ “ 12 “ ,
11 “ “ 3 “ , 4 “ “ 7 “ , 2 Ehen kinderlos.
11 “ “ 4 “ , 1 “ “ 8 “ ,
Aus den 69 (71) Familien gingen 242 lebende Kinder hervor, somit kommen auf jede Familie 3,5 Kinder. Wenn man die totgeborenen und die frühzeitig verstorbenen Kinder mitzählt, so kommt man zu dem Ergebnis:
Jede Ehefrau unserer Gemeinde schenkte – im Durchschnitt – 4 Kindern das Leben.
Es muß berücksichtigt werden, daß die Geburten der jetzt lebenden Generation noch nicht abgeschlossen sind.
Dem Geschlechtsverhältnis nach verteilen sich die Geburten auf 132 Knaben und 110 Mädchen, von denen 26 Knaben und 25 Mädchen das 14. Lebensjahr nicht erreicht haben, also noch nicht im Berufsleben stehen.
Von den im Berufsleben stehenden 108 Söhnen und 85 Töchtern – Summa 193 – blieben 58 Söhne und nur 24 Töchter in ihrem Heimatdorf, während 50 Männer und 61 Frauen in die Fremde zogen.
Ich muß hierzu bemerken: Da viele weichende junge Bauernsöhne und -töchter, die jetzt noch auf dem väterlichen Hof arbeiten, nach ihrer Heirat oder Gründung einer Existenz ihr Elternhaus verlassen, wird sich die Zahl der Verziehenden noch erheblich erhöhen, bei den Männern etwa um 10, bei den Frauen um 9.
Ergebnis: Von den 108 Söhnen und 85 Töchtern sind (bzw. werden)
a) 48 Söhne und 15 Töchter in der Gemeinde geblieben.
b) 60 Söhne und 40 Töchter ziehen in die Fremde (bzw. +).
Die in der Heimat verbleibenden Männer übernahmen bzw. übernehmen als Bauern, Gewerbetreibende oder Kätner den väterlichen Besitz. Ähnlich verhält es sich bei den Frauen, von denen (2) vereinzelte als Hoferben erscheinen, die Mehrzahl (9) werden mit Bauern oder (1) Gewerbetreibenden verheiratet und wenige (3) bleiben [51] als unverheiratete „Tanten“ auf dem väterlichen Besitz.
Als Landarbeiter oder Tagelöhner ist keiner in seinem Heimatdorf geblieben.
Hieraus ist zu ersehen, daß seit jeher nur die Hoferben, einige Junggesellen und wenige mit ortseingesessenen Bauern verheiratete Bauerntöchter in ihrer engeren Heimat blieben. Die weichenden Erben verließen ihr Elternhaus, um ihr Glück in der Fremde zu suchen. Erhebliche Mittel standen ihnen selten zur Verfügung. Was sie besaßen war: Selbstvertrauen, Mut, Fleiß, Ausdauer und ein treues, ehrliches Gemüt. Vielfach waren es die Besten, Verwegensten und Wagemutigsten, die unser Dorf verließen und es in der Fremde in wenigen Jahren zu Ansehen und Wohlstand brachten.
Von denen, die nach 1870 fortzogen, wurden neun Bauern und bisher sechs noch als Landwirte Aufgeführte, werden nach beendetem Kriege ebenfalls selbständig werden oder die Beamtenlaufbahn einschlagen, 20 haben ein Handwerk erlernt oder sind im Gewerbe tätig und sind bereits lange Jahre Inhaber selbständiger Betriebe. (Schlosser, Gärtner, Schlachter u.a.) Dreizehn wurden Beamte und Angestellte und genießen als solche das langjährige Vertrauen ihrer Vorgesetzten bzw. ihrer Behörde (- Lehrer, Post-, Telegr.-, Finanzbeamte u.s.w.), nur ganz wenige (drei) wurden Handarbeiter. Drei Männer wanderten aus und gingen damit der Heimat und dem Vaterlande für immer verloren. Von diesen Auswanderern haben sich zwei als Farmer in Nordamerika niedergelassen und es dort zu Wohlstand gebracht, der dritte ist verschollen.
Von den verzogenen Töchtern (59) unseres Dorfes wurden 28 Bäuerinnen und drei betätigten sich im Gewerbe, 25 wurden mit bessergestellten Angestellten, Beamten und dergleichen verheiratet und tun als Hausfrauen und Mütter ihre Pflicht, während nur ganz wenige (drei) als Arbeiterfrauen für ihr Auskommen durch eigene Arbeit mitverdienen müssen.
Und wo sind die Verzogenen geblieben?
21 Männer verzogen in ein Dorf, 20 in eine Kleinstadt und 9 in die Großstadt,
30 Frauen “ “ “ “ , 17 “ “ “ “ 11 “ “ “ .
Alle kehren gern und oft in ihr Heimatdorf zurück, alle sind ihrer Heimat treu geblieben.
Abgeschlossen: 1. Mai 1943 Wilh. Mohr.
[52] Nach einem milden Winter erlebten wir in diesem Jahre ein herrliches Frühjahr. Bereits am 18. April 1943 sah ich den ersten Storch in den Lüften schweben, am 20. April die ersten Schwalben und am 25. April standen die Obstbäume in voller Blütenpracht. Bereits Ende April kann das Vieh auf die Weide getrieben werden. Nach anhaltender Trockenheit fällt am 23. Mai der langersehnte Regen.
Nach heldenhaften wechselvollen Kämpfen wird unser Afrikakorps wegen Mangel an Nachschub gezwungen, am 3. Juni den Widerstand gegen den an Zahl und Waffen vielfach überlegenen Feind einzustellen. Die Terrorangriffe der feindlichen Bombengeschwader auf unsere Großstädte nehmen von Woche zu Woche zu, die Verheerungen und die Verluste der Zivilbevölkerung sind entsetzlich. Mancher Volksgenosse sieht bedenklich in die Zukunft.
Herr Schulrat Lindrum überreichte am 31. Mai 1943 in Anwesenheit der Kinder dem Lehrer Mohr in feierlicher Form das Treudienst-Ehrenzeichen I. Stufe (40 J. Dienstzeit).
Ende November 1943
Wir erlebten in diesem Jahre einen selten günstigen Sommer, der uns eine überreiche Ernte bescherte. Die Heuernte wurde, vom schönen Wetter begünstigt, schnell und gut geborgen. Der Roggen erbrachte durchschnittlich den 15fachen Ertrag und auch die Haferernte war weit über Durchschnitt. Nur der Buchweizen versagte infolge einer Trockenheitsperiode während der Blütezeit vollständig. Bauern, die sich verpflichten, eine bestimmte Anzahl von Schweinen zu mästen, bleiben von der Getreideablieferung – ausgenommen Brotgetreide – verschont. Unter der Trockenheit hatten auch die Hackfrüchte recht stark gelitten, so daß die kaum „mittlere“ Kartoffelernte wohl für die Volksernährung ausreichen wird, doch für die Schweinemast können in diesem Jahre keine Kartoffeln zur Verfügung gestellt werden. Bis September 1944 müssen die Bauern unserer Gemeinde, um die Fleischversorgung der Bevölkerung sicherzustellen, 288 Rinder (9 Liter) zur Ablieferung bringen. Für viele unserer Bauern, besonders für diejenigen, die sich auf Milchwirtschaft umgestellt haben und daher die Kälber abschlachten ließen, bedeutet diese Maßnahme eine große Härte. Selbstversorger, die für ihren Haushalt Schweine einzuschlachten gedenken, haben die gleiche Anzahl von Schweinen der allgemeinen Versorgung zuzuführen. Auch dürfen nur Schweine im Gewichte von 3,5 Zentner und mehr zur Schlachtung freigegeben werden.
[Es folgt eingeschoben S. 53/54 ein Aufsatz von Herbert Schuldt]
[53] Ein Flugzeugabsturz 24.5.1943.
In den letzten Tagen wurde unser Dorf recht oft von feindlichen Flugzeugen überflogen. Auch gestern nachmittag summte und brummte es in der Luft. Lange Zeit suchte ich den Himmel ab, doch ich konnte keine Flugzeuge entdecken. Plötzlich sah ich eine lange Rauchfahne, ein weißer Fallschirm schwebte in der Luft, und ein Flugzeug sauste unter schrecklichem Geheul in größter Geschwindigkeit schräg zur Erde. Ich wollte mich schon hinwerfen; denn das Heulen kam immer näher. Plötzlich erzitterte die Erde, eine dicke schwarze Rauchfahne stieg zum Himmel empor, und mächtige Flammen züngelten aus dem Flugzeug hervor.
Ich schwinge mich auf mein Fahrrad und begebe mich zur Unglücksstelle. Sie befindet sich am Herrenholzweg, ungefähr 500 Meter vom Weddelbrooker Damm entfernt. Hier haben sich schon andere Neugierige eingefunden. Von der Polizei werden wir vom Brandherd ferngehalten; denn jeden Augenblick kann die Munition explodieren. Das Flugzeug hat ein zwei Meter tiefes Loch in die Erde gewühlt. Bei der Unglücksstätte liegen Blechteile, der Propeller und eine verbogene Tragfläche umher. Nach kurzer Besichtigung fahre ich wieder nach Hause.
Magdalene Rühmann hat das Heruntergehen des Fallschirmes gesehen. Der Fallschirm ist etwas abgetrieben und in den Hagener Wiesen [54] bei der Ziegelei gelandet. Der angebrannte Fallschirm ist schon zusammengerollt. Der abgestürzte Jagdflieger erzählt: „Wir flogen neue Jagdflugzeuge ein. Der Motor des von mir gesteuerten Jagdflugzeuges muß nicht in Ordnung gewesen sein; denn plötzlich schlugen Flammen aus dem Motor heraus. Schnell entschlossen sprang ich aus dem Flugzeug und stürzte nun in die Tiefe. Anfangs war ich in den Stricken verwickelt und verlor so einen Stiefel. Dann öffnete sich der bereits angebrannte Fallschirm, wurde vom Südostwind etwas abgetrieben und landete so in den Hagener Wiesen. Ich habe geringe Schmerzen im Bein und im Rücken und außerdem ein paar Brandwunden davongetragen. Doch sonst fehlt mir nichts!“
Die übrigen Flieger kreisten nach dem Absturz ihres Kameraden noch lange um die Unfallstelle herum. Sie kamen immer niedriger. Dadurch wollten sie Hilfe herbeirufen. Als die Flieger erkannten: „Unser Kamerad ist gut gelandet!“ schraubten sie ihre Flugzeuge wieder in die Wolken, und bald waren sie unseren Blicken entschwunden.
Herbert Schuldt, 13 J.
[Es folgt die Fortsetzung des auf S. 52 unterbrochenen Textes]
[55] Infolge der guten Getreideernte können die Brotrationen wieder heraufgesetzt werden, was von der Bevölkerung freudig begrüßt wird; denn insbesondere in den Großstädten herrscht in mancher Familie bittere Not.
Der Herbst ist äußerst milde und trocken. Die Saatbestellung wird ohne Schwierigkeit erledigt. Arbeitskräfte stehen der Landwirtschaft hinreichend zur Verfügung; denn immermehr Ostarbeiter, insbesondere Polen und Ukrainer – darunter viele Frauen und Kinder – werden der Landwirtschaft zur Arbeitsleistung zugeteilt. Doch die zuverlässigsten und treuesten Arbeiter sind die kriegsgefangenen Franzosen. Der Bürgermeister Feil, der nicht frontfähig ist, hat diese zu bewachen. An Fremdvölkern werden z.Zt. 58 Mann beschäftigt:
K. Franzosen: Polen: Ukrainer: Russen: Sa.
m. w. m. w. m. w.
23 7 11 3 6 4 8 58
Einheimische Bevölkerung:
Erwachsene: Kinder: Sa.
m. w. m. w.
40 69 28 25 162
davon ab Hbg. u. Kieler Evakuierte: 1 4 2 1 8
Verbleiben: 39 65 26 24 154
Alle irgendwie entbehrlichen Männer stehen im Einsatz für Volk und Vaterland. Die Bevölkerung ist darüber empört, daß es in diesem Kriege noch Reklamierte, Kriegsgewinnler und Schieber gibt.
Die Heimat hat unter den feindlichen Fliegerangriffen schwer zu leiden. Ganze Städte werden durch die Spreng- und Brandbomben vernichtet. Groß sind die Opfer an Gut und Blut. Doch die Bevölkerung verbeißt den Schmerz mit vorbildlicher Haltung und weist in den mit ihr geführten Gesprächen darauf hin, daß unsere Helden im Osten noch Schwereres zu erdulden haben.
In den Nächten vom 25./26.1., 27./28. und 30./31. Juli wird der größte Teil der Großstadt Hamburg dem Erdboden gleichgemacht. Wir sitzen im Chausseegraben (Splitterschutz) und sehen in der herrlichen Sommernacht dem furchtbaren Schauspiel zu. Die Luft ist erfüllt von dem Dröhnen der über uns dahinziehenden feindlichen Großbomber. Durch Abwurf von Metallstreifen, die am nächsten Morgen zu Tausenden in der Gegend umherliegen, wird die deutsche Funkverständigung unterbunden und damit eine Verständigung der Flak und Nachtjäger zunichte gemacht. Ungehindert können so die Großbomber ihren Bombensegen planmäßig auf die Millionenstadt abladen. Neben den Sprengbomben geht ein ungeheurer [56] Phosphorregen auf Hamburg – in der Nacht vom 30./31. Juli ebenfalls auf Elmshorn – nieder, der bei der damals herrschenden Hitze ganze Straßenzüge und Stadtteile einäschert. Hunderttausende werden obdachlos und verlieren Hab und Gut. Zehntausende der Bewohner kommen in den Flammen um. Der südliche Himmel ist am Abend hell erleuchtet. Die Türen und Fenster zittern und beben. Während des Angriffes vom 30./31.7. herrscht ein furchtbares Gewitter, und die bei uns untergebrachten Evakuierten sehen und erleben von hier aus den Untergang ihrer lieben Heimat.
Die allermeisten Hamburger verlassen mit dem Rest ihrer Habe auf zur Verfügung gestellten Autos ihre Heimat und finden liebevolle Aufnahme und Betreuung in den Nachbargauen. Auf Veranlassung der Partei mußte ich als Ortsgruppenamtsleiter der N.S.V. sämtliche in der Gemeinde verfügbaren Quartiere bereithalten und in der Schulstube ein Massenquartier einrichten. Am Nachmittag des 29. Juli gelangte der erste größere Schub per Auto auf dem Schulhofe an und wurde dann ohne Schwierigkeit auf die Quartiere verteilt. Diejenigen, die beabsichtigten, am nächsten Tag weiterzureisen und andere, die wieder nach Hamburg zurückkehren mußten, blieben im Massenquartier, für das ich meine sämtlichen Decken und Kissen bereitstellte. Nachdem der Bürgermeister der N.S.V. Lebensmittelkarten übergeben hatte, war es meiner Frau tagelang möglich, die notleidenden Volksgenossen zu verpflegen. Daß bei dem Ansturm manch Unangenehmes und viele Schwierigkeiten zu überwinden waren, ist selbstverständlich. Ich habe bei schwerwiegenden Entscheidungen – im Gegensatz zur Gemeindebehörde – stets als Nationalsozialist gehandelt und für meine Handlungsweise auch die alleinige Verantwortung übernommen. In unserer Gemeinde waren wochenlang bis 120 Evakuierte untergebracht. Obgleich von der Kreisleitung schon lange Zeit vorher Vorbereitungen für einen Katastrophenfall getroffen waren, ließ die Organisation doch viel zu wünschen übrig. Noch heute denken viele Hamburger an die in unserem Dorfe verbrachten schönen Tage in Dankbarkeit zurück. Drei Wochen lang brachte ich in meinem Hause bei voller Verpflegung fünf bzw. sechs Bombenbeschädigte aus Eidelstedt unter. — Auch am Tage versuchen amerikanische Bomber einzufliegen, erleiden aber jedesmal große Verluste. An einem klaren Spätsommertag fand über unserer Gegend mit einem feindlichen Geschwader (etwa 270 Bomber) eine Luftschlacht statt, die in einer Höhe [57] von 5.000 – 6.000 m ausgetragen wurde. Immer wieder schossen unsere kühnen Jäger in den feindlichen Verband hinein und brachten mehrere Feindmaschinen zum Absturz. Die Besatzungen versuchten sich im Fallschirm zu retten und wurden dann, teils verwundet von der „Landwacht“ gefangengenommen (Quarnstedt, Hagen, Schmalfeld). Doch schon nach wenigen Wochen wird die Abwehr der Heimat dermaßen verstärkt, daß die Feinde ihre Einflüge jedesmal mit ungeheuren Verlusten bezahlen müssen. Das ganze deutsche Volk ersehnt den Tag der furchtbaren Vergeltung!
Veranlaßt durch Abhören von Feindsendungen, den Verrat der italienischen Badoglio Regierung, die Rückschläge in Süditalien und an der Ostfront und die furchtbaren Verwüstungen durch die feindlichen Terrorflieger in der Heimat machte sich im Volke eine allgemeine Mutlosigkeit bemerkbar. Doch nachdem unsere Wehrmacht dem Feinde im Osten und im Süden wieder harte Schläge versetzt und die Schwierigkeiten in Italien überwunden sind, ist das Vertrauen und die Siegeszuversicht im Volke wieder im Steigen; denn jeder ist sich bewußt, daß dieser Kampf um die Existenz des deutschen Volkes geht. Auch die gewaltigen Erfolge unseres japanischen Verbündeten machen auf die breiten Massen des Volkes einen gewaltigen Eindruck.
Bürgermeister und Ortsgruppenleiter Blunck wurde für seine Leistungen mit dem Kriegsverdienstkreuz ohne Schwerter und der Ortsgruppenamtsleiter Mohr mit der Medaille für Volkspflege ausgezeichnet.
Obgleich die Kaufleute letzten Endes doch nur als Warenverteiler betrachtet werden können, macht sich im Geschäftsleben ein übler Schwarzhandel immer mehr bemerkbar. Volksgenossen, die keine Gegenleistungen machen können, werden von den Handwerkern bei Reparaturen vernachlässigt. Geflügel, insbesondere fette Enten und Gänse, gelangt kaum auf den Markt.
Die in Nordafrika in amerikanische Kriegsgefangenschaft geratenen Wachtmeister Walter Behnke und Hans Kock haben an ihre Angehörigen geschrieben. Diese Nachricht löste in der ganzen Gemeinde anteilige Freude aus.
Laut Schulzählung vom 15.11.1943 wird die Schule z.Zt. von 25 Kindern (davon 1 Hamburg, 1 Kiel), und zwar von 14 Knaben und 11 Mädchen besucht.
[58] Im Laufe des Sommers und Herbstes d.J. wurden durch die N.S.V. auf 14 Tage erholungsbedürftige verwundete Soldaten untergebracht bei F. Seider, Mohr, Reimers, Hans Schnack, Herb. Schnack, G. Blunck, Hg. Schwartzkopff, J. Lohse und W. Krohn.
Die Sammlung für das Deutsche Rote Kreuz erbrachte die stattliche Summe von 1.204,91 RM.
In einem Feldlazarett in Italien starb am 4. Dezember 1943 nach einer schweren Verwundung – Granatsplitter in Leber und Lunge – der Sohn des Erbhofbauern Johannes Karstens, der Obergrenadier Walter Karstens im Alter von 19 Jahren. Die schwer geprüften Eltern verlieren in ihrem Walter, der noch vor wenigen Wochen bei ihnen auf Urlaub weilte, ihren jüngsten lebensfrohen, hoffnungsvollen Sohn. Zu jedem war Walter stets liebevoll, freundlich, höflich und entgegenkommend, stets strahlte aus seinem Antlitz frohe Lebenszuversicht, und jeder, der ihn kannte, hatte ihn gern! Walter! Du ruhst jetzt für immer in fremder Erde! Doch auch Du bist nicht umsonst gefallen; denn Du starbst für uns, für Deine Heimat und für Dein Vaterland! Nie wird Dein Name verklingen, heilig soll er uns sein!
Zur Jahreswende 1943/44.
Ein schweres Jahr, reich an harten Prüfungen, Erfolgen und furchtbaren Rückschlägen liegt hinter uns! Immer fester und inniger wird das deutsche Volk im Ringen um Sein oder Nichtsein zur festgefügten Volksgemeinschaft zusammengeschlossen. Mancher blickt sorgenvoll, doch fest entschlossen in die Zukunft. Groß waren die Opfer an Gut und Blut, die das Jahr 1943 von Front und Heimat forderte. Der ruhmreiche Untergang der 6. Armee in Stalingrad, der Rückzug der Ostarmee, die Aufgabe weiter fruchtbarer Gebiete im Osten und im Kaukasus, die Kapitulation des deutschen Afrikakorps infolge Unterbindung des Nachschubs und der schmähliche Verrat Italiens waren Ereignisse, die auf das Kriegsgeschehen einen nachhaltigen Einfluß ausübten.
Schwer hatte die Heimat unter dem feindlichen Luftterror zu leiden. Viele Frauen und Kinder sind den Fliegerangriffen zum Opfer gefallen. Städte sind zerstört und viele Bauerngehöfte niedergebrannt. Doch auch diese Opfer müssen ertragen werden!
Das Jahr 1944, das die Hingabe des ganzen deutschen Volkes fordert, wird hoffentlich die Entscheidung bringen! Wir sind bereit, mehr denn je unsere Pflicht und [59] Schuldigkeit zu tun und noch größere Opfer auf uns zu nehmen, damit wir dereinst vor der Geschichte bestehen können und wir uns vor unseren heimkehrenden tapferen Helden nicht zu schämen brauchen.
Luftschlacht über Föhrden Barl am 5. Januar 1944.
Fast täglich ertönen in den ersten Tagen des neuen Jahres die Sirenen in Wrist und Kellinghusen: Fliegeralarm! Feindliche Flugzeuge überfliegen Tag und Nacht in geschlossenen Verbänden unsere Gegend, um über Kiel, Hamburg, Stettin, Berlin u.s.w. ihren Bombensegen abzuladen.
Am 5. Januar sitze ich, wie immer, kurz nach Mittag in der Stube am Fenster und lese die Zeitung. Draußen ist eine herrliche Winterlandschaft mit schneebedeckter Erde und klarem blauen Himmel. Durch das Heulen der Sirenen werde ich aufgerüttelt. Die Bevölkerung wird gewarnt und aufgefordert, die Luftschutzräume aufzusuchen. Feindliche Bomber haben Kiel schwer heimgesucht und großen Schaden verursacht. In nordöstlicher Richtung erblicke ich mächtige Rauchwolken. Kiel brennt!
Ich gehe nun hinaus, um Ausschau zu halten.
Und siehe da, schon donnern die in geschlossener Formation fliegenden viermotorigen nordamerikanischen Bomber heran! Sie fliegen in einer Höhe von 6.000 – 8.000 m und werden durch zweimotorige Jagdflugzeuge beschützt. Ich zähle 15, 20, 25, 36 Feindmaschinen! Doch nach kurzer Zeit sind auch schon unsere kleinen, gewandten, schnellen Jäger da und stoßen von allen Seiten wie Habichte auf die schwerbewaffneten „Festungen“ herab. Die feindlichen Jäger versuchen, sie daran zu verhindern, kurven hin und her, lange Kondensstreifen hinter sich zurücklassend. Die Maschinengewehre hämmern, die Bordkanonen senden den Feindmaschinen Ladung auf Ladung in die Bäuche. Die Luft ist erfüllt vom Dröhnen der eigenen und feindlichen Maschinen. Ein Bomber brennt und eine mächtige Rauchfahne zieht hinter ihm her. Noch zwei Angriffe unserer Messerschmittjäger und der Feind stürzt brennend in die Tiefe, explodiert beim Aufschlag und eine mächtige Rauchsäule steigt gen Himmel. Der feindliche Verband wird gezwungen, sich aufzulösen, und nun entwickeln sich schwere Einzelkämpfe, denen weitere Bomber zum Opfer fallen.
[60] Doch auch einer von unseren Jägern stürzt brennend herunter. Dem Piloten gelingt es, im letzten Augenblick auszusteigen, und lange Zeit beobachte ich den geöffneten Fallschirm, der nach Süden abgetrieben wird.
Immer neue feindliche Pulks kommen aus Nordosten, die 32, 51, 42 und 25 Maschinen zählen. Die Luftkämpfe werden immer erbitterter, bis ein Verband nach dem anderen, verfolgt von unseren immer wieder angreifenden Jägern am westlichen Horizont verschwindet. Während der heftigen Kämpfe purzeln mehrere bombenähnliche Blechtonnen vom Himmel. Sie landen in unmittelbarer Nähe des Dorfes. Wir erwarten eine heftige Detonation, die ungeheuren Schaden verursacht hätte. Später stellt sich heraus, daß diese „Bomben“ leere, von unseren Jägern als Ballast abgeworfene Reserve-Tanks sind.
In den schweren Kämpfen wurden sieben, davon fünf Feindbomber über unserer Gegend abgeschossen. Das eine feindliche Flugzeug stürzte brennend bei Wulfsmoor ab, ließ aber noch im letzten Augenblick viele Hunderte Stabbrandbomben fallen, von denen einige ein Bauernhaus in Wulfsmoor vernichteten.
Frauen und Kinder der Nachbarschaft suchten während des Fliegerangriffes Schutz in dem Keller des Schulhauses. Auf unser Dorf wurden keine Bomben geworfen.
In der Nacht vom 5./6. Januar haben wir wieder Alarm! Also: Heraus aus den warmen Betten. 1½ Stunden überfliegen englische Bombengeschwader unser Dorf. Die Koffer mit den allernotwendigsten Kleidungsstücken und liebsten Wertgegenständen sind bereitgestellt.
Am nächsten Tage meldete der Heeresbericht: Beim Angriff auf Kiel in den Mittagsstunden des 5. Januar wurden 81 Feindmaschinen, darunter 63 viermotorige Bomber und beim Nachtangriff auf Stettin 16 Bomber abgeschossen. 20 eigene Jäger gingen bei diesen schweren Kämpfen verloren.
In den Abendstunden des 5. Januars fahren viele motorisierte Feuerlöschzüge geschlossen durch unser Dorf. Richtung: Das brennende Kiel.
In den Landgemeinden werden Vorbereitungen zur Aufnahme obdachloser Frauen und Kinder aus dem zerstörten Kiel getroffen. In unserer Gemeinde sollen vorläufig 26 Personen untergebracht werden.
[61] Am 10.12.1943 wurde der Stabsgefreite Ernst Harbeck, mot.Art.Reg. /720, Sohn des Erbhofbauern Johannes Harbeck, als Fahrer einer Zugmaschine für hervorragende Tapferkeit bei den schweren Abwehrkämpfen an der Ostfront (Mitte) und vorbildliche Pflichterfüllung mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse ausgezeichnet.
Da die Kartoffeln infolge der schlechten Ernte und der verpaßten rechtzeitigen Beschlagnahme zur Versorgung der Bevölkerung in den Großstädten nicht ausreichen, müssen nunmehr große Mengen von Steckrüben beschlagnahmt und abgeliefert werden. Die Gemeinde Föhrden Barl hat ca. 6.000 Liter (je Liter 2,20 RM), also 20 Waggons, abzuliefern.
Bem. Hunderte von Zentnern Kartoffeln wurden in unserer Gemeinde zu Kartoffelmehl verarbeitet, verfüttert oder gedämpft. Mitte Januar 1944.
Bericht des Grenadiers Herbert Schnack über seine Erlebnisse in den schweren Abwehrkämpfen während der Winterschlacht im Osten um die Jahreswende 1943/44.
„Während der Weihnachtstage versuchte der Russe unsere Stellungen bei Berdischew und Schitomar zu durchbrechen. Mein Regiment wurde nun, nachdem wir den „Heiligen Abend“ in Ruhe verlebten, im Morgengrauen des 25. Dezember zum Gegenstoß angesetzt. Wir durchstießen nach schweren, harten Kämpfen die feindliche Hauptkampflinie und fügten den Bolschewisten große Verluste bei. Durch einen Volltreffer wurde unser LKW vollständig zerrissen. Dabei wurde ich am Gesäß leicht verwundet, doch mein Spaten und mein Brotbeutel waren arg zugerichtet. Als ich wieder zu mir kam, waren meine Kameraden verschwunden, und ich war gezwungen, mich einer anderen Einheit anzuschließen. Hier wurde ich am 28. Dezember abends 23 Uhr als Melder eingesetzt und als solcher am nächsten Morgen um 4 Uhr an der linken Hand – Durchschuß der Länge nach – verwundet. Ich schleppte mich in einen Wald, um mir die Wunde notdürftig zu verbinden. Dann versteckte ich mich in einem dichten Gebüsch, denn der Wald war noch im feindlichen Besitz. Bei Beginn der Dunkelheit machte ich mich dann wieder auf den Weg und nach langem schwierigen Marsche stieß ich vollständig ermattet auf eine deutsche Einheit. Ich hoffte nun auf ärztliche Hilfe und auf Überführung in ein Feldlazarett; denn meine Wunde schmerzte furchtbar. Und wieder kam es anders! Der Feind griff mit großer Übermacht an, und es kam zu harten Kämpfen, an denen ich trotz meiner schweren [62] Verwundung teilnehmen mußte. Obgleich wir uns tapfer zur Wehr setzten und den Russen die schwersten Verluste zufügten, wurden wir schließlich eingekesselt. Von Stunde zu Stunde wurde der Ring kleiner und fester und unsere Verluste an Toten und Verwundeten wurden immer größer. Den Weg in die russische Gefangenschaft wollten wir nicht antreten und so durchbrachen wir an einer schwächeren Stelle den feindlichen Ring, um den 600 m von uns entfernten Wald zu erreichen. Die meisten von uns wurden durch das feindliche Maschinen-gewehrfeuer niedergemäht und mit nur 19 Mann fanden wir uns im schützenden Wald wieder. Nun wurde der Wald von den Russen durchsucht, doch wir hatten uns mit sechs Mann so gut versteckt, daß wir nicht gefunden wurden. Von den übrigen 13 Kameraden haben wir keinen wiedergesehen. Sie sind wahrscheinlich von den Russen gefangengenommen und befinden sich auf dem Marsch nach Sibirien!
Für uns sechs Mann begannen nun qualvolle Tage von Strapazen und Entbehrungen! Im Schutze der Dunkelheit schlichen wir nun stur wie die Panzer durch die russische Hauptkampflinie. Ein junger Kamerad sprach perfekt russisch und so markierten wir einen russischen Spähtrupp. Wohl zehn Mal wurden wir, ohne erkannt zu werden, angerufen. Unsere Kleidung und unser ganzer Körper waren auch dermaßen verlaust und verschmutzt, daß wir den Russen vollständig glichen. Ohne unseren kühnen, tapferen Kameraden hätte wohl keiner von uns die Heimat wiedergesehen! Einer von uns war infolge der Strapazen und Entbehrungen so hinfällig, daß wir ihn buchstäblich mitschleifen mußten; denn keiner wollte seinen Kameraden im Stiche lassen. Als wir schließlich die deutschen Stellungen wieder erreichten, war unsere Freude unbeschreibbar! Im Lazarett zu Winniza wurde uns dann nach sechstägiger Irrfahrt die erste Hilfe zuteil.
Ich liege jetzt in einem Lazarett im Harze und sehe meiner baldigen Genesung entgegen.“
Bericht des Stabsgefreiten Ernst Harbeck vom 8.1.1944.
„Wie Ihr aus dem Wehrmachtsbericht entnommen habt, finden im Osten (Mitte) schwere Abwehrkämpfe statt. Das Weihnachtsfest verlebten wir noch im Kreise unserer Kameraden. Am 2. Festtag wurde von unserer Abteilung eine kampffähige Batterie zusammengestellt, die sofort zum Einsatz gelangte. Doch, als wir noch auf [63] dem Marsche zu unseren Stellungen waren, wurden wir bereits von hinten von russischen Panzern angegriffen. Bald herrschte ein wüstes Durcheinander. Wie ich mit meiner Zugmaschine aus diesem Wirrwarr herausgekommen bin, weiß ich selbst nicht mehr. Dieser Einsatz, der nur 18 Stunden dauerte, war der furchtbarste, den ich während des nunmehr 4½jährigen Krieges mitgemacht habe.
Aber seid nur unbesorgt; denn ich liege jetzt mit meinem Fahrzeug in Polen, bin also weit vom Schuß. Das „Verwundeten-Abzeichen“ ist auch für mich fällig!
Das Wetter war bisher sehr günstig. Daß es in Rußland auch einmal ein schwarzes Weihnachten geben kann, kommt wohl nur ganz selten vor.“
Das Jahr 1944 war für uns alle das bisher härteste und schwerste aller überstandenen Kriegsjahre, und es gibt wohl kaum jemanden, der es wieder zurückwünscht. Weite Gebiete Europas mußten wir preisgeben. Wir stehen nicht mehr wie noch vor einem Jahr vor Leningrad, am Dnjepr, bei Cassino, in Kirkenes und an den Pyrenäen. Der Feind steht im Westen und Osten an unseren Grenzen! Durch den schmählichen Verrat unserer rumänischen, bulgarischen und finnischen Bundesgenossen wurde unsere Kampfkraft geschwächt. Der Anschlag einer kleinen Verräterclique am 20.7.1944 gegen das Leben unseres Führers wurde blitzartig niedergeschlagen. Durch den feindlichen Luftterror wurden friedliche Dörfer und Städte aufs schwerste heimgesucht. Tausende von Frauen und Kindern fanden bei diesen Angriffen den Tod. Jedes andere Volk wäre unter der Schwere der Last zusammengebrochen. Deutschland aber ist unter diesen harten Schicksalsschlägen nicht weich, sondern hart und immer härter geworden.
Was schier unmöglich war, hat das deutsche Volk, das keinen Augenblick sein Selbstvertrauen verlor, geleistet: der Soldat an der Front, Frauen, Kinder und Greise bei der Errichtung von Grenzbefestigun-gen, Arbeiter an den Maschinen der Rüstungsfabriken und Gelehrte an den Reißbrettern und Retorten in schöpferischer Arbeit. Hunderttausende Frauen ersetzen Arbeitsplätze in den Fabriken und in der Land-wirtschaft, viele neu aufgestellte Volksgrenadier-Divisionen rückten an die Front, der Volkssturm, der alle Männer vom 16. – 60. Lebensjahre umfaßt, übernahm den Schutz der engeren Heimat, junge Mädchen [64] wurden zur Heimatflak einberufen. Ein Volk, das so tapfer, fleißig und treu ist, kann und wird niemals untergehen und mit seinem heldenhaften japanischen Verbündeten allen Feinden bis zum Endsieg trotzen. Bei uns herrscht Fleiß, Ordnung, Treue und Sauberkeit, bei unseren Feinden und in den von ihnen besetzten Ländern dagegen haben Typhus, Pest, Not, Elend, Chaos und Revolution ihren Einzug gehalten.
Unsere Aufgaben für das Jahr 1945 sind hart und schwer. Doch wird jeder von uns ausharren wie bisher und seine Pflicht erfüllen. Bedingungslos und mit vollem Vertrauen folgen wir unserem Führer, der nicht nur uns, sondern ganz Europa den Weg in die wahrhafte Freiheit zeigt. Das Jahr 1944 war das Jahr der Bewährung, mit Gottes Hilfe wird das Jahr 1945 das Jahr des Sieges und Friedens, das Jahr Deutschlands werden.
Von der Schule: Um die Jahreswende 1943/44 erkrankte Lehrer Mohr an Herzschwäche. Lehrer Fick, Hagen, wurde vom Schulrat mit der Vertretung beauftragt. Im Laufe des Jahres 1944 nahm die feindliche Fliegertätigkeit dauernd zu. Hierunter hatte der Schulbetrieb wegen Fehlens eines Luftschutzraumes schwer zu leiden. Bei Fliegeralarm wurde der Unterricht sofort eingestellt und die Kinder wurden einzeln – wegen Tieffliegergefahr – nach Hause geschickt. Benachrichtigung über erfolgten Alarm geschieht durch den Bürgermeister.
Da viele Stadtkinder auf dem Lande untergebracht werden und dort am Schulbesuch teilnehmen, stößt die Beschaffung von Lehrbüchern auf oft unüberwindbare Schwierigkeiten, so daß das Schulamt eingreifen muß und einen Austausch von Lernbüchern innerhalb der einzelnen Schulen des Kreises regelt.
Nach schweren Terrorangriffen auf Hamburg, Kiel und Neumünster werden in unserer Gemeinde 79 obdachlose Frauen und Kinder untergebracht. Am Ende des Jahres 1944 ist die Schülerzahl auf 41 gestiegen. Von den Gastkindern stammen zehn aus Neumünster, drei aus Kiel, vier aus Hamburg und eines aus Offenbach a/M. Die Leistungen dieser Kinder müßten, da sie alle miteinander aus einer achtstufigen Schule stammen, in allen Fächern viel besser sein.
[65] Für die im Nachbarort Mönkloh behelfsmäßig eingerichtete Schule stellte auf Veranlassung des Schulamtes die Gemeinde Föhrden Barl zwei viersitzige Bänke zur Verfügung. Wegen Ersparung von Feurung wurden die Weihnachtsferien vom 16. Dezember 1944 bis 15. Januar 1945 festgesetzt. Die Herbstferien fielen deshalb fort.
Zu Beginn der Weihnachtsferien veranstaltete die Fa. Rieke, die in unserer Gemeinde kriegswichtige Güter, die aus den bedrohten Ostgebieten abtransportiert waren, eingelagert hat, für Kinder und Bombengeschädigte eine Weihnachtsfeier! Sie war umrahmt von Vorträgen und Liedern der Kinder und des B.D.M. Die Feier erreichte ihren Höhepunkt, als der Weihnachtsmann mit zwei mächtigen Säcken erschien und jedes Kind reichlich beschenkte. Die Kuchen zu dieser wohlgelungenen Feier stiftete die Frauenschaft.
Von der Landwirtschaft. Auch die Landwirtschaft unserer Gemeinde hat unter den Folgen des Krieges zu leiden und hat große Opfer zu bringen; denn sie ist dazu berufen, das deutsche Volk, die vielen ausländischen Arbeiter und Kriegsgefangenen zu ernähren. Trotz Mangel an Kunstdünger wurde im Jahre 1944 infolge intensiver Bearbeitung des Bodens eine recht gute Getreideernte erzielt. Wegen der in den Monaten Juli / August herrschenden Trockenheit war die Hackfruchternte „unter Mittel“; aber trotzdem konnten die Bauern ihre Ablieferungspflicht an Rüben und Kartoffeln erfüllen. Da die Wiesen an der Au wegen Baufälligkeit der Schleuse nicht berieselt werden konnten, ließen die Heuerträge zu wünschen übrig. Wegen Mangel an Kraftfutter sind die Milcherträge stark gesunken (2.800 l je Kuh). Die Kälber werden wenige Tage nach der Geburt abgeliefert und geschlachtet. Da Fleisch und Fett rationiert sind, hat die Gänse- und Entenzucht von Jahr zu Jahr zugenommen. Viele Bauernhöfe sind, da der Mann an der Front steht, verwaist. Frauen, Kinder und Greise erfüllen in dieser schweren Zeit mehr als ihre Pflicht. Treue Arbeiter in der Landwirtschaft sind die kriegsgefangenen Franzosen und Ostarbeiter. Der polnische Arbeiter ist hinterlistig und falsch.
Zum Schutze der Heimat wurde im Laufe des Sommers und Herbstes an der Westküste der sogenannte „Friesenwall“ errichtet. Er besteht aus vielen Erdbefestigungen, Laufgräben, Einmannlöchern, Bunkern und Panzergräben. Ältere Leute unseres Dorfes wurden zur dreiwöchigen Schanzarbeit am „Friesenwall“ verpflichtet, u.a. Hr. Schnack, Hr. Schuldt, [66] R. Fölster, E. Plambeck, F. Seider, Hs. Studt, Johs. Rühmann und etliche Ostarbeiter. Das Holz zum Bunkerbau wurde zum Teil in mehrwöchiger Arbeit durch etwa 120 kriegsgefangene Franzosen im Hasselbuscher Forst geschlagen.
Aus Gesundheitsrücksichten legte Lehrer Mohr am 20.4.1944 nach fast 10-jähriger Amtstätigkeit seinen Posten als Amtsleiter der N.S.V. nieder. Zu seinem Nachfolger wurde Pg. Johs. Harbeck ernannt.
Fast alle Männer unseres Dorfes im Alter von 16-45 Jahren und darüber hinaus befinden sich an der Front und schützen mit ihren Waffen die teure Heimat. Viele von ihnen tragen im Knopfloch mit Stolz das Eiserne Kreuz, das Verwundetenabzeichen oder eine andere Auszeichnung.
Seit dem Durchbruch der Bolschewisten in der Mitte der Ostfront gelten der Obergefreite Heinrich Fengler, der Eisenbahner Johannes Lucht und der Polizei-Oberwachtmeister Ernst Kröger als vermißt. Nach dem Abfall Rumäniens haben der Stabsgefreite Hans Blunck und der Stabswachtmeister Heinrich Kock nichts wieder von sich hören lassen, so daß damit gerechnet werden muß, daß sie entweder gefallen oder in russische Gefangenschaft geraten sind. Der Unteroffizier Fritz Fölster geriet nach Mitteilung seines Hauptmannes in der Normandie in amerikanische Gefangenschaft. Willi Behnke, Feldwebel in einem Panzerregiment, büßte mit der gesamten Panzerbesatzung (Artillerie-Volltreffer) am 22. Dezember 1944 nördlich Stuhlweißenburg (Ungarn) sein Leben ein und opferte sich damit in treuer Pflichterfüllung für Führer, Volk und Vaterland. Um ihn trauern seine junge Frau und vier kleine Kinder. Der Obergefreite Hans Karstens wurde im Osten zu dritten Male schwer verwundet (Lungenschuß). Er ist bereits wieder zu seinem Truppenteil zurückgekehrt. Die Obergefreiten Ernst Studt und Ernst Thies trugen schwere Verwundungen davon, stehen aber nunmehr wieder zu neuem Einsatz bereit. Herbert Schnack hat sich von seiner zweiten Verwundung erholt und befindet sich auf dem Wege zur italienischen Front. In der dritten Kurlandschlacht wurde der Obergefreite Willi Schnack (fünf Mal) verwundet, sein Stahlhelm erhielt ihm sein Leben. Der Polizei-Hauptwachtmeister Max Fölster wurde an der italienischen Front so schwer verwundet, daß er tagelang in Lebensgefahr schwebte. Im Lazarett in Bad Bramstedt wurde er wieder hergestellt. Nachdem der Obergefreite Max Fölster bereits zum sechsten Mal verwundet wurde, [67] (Sohn des Kätners Rud. Fölster), trugen auch seine Brüder Walter und Hermann Verwundungen davon. Wachtmeister Ernst Kock befindet sich nach Wiederherstellung von seiner schweren Verwundung in Dänemark. Hans Rühmann, der bisher auf italienischem Boden kämpfte, befindet sich auf dem Wege nach Ungarn. Und wo stecken unsere übrigen Soldaten? Hauptwachtmeister Kurt Mohr in Kurland, Obergefreiter Willi Seider in Ostpreußen (früher Norwegen), Gefreiter W. Krohn auf dem Balkan, Stabsgefreiter Ernst Harbeck im Weichselbogen, Bernh. Feil bei der Flak, Hamburg, Alb. Feil im Lazarett in Bad Bramstedt, Martin Kelting in Polen und Kurt Plambeck in Ungarn. Er schreibt in seinem letzten Brief, daß es ihm nach zweitägiger Gefangenschaft gelungen sei, den Bolschewisten zu entweichen. Gefreiter Helmut Reimers befindet sich, wie so oft, nach kurzem Einsatz wieder auf Urlaub. Der Sanitäts-Obergefreite Hr. Rühmann tut z.Zt. Dienst in einem Lazarett im Sudetenland.
Wegen Mangel an Feurungsmaterial mußten viele Schulen den Unterricht einstellen und zur täglichen Aufgabenteilung übergehen. Auf dem platten Lande, wo bei gutem Willen mit Leichtigkeit hinreichend Holz und Torf hätte beschafft werden können, haben die Bürgermeister nicht hinreichend ihre Pflicht erfüllt. Dank der Fürsorge unseres Bürgermeisters Blunck, der im vorigen Sommer die Bauern zur Lieferung von Holz, Busch und Torf verpflichtet hatte, brauchte in unserem Dorfe die Schule nicht geschlossen zu werden. Für das Jahr 1945/46 ist nun vom Landrat verfügt, daß jede Gemeinde ihre Bewohner mit Feurung zu versorgen hat. Wegen Transportschwierigkeiten und Feindeinwirkung auf den Kohlenbergbau werden nämlich voraussichtlich im kommenden Jahr sämtliche Kohlenlieferungen für die Landbevölkerung eingestellt. Die Waldbesitzer unserer Gemeinde sind schon jetzt aufgefordert, 70 fm. Brennholz zu schlagen, und im kommenden Frühjahr hinreichend Torf zu graben.
Das Jahr 1945
(20.3.1945)
Im Januar 1945 gelingt es den Bolschewisten infolge ihrer Überlegenheit an Menschen und Material die Weichselfront aufzureißen. Die deutschen Truppen errichten, nachdem sie dem Feinde ungeheure Verluste beigebracht haben, eine neue Verteidigungsfront hinter der Oder, um die augenblicklich schwer gerungen wird. Die fruchtbaren Ostprovinzen fallen dem Feinde zum Opfer. Schwer und heldenmütig wird z.Zt. in Pommern, West- u. Ostpreußen und in Kurland gekämpft.
[68] Die Besatzungen der eingeschlossenen Festungen leisten den Russen Widerstand bis zur letzten Patrone, und oft gelingt dem Rest, sich zur eigenen Front durchzuschlagen. Im Westen wird ebenfalls um die Entscheidung gerungen. Ungeheure Leistungen werden auch hier von unseren heldenhaft kämpfenden Söhnen und Vätern geleistet, aber trotzdem ist es den Anglo-Amerikanern infolge ihrer Materialüberlegenheit gelungen, bis an den Unterrhein vorzustoßen und bei Remagen einen Brückenkopf diesseits des Stromes zu bilden.
Millionen von Flüchtlingen aus den verlorengegangenen Ostgebieten suchen und finden liebevolle Aufnahme im Herzen ihres Vaterlandes. Viele Volksgenossen, denen die Flucht nicht mehr gelang, erleiden die furchtbaren Greueltaten: Männer werden zusammengetrieben und verschleppt, Kinder und Greise gequält und ermordet, Frauen und Mädchen geschändet und die Gehöfte mit Vieh und Vorräten niedergebrannt. Gibt es noch einen guten und gerechten Gott? Wann kommt der Tag der furchtbaren Vergeltung? – Tag für Tag durchziehen Trecks und Einzelwagen mit Flüchtlingen unser friedliches Dorf. Man möchte ihnen so gerne helfen und sie alle aufnehmen, alle Not mit ihnen teilen und ihnen wahre Nächstenliebe erweisen! Die armen Flüchtlinge, aus deren hohlen Augen die Schrecken der letzten Wochen zu lesen sind, kommen von Königsberg, Tilsit, aus dem Warthegau und Küstrin und sind bereits 4-8 Wochen unterwegs. Die mit Stroh, Betten, Hausgerät und anderen geretteten Habseligkeiten beladenen, mit einer Plane, Bettlaken oder Säcken bedeckten Leiterwagen werden von mageren, pflasterlahmen Pferden gezogen. Durch Seuchen, Hunger und Kälte sind auf dem langen Marsche viele kleine Kinder und Greise gestorben. Ein größerer Treck von etwa 70-80 Wagen, der vor einigen Tagen unser Dorf passierte, hatte Kellinghusen als Marschziel, wo die einzelnen Familien auf die einzelnen Gehöfte der Umgegend verteilt werden sollen. Wie einige Quartiergeber mir berichten, sind die Flüchtlinge sehr genügsam, dankbar, entgegenkommend und gerne zur Mitarbeit bereit. – Täglich wird die Heimat von feindlichen Bombengeschwadern angegriffen. Die meisten Großstädte bilden nur noch einen Trümmerhaufen und doch geht die Arbeit weiter. Tiefflieger stören den Eisenbahnverkehr, beschießen die Arbeiter auf dem [69] Felde, das Vieh auf den Weiden und die Autos auf den Landstraßen. An nicht geschützten Strecken werden daher zum Schutze der Passanten vom Volkssturm „Einmannlöcher“ ausgehoben. Anfang März wirft ein Tiefflieger mehrere Sprengbomben auf den Bahnhof und auf die Wassermühle in Bad Bramstedt, in der bedeutende Getreidemengen eingelagert sind. Die Bomben verfehlten ihr Ziel, richteten aber in der Umgebung einen bedeutenden Sachschaden an. Eine evakuierte Frau, durch einen Bombensplitter getroffen, fand den Tod, ihr kleines, neben ihr spielendes Kind blieb am Leben. Beim Einflug eines großen Bombengeschwaders – Angriff Hamburg und Kiel – fielen 40 Bomben ins freie Feld bei Hingstheide. Der Krieg wird von Tag zu Tag immer schrecklicher und grausamer. Aus dem Kampf an den Fronten ist nun auch ein Morden von Frauen und Kindern in der Heimat geworden.
Nach dem Verlust der Überschußgebiete im Osten müssen die Lebensmittelrationen bedeutend gekürzt werden, so daß sie kaum ausreichen. Von den im Herbst vergangenen Jahres eingekellerten drei Zentnern Kartoffeln (je Kopf) müssen 25 kg wieder zurückgegeben werden, die Einschlachtungen – 40 kg pro Person – müssen zwei Monate länger reichen, die Brot- und Nährmittelrationen werden bedeutend gekürzt, Gänse, Enten und Puten sollen bis zum 1. April abgeschlachtet werden und die Hühnerhalter ihren Bestand auf eine Henne je Person ermäßigen. Die Bauern werden angehalten, einen großen Teil ihrer Äcker mit Gemüse, insbesondere mit Kartoffeln, Kohl, Erbsen und Bohnen zu bepflanzen; denn nur so wird es möglich sein, die notdürftige Ernährung des deutschen Volkes sicher zu stellen und eine Hungersnot abzuwenden.
Infolge des Zustromes von Flüchtlingen, die meistens viele Kinder mitbringen, steigt die Schülerzahl von Woche zu Woche und erreichte am 19. März 1945 die Zahl 49.
Da die Schulfeurung an die Evakuierten verteilt werden mußte, wurde am 28. Januar der Schulunterricht eingestellt und vom Schulamt der tägliche Aufgabenunterricht angeordnet. (Bericht vom 19.3.1945 von W. Mohr).
1943/44 erbrachte die Sammlung für das WHW innerhalb der Ortsgruppe 3.554,42 RM
1944 erbrachte die Sammlung für das deutsche Rote Kreuz innerhalb der Ortsgruppe 1.426,76 RM
[70] Die letzten Kriegstage und der Zusammenbruch.
Immer weiter dringen die Feinde im Osten und Westen vor. Die Russen haben die Oderlinie erreicht, belagern Breslau und bedrohen die Reichshauptstadt. Die Anglo-Amerikaner haben den Rhein überschritten und stehen bereits im Herzen unseres Vaterlandes. Und doch gibt es noch Leute, die an das große Wunder glauben, das eine Wendung und glückliches Ende des furchtbaren Krieges bringen soll. Man spricht von geheimnisvollen Wunderwaffen und Flugzeugen, denen kein Feind gewachsen ist, doch die Mehrzahl des Volkes hat jegliche Hoffnung an einen glücklichen Ausgang des Krieges verloren. Furchtbar haben wir in der Heimat unter den Tieffliegern zu leiden. Der Schulunterricht muß daher eingestellt werden (Ende April 1945). Wie wir die letzten Tage des Krieges und den Zusammenbruch erlebten, zeigen Briefe, die ich an meinen Sohn, der an der Kurlandfront steht, richtete.
Föhrden Barl, 2. Mai 1945
Lieber Sohn! Als wir gestern mit höchster Spannung am Rundfunk versammelt waren, vernahmen wir, daß der Führer im Kampfe um Berlin den Heldentod gefunden habe. Für mich kam dieses Ereignis nicht überraschend, denn als Dr. Göbbels der Welt mitteilte, Hitler sei nach der Reichshauptstadt geflogen, um dort die Leitung der Kampfhandlungen zu übernehmen, war mir klar, daß er dort sterben würde. Sein ganzes Leben galt der Vernichtung des Bolschewismus, und in diesem Kampfe opferte er sich schließlich selbst. – Adolf Hitler war ohne Frage ein großer Mann voller Ideale, doch hat er es m.E. nicht verstanden, die richtigen und geeigneten Männer, die das Vertrauen des Volkes genossen, zu berufen. – Deutschlands Innenwirtschaft ist unter seiner Führung aufgeblüht, die Arbeitslosigkeit beseitigt, das Verkehrsnetz ausgebaut, alle Deutschen zum Großdeutschen Reich zusammengeschlossen usw., doch die Auslandspolitik versagte unter seiner Führung vollständig. Auch hier fehlten die geeigneten Männer. Hätte Adolf Hitler nach der Machtübernahme seine Mitarbeiter mit einem großen Sieb gesichtet und die Nieten beseitigt, welch großer Zukunft wären wir entgegengegangen. Der Führer fühlte sich als der größte Politiker, Heerführer, Künstler, Redner und Baumeister aller Zeiten und wurde auch vom Volke als solcher gefeiert und anerkannt, doch die Geschichte wird vielleicht einst ein anderes Urteil fällen! Ruhe seiner Asche!
[71] Groß-Admiral Dönitz wurde vom Führer persönlich zum Nachfolger bestimmt und nicht, wie die meisten Volksgenossen glaubten, Himmler, an dessen Händen allzuviel Blut unschuldiger Menschen klebt. Dönitz ist politisch unbelastet und daher vielleicht in der Lage, das sinkende Schiff in letzter Stunde vor dem Untergang zu retten. Ich glaube allerdings kaum, die Anglo-Amerikaner zum Abschluß eines Waffenstillstandes zu bewegen, dazu ist es zu spät! Die nächsten Tage werden uns über vieles aufklären! Gewiß, auch unsere Gegner sind kriegsmüde und wollen den Kampf auf jeden Fall beenden. Allzu große Hoffnung auf eine Entzweiung der Großmächte zu setzen, könnte bittere Enttäuschungen bringen! – Der Feind steht vor Hamburg, hat bei Lauenburg die Elbe überschritten und nähert sich unserer schönen Heimat. Es ist ja nicht ausgeschlossen, daß bereits morgen oder doch in den allernächsten Tagen feindliche Panzerspitzen unser friedliches Dorf durchfahren! Wir haben uns auf alles vorbereitet und die erforderlichen Vorkehrungen getroffen: Splittergräben ausgeworfen, Kleidung und Eßwaren in den Keller gebracht oder vergraben. In unserem Dorfe liegen z.Zt. zwei Generäle mit ihren Stäben, unsere ganze Gegend gleicht einem mächtigen Heerlager. Dazu kommen die unzähligen Flüchtlinge, die untergebracht werden müssen. Jedes Haus ist bis auf den letzten Platz überfüllt. – Besonders arg werden wir z.Zt. von den Tieffliegern, die die Verkehrswege und Eisenbahnen unter Beschuß halten, heimgesucht. Eisenbahnzüge und Lokomotiven, von vielen Geschoßgarben durchsiebt, stehen auf den Geleisen oder sind ausgebrannt und am Rande der Reichsstraße liegen viele demolierte ausgebrannte Autos. Auf der Chaussee herrscht z.Zt. ein Autoverkehr, wie ich ihn noch nie erlebte. Zwischen den vollbeladenen Autos fahren Trecks mit Flüchtlingen, die aus der Gegend von Berlin, aus Vorpommern und Mecklenburg kommen. Verwundete pilgern längs der Straße – ohne Verpflegung, ohne Ziel und Unterkommen. Fast täglich werden manche von ihnen durch uns gesättigt. In der vorigen Nacht zum Beispiel brachten wir einen Hauptmann mit seiner vierköpfigen Familie unter. Wie dankbar sind die Leute, wenn sie nur ein Dach über dem Kopf und ein einfaches Strohlager haben.
Im Hause von Hans Schnack ist das Standgericht untergebracht. – Die Bahn ist stillgelegt und die Post geht sehr langsam. Ich glaube daher kaum, daß dieser Brief Dich noch erreichen wird. – Mutter und ich machen uns schwere Sorgen um Dich! Hoffentlich wird man Euch [72] noch in letzter Stunde über See abtransportieren. Halte nur den Kopf aufrecht und verliere nicht den Mut, es kann noch alles gut werden! Von Deiner lieben Frau und Deinem Klein-Peterlein haben wir keine Nachricht, denn das Geleise nach Heide ist unterbrochen. Hoffentlich überstehen wir alle diese furchtbare Zeit und sehen uns alle miteinander in der Heimat wieder. Das ist unser einziger Wunsch, alles andere wird sich finden!
Deine Eltern. (Wilh. Mohr
u. Frau Anna, geb. Runge.)
6.5.1945. Die Anglo-Amerikaner stehen bereits östlich von Bramstedt und sind nur noch zehn Kilometer von uns entfernt. Unser friedliches Dorf gleicht einem Heerlager. In den letzten Tagen strömten ungeheure Autokolonnen gen Westen. Die Tiefflieger räumen furchtbar unter ihnen auf und immer mehr ausgebrannte Fahrzeuge liegen am Straßenrand. So wurde zum Beispiel am Mittwoch ein Auto bei H. Schnacks Kate zusammengeschossen. Die Wände des Hauses sind durchlöchert, die Fenster zersplittert. Zwei Mann (Evakuierte) wurden leicht verwundet. Bei Hans Schnack ist ein Arzt als Flüchtling – aus Westpreußen – untergebracht, der sofort Hilfe bringen konnte. – In der Nacht vom Donnerstag/Freitag rüttelte es bei uns an der Haustür. Die Schulstube mußte sofort für einen Stab eines Armeekorps geräumt und freigemacht werden. Die Offiziere sind äußerst zuvorkommend und freundlich, doch Mutter hat von ihnen viele Mühe und Arbeit. Der Stab hatte die Absicht, am nächsten Tage wieder abzurücken, doch daraus wurde nichts, denn es waren Verhandlungen mit den vorrückenden Engländern eingeleitet und der Oberleutnant teilte uns noch am Abend vertraulich mit: Morgen früh 8 Uhr ist Waffenruhe! Wir können fürwahr Gott danken; denn so sind wir vorläufig vor den Schrecken des Krieges verschont geblieben und haben unsere Habe und unser Heim behalten. Einen Engländer, den die Soldaten als Gefangenen eingebracht hatten, ließ man wieder laufen. – Noch gestern waren die beiden Anhöhen zu beiden Seiten der Bramau von unseren Truppen besetzt, hinter Wällen und Knicks und den an der Chaussee gegrabenen Einmannlöchern saßen junge Burschen mit ihren Panzervernichtungswaffen, doch heute ist jeder Widerstand aufgegeben und stündlich erwarten wir das Eintreffen englischer Panzer. Alle Soldaten und die gesamte Bevölkerung atmen auf. Was nun kommen wird, muß die Zeit lehren! Einzelne Soldaten versuchen Lebensmittelvorräte und ganze Fahrzeuge an Bauern zu verkaufen, doch keiner (fällt) [73] geht darauf ein. – Leider haben in den letzten Kriegstagen Itzehoe, Kellinghusen und Wrist unter den Tieffliegern recht stark gelitten. In Wrist ging ein Munitionszug in die Luft, durch den Luftdruck wurden fünf Häuser vollständig zerstört, viele beschädigt. Auch in unserem Dorfe wurden viele Fenster zertrümmert und Dächer abgedeckt.
Durch den Landrat wurde die Jagd auf Rehböcke bereits am 1. Mai freigegeben und so war es uns noch möglich, vor Eintreffen der Engländer mehrere Böcke abzuschießen und den Keller aufzufüllen.
9.5.1945. Nach langen schweren Tagen herrscht endlich wieder Ruhe im Haus und in den beiden letzten Nächten haben wir wieder ruhig und ungestört schlafen können. Unsere Truppen haben überall bedingungslos kapituliert; denn ein weiterer Widerstand wäre direkt sinnlos gewesen. Wieviel Blut ist in den letzten Wochen und Monaten umsonst vergossen, wie viele Wohnungen wurden noch in den letzten Stunden unnütz zerstört und dadurch Hunderttausende obdachlos gemacht. Die letzte Zeit dieses gewaltigsten Ringens aller Zeiten war purer Wahnsinn, und unsere Führung muß gewußt haben, daß es so und nicht anders enden konnte. Man hat den Führer belogen – sämtliche Eingaben und Berichte verschönert, schwere Waffen, Benzinvorräte, Flugzeuge und Munitionsbestände bestanden in Wirklichkeit nur auf dem Papier – und das gesamte Volk belogen wie noch nie. Damit hat die gesamte Führung ein unerhörtes Verbrechen auf sich geladen und verdient eine gerechte Strafe, jedoch nicht als Kriegsverbrecher durch die Feinde, sondern durch das deutsche Volk selbst.
Hätten sich die Minister, Gauleiter usw. in der Stunde der größten Not an die Spitze waffentragender Helden gestellt und wären in offener Schlacht gefallen, hätte ich noch eine gewisse Achtung vor ihnen gehabt, doch die allermeisten versuchten zu entkommen oder endeten durch Selbstmord. Vom Volke verlangten sie Kampf bis zum letzten Blutstropfen, Treue bis in den Tod! Doch sie selbst zeigten sich als die größten Feiglinge aller Zeiten. – Der Kreisleiter Stiehr hatte die Verteidigung der Stadt Segeberg befohlen. Er wurde verhaftet und nach Abschied von seiner Familie ins Konzentrationslager abgeführt. Der stellvertretende Kreisleiter, gleichzeitig Bürgermeister der Stadt Segeberg hat sich und seine Familie durch Gift selbst gerichtet. Auch der greise Landrat v. Mohl befindet sich in Gewahrsam. Und wer muß nun für die unsinnige Tat der Führung büßen? – Nur die arme Bevölkerung, [74] die bereits jahrelang Not und Entbehrungen ertragen mußte und immer durch schöne Reden und Prophezeihungen hingehalten wurde, hat alles zu ertragen. In Segeberg mußten sofort sämtliche Villen für eine englische Besatzung in Höhe von 1.000 Mann geräumt werden. Bad Bramstedt dagegen erhielt nur eine Besatzung von 50 Mann, die im Kurhaus „An den Auen“ untergebracht sind. Dörfer wurden bisher nicht belegt. – Immer wieder predigte unsere Führung den Sozialismus der Tat. Und wie sieht es in vielen Orten in Wirklichkeit aus? In dem Dorfe Mötzen trafen die Engländer Flüchtlinge aus dem Osten, die äußerst primitiv auf einer großen Diele untergebracht waren. Auf Befehl der Engländer konnte der Herr Bürgermeister jedem Flüchtling ein „menschenwürdiges“ Quartier zuweisen und zwar innerhalb einer Stunde. In der Leitung des Bramstedter Lazarettes wurde, da nicht alles in Ordnung vorgefunden wurde, gründlich aufgeräumt.
Leider kam es in den ersten Tagen zu Plünderungen von Wein- und Bekleidungslägern durch Russen und Polen. Sogar Bauern sollen an diesen Plünderungen teilgenommen und ganze Wagen voll beladen mit Leinen und Wäsche abgefahren haben. Von der englischen Besatzungsbehörde wurde darauf auf Plünderung die Todesstrafe verhängt.
Um überall die Ruhe und Ordnung wieder herzustellen, blieben Teile der deutschen Wehrmacht zunächst unter den Waffen. So sollten zum Beispiel Reste einer SS-Division im Segeberger Forst Widerstand leisten. Beim Durchsuchen des Waldes wurden über 600 bewaffnete ehemalige kriegsgefangene Russen eingebracht und der englischen Besatzungsbehörde übergeben. Auch im Osten unseres Kreises mußte gegen plündernde Polen und Russen eingeschritten werden. Diese hatten sich eigenmächtig bewaffnet und waren in die Bauern- und Gutshäuser eingedrungen, schmausten nach Herzenslust, legten sich mit ihren Dirnen in die Betten der Bauern und raubten und plünderten. Unsere Truppen stellten innerhalb weniger Stunden die Ruhe und Ordnung wieder her. So vermeidet der Engländer einen Zusammenstoß mit den Ausländern!
Die ersten französischen Kriegsgefangenen wurden bereits abtransportiert. Sie und auch die von den Engländern eingesetzten deutschen Truppen werden aus englischen Beständen verpflegt. Jeder deutsche Soldat versucht so schnell wie nur irgend möglich seine Heimat zu erreichen. Als Beförderungsmittel werden mit Vorliebe Fahrräder und Karren benutzt. Alleine in Wrist wurden der Bevölkerung in den letzten Tagen 26 Fahrräder gestohlen. Die Landstraßen sind noch unsicher; denn oft kommt es vor, daß ein Pole, Russe oder sogar ein deutscher Landser einen [75] Radfahrer mit vorgehaltenem Revolver zwingen, sein Rad herzugeben. In oder bei Kisdorf wurde bei einem solchen Raubüberfall ein Bauer mit seinem Sohn von Russen erschossen. In den Wäldern, am Knick und an Wegen liegen noch überall Waffen und Munition umher. Auf Anordnung der Besatzungsbehörde fuhr gestern wieder der erste Güterzug. Die Lokomotive wird mit Holz und Torf geheizt. Der Postverkehr ist eingestellt, die Zeitungen erscheinen nicht mehr und da wir keinen elektrischen Strom haben, kann man auch keine Nachrichten hören. Man lebt wie auf dem Monde!
Wohl rollen oft Autos mit englischen Truppen an unserem Hause vorbei, doch sonst bekommt man kaum Besatzungstruppen zu sehen. Überall herrscht Ruhe und Ordnung und das ist schön! Unsere Soldaten werden zunächst in Sammellagern gesammelt, um von hier aus entlassen zu werden oder zum Arbeitseinsatz zu gelangen.
Heute wird uns erzählt, daß viele Schiffe mit Kurlandtruppen vor Kiel eingetroffen sind. Kurt, bist auch Du unter ihnen?
12.5.1945. Lieber Kurt! Wir denken täglich an Dich und machen uns mit Deiner Erna und dem kleinen Peterlein schwere Sorgen um Dein Wohlergehen. Bist Du aus Kurland herausgekommen? Hast Du die Überfahrt glücklich überstanden? Vielleicht stehst Du schon nach wenigen Tagen vor uns. Und wie wir machen sich viele hunderttausend deutsche Eltern Sorgen um ihre Söhne. Ich suche täglich Zerstreuung durch nützliche Gartenarbeit. In den Blüten der Obstbäume summen die fleißigen Bienen. Auf der Reichsstraße ziehen viele, viele entlassene Soldaten per Rad, mit beladenen Karren, per Auto oder auf Schusters Rappen mit Gepäck schwer beladen vorbei, Richtung: Heimat! Einige bespannte Einheiten haben die Pferde ihren entlassenen Mannschaften überlassen, die nun hoch zu Roß ihres Weges ziehen. Fast in jeder Nacht übernachten mehrere Soldaten auf dem im Schulzimmer errichteten Strohlager.
Das Betreten der Straße von 9 Uhr abends bis 7 Uhr morgens ist der deutschen Bevölkerung, jedoch auch den ausländischen Arbeitern, die sich wie die Herren gegen uns aufspielen, verboten. Keiner darf sich aus dem Orte entfernen. Die Hauptstraße darf nicht benutzt werden und wird für militärische Zwecke freigehalten. Jagdwaffen, Ferngläser und Photo-Apparate müssen sofort beim Bürgermeister abgeliefert werden.
[76] Ich muß mich über einige ehrlose Partei- und Volksgenossen wundern. Früher waren sie 150% Nazi und jetzt wollen sie plötzlich immer Gegner des Führers gewesen sein. Sie versuchen, sich beim Engländer anzuschmusen, doch dieser straft sie mit Verachtung.
Täglich passieren viele Geschütze und Fahrzeuge, die in Bad Bramstedt an die Besatzungstruppen abgeliefert werden müssen, unseren Ort.
Kriegsgefangene Franzosen und Polen üben die Polizeigewalt aus. Man hat ihnen unsere Jagdwaffen überlassen und schießen nun alles Wild wahllos ab, sogar tragende Ricken und Hasen. Unsere Soldaten werden es vordem in Feindesland ebenso gemacht haben und nun kommt der Gegenhieb!
18. Mai 1945. Wilde Gerüchte sind im Umlauf. 7.000 Gefangene, insbesondere Panzertruppen, die den Rückzug deckten, sollen den Russen in Kurland in die Hände gefallen sein, die übrigen Truppen, rund 500.000 Mann, sollen auf Bornholm, an der Lübecker- und Kieler Bucht, bei Eckernförde, Kappeln u. Flensburg gelandet sein. Hoffentlich bestätigt sich diese Nachricht.
Laut Anschlag der Besatzungsbehörde haben sich sämtliche Angehörige der deutschen Wehrmacht innerhalb der englischen Besatzungszone bei Androhung der Todesstrafe sofort zu stellen, um als Kriegsgefangene einem Sammellager zugeführt zu werden. Die SS ist als Freiwild erklärt und soll restlos ausgemerzt werden. Sämtliche Morde an Juden werden der SS in die Schuhe geschoben. Oft soll die SS es auch zu arg getrieben haben, und nun müssen die Unschuldigen mit den Wölfen heulen. Im Lazarett zu Bad Bramstedt sind die Verwundeten der SS gesondert gelegt, liegen nur auf Pritschen, erhalten nur die halbe Verpflegung, werden nur notdürftig verbunden und ein englischer Posten hat aufzupassen, daß keiner von ihnen entflieht.
Entsetzliche Zustände wollen die Anglo-Amerikaner in den deutschen Konzentrationslagern festgestellt haben, und Insassen, die aus ihnen entlassen wurden, bestätigen dies. Die Haare stehen einem zu Berge, wenn man solche Berichte hört oder liest. Wie kann es solche Bestien in Menschengestalt unter uns Deutschen geben!
Sämtliche politischen Leiter vom Ortsgruppenleiter aufwärts sollen verhaftet und einem Konzentrationslager zugeführt werden, ihr Vermögen wurde bereits beschlagnahmt. So wurden zum Beispiel der Bürgermeister von Bramstedt, der Ortsgruppenleiter von Bramstedt (Dr.) Johannsen; der Ortsgruppenleiter von Hagen (Schurbohm), und der Ortsgruppenleiter von Wrist (Reese) verhaftet, die meisten von ihnen sind jedoch vorläufig wieder freigelassen.
[77] In einigen Ortschaften mußte die Bevölkerung sämtliche Fahrräder, vereinzelt sogar Nähmaschinen und Radio-Apparate abgeben. Noch immer ruht der Eisenbahn- und Postverkehr, wir sind ohne Elektrizität und ohne Nachrichten. Auch in Bramstedt mußten nunmehr viele Wohnungen für die englische Besatzung geräumt werden (130 Mann), und dabei sind in Bramstedt noch immer 5.500 Flüchtlinge untergebracht. Für die Polen, die herrschaftlich im „Schloß“ untergebracht sind, mußten sofort 200 Betten, Anzüge, Leibwäsche, Schuhwerk usw. von der Bevölkerung von Bad Bramstedt und Umgebung zur Verfügung gestellt werden. Mit Arbeitgebern, die ihre ausländischen Arbeiter schlecht behandelten, machen die Engländer kurzen Prozeß. Die Lebensmittelrationen werden auf 2/3 herabgesetzt. Überall herrscht Ruhe und Ordnung!
Wir haben dauernd Einquartierung von deutschen Truppenteilen. Im Schulzimmer sind auf einem Strohlager die Mannschaften des Stabes der „Tiger-Panzer“ Abt. „Schanze“ untergebracht. Der Schulplatz steht voller Autos.
Neue Bürgermeister werden ernannt, sämtliche amtierende Bürgermeister, die vor der Machtübernahme Parteigenossen waren, werden ihres Postens enthoben (von 14 – 12). Der Buchhändler Warnemünde wird zum Bürgermeister von Bad Bramstedt ernannt. Ihm werden 14 umliegende Gemeinden unterstellt. Heinrich Harbeck wird anstelle unseres früheren Partei- und Ortsgruppenleiters G. Blunck für Föhrden Barl bestimmt. Da keine Zeitungen erscheinen, werden die Bekanntmachungen öffentlich ausgehangen. Die Ausgehzeit dauert nunmehr von morgens 5 Uhr bis abends 10.15 Uhr. Während sich zu Beginn der englischen Besatzung kein Einwohner weiter als fünf Kilometer von seinem Wohnsitz entfernen durfte, wurde diese Bestimmung für uns bald auf den Kreis Segeberg und vor kurzem auf das Gebiet der Provinz Schleswig-Holstein erweitert. An der Spitze unseres Kreises steht ein englischer Oberst, dessen Anweisungen peinlich genau befolgt werden müssen.
Ein unerhörter Vorfall. Gestern abend veranstalteten die Offiziere unter ihrem Obersten (Panzer Abt. Tiger „Schanze“) bei unseren Evakuierten Putenschmaus mit anschließendem Saufgelage, auf dem es toll herging, so daß meine Frau und ich bis 2.30 Uhr keine Ruhe fanden. Nach Beendigung der Feier ging es singend und polternd die Treppe hinunter ins Zimmer des Zahlmeisters Köhne, um dort die Sauferei fortzusetzen. Als ich dann vom Schlafzimmer aus um Ruhe bat, begannen die „Herren Offiziere“ zu schimpfen und [78] zu pöbeln, so daß ich mich zu der Bemerkung hinreißen ließ: „Wenn man im eigenen Hause keinen Schutz mehr gegen deutsche Offiziere hat, dann ist es schließlich doch gut, daß wir zum Schutze eine englische Besatzung haben!“ Darauf drangen die Offiziere ins Schlafzimmer und versuchten handgreiflich zu werden, drohten mit Erschießen und Anzünden des Hauses. Es gelang uns unter Aufbietung aller Mühe – unter Hilfeleistung und Zureden des Oberzahlmeisters und zweier junger nüchterner Offiziere die Unholde aus dem Zimmer zu entfernen, doch bald begann das Pöbeln aufs neue. Schließlich versuchte der „besonders gebildete“ Herr Hauptmann, die Tür mit den Absätzen einzuschlagen. Als diese zu krachen anfing, hielten meine Frau und ich es für richtig, im Nachthemd durchs Fenster zu entfliehen, um bei Nachbarn Schutz und Unterkunft bis zum nächsten Morgen zu suchen. Der Herr Oberst hat es nicht für nötig befunden – trotz Aufforderung – sich und seine Offiziere zu entschuldigen. Von einer Anzeige habe ich aus leicht verständlichen Gründen abgesehen. Wenn unsere Offiziere, die doch mit gutem Beispiel vorangehen sollen, im eigenen Vaterland so hausen, wie mögen sie in Feindesland gehaust haben! Ja – leider – kann man das Auftreten der Besatzungstruppen verstehen!
Ähnlich so traten auch drei deutsche Offiziere beim Bauern Hans Rühmann auf, die den Sohn zwangen, auf dem Fußboden zu schlafen und sich in die Betten legten (22.5.1945).
23.5.1945. Größere Ortschaften erhalten eine englische Besatzung, für die die besten Häuser in kürzester Frist von den deutschen Familien geräumt werden müssen. Die Besatzung verhält sich im allgemeinen korrekt, ist teilweise sogar freundlich und entgegenkommend. Ihr ist jedoch verboten, mit Deutschen zu sprechen und zu verkehren. Als im Nachbarort ein deutscher Fliegeroffizier vorbeifahrende Engländer höhnisch anlacht, nehmen diese ihn in ihrem Auto mit, werfen ihn bei Stellau in die Bramau und beschießen ihn im Wasser mit ihren Pistolen. Wer am Abend nicht rechtzeitig zu Hause ist, muß damit rechnen, daß er von der englischen Streife verhaftet wird. Durch Anschlag werden mehrere solche „Opfer“ bekanntgegeben. Die geringste Strafe beträgt 14 Tage Gefängnis. Wegen Waffenbesitzes wurde ein Segeberger mit zehn Jahren Zuchthaus bestraft. Polen und Russen, die die Bevölkerung belästigen oder den Versuch machen zu plündern werden bestraft und Sammellagern zugeführt. Der Bürgermeister Hauschild, der einen Polen schlug, wurde verhaftet und zur Strafe mußten die Bauern dieser Gemeinde ihre besten Stuben für die Polen räumen und mit weichen Federbetten ausstatten. [79] Überall sieht man nur ernste und traurige Gesichter. Wehe, wehe den Besiegten!
5.6.1945. In den letzten Tagen hat sich manches zugetragen, aber nur wenig Erfreuliches. Alle deutschen Soldaten müssen sich einem Gefangenenlager stellen, von dem sie alsdann entlassen werden. Landwirte, landwirtschaftliche Arbeiter und Handwerker werden bei der Entlassung bevorzugt. Jeden Tag werden aus den Sammellägern 5.000 Kriegsgefangene entlassen. Jeden Morgen fahren viele von ihnen auf Lastautos vorbei und winken einem zu. A. Feil, B. Feil und H. Behnke mußten sich wieder stellen, von ihnen ist bisher letzterer zurückgekehrt. Von den Soldaten, die in Kurland, Ungarn, Italien usw. kämpften, wissen ihre Angehörigen nichts; denn die Postverbindung ist immer noch nicht aufgenommen – ein schrecklicher Zustand! – Viele Soldaten versuchen der Gefangenschaft zu entgehen und versuchen, die Ortschaften mit deutsch-englischen Posten zu umgehen, die Elbe oder den Kanal mit Booten, Fähren und dergleichen zu überqueren. Die allermeisten von ihnen werden jedoch geschnappt und ihr Los wird nur noch schlechter. Die englische Besatzungsbehörde hat den Hausbesitzern bei schwerster Strafe verboten, des Nachts deutsche Soldaten ohne Nachweis zu beherbergen. Täglich passieren viele schwerbeladene Soldaten unser Dorf, sprechen um Lebensmittel vor und streben der Heimat zu.
In letzter Zeit wurden von Polen und englischen Soldaten an verschiedenen Stellen – bei J. Harbeck, Seider, A. Feil u. Steenbock – unberechtigte Haussuchungen vorgenommen. Die Hausbewohner wurden in einem Zimmer eingeschlossen und darauf das ganze Haus durchwühlt, silberne Uhren, silbernes Ge-schirr, Schmuck und Radiogeräte wurden mitgenommen. Der Evakuierte Hermann wurde wegen Miß-handlung von Polen verhaftet und nach Fuhlsbüttel verschleppt. In der Nacht vom 2./3. Juni drangen englische Soldaten in einige Häuser und belästigten Frauen. Die Besatzungsbehörde duldet solche Übergriffe nicht und geht strenge gegen die Übeltäter vor, doch meistens entkommen diese unbekannt.
Am 31. Mai ereignete sich in Bad Bramstedt eine furchtbare Explosion der auf dem „Schäferberg“ bei dem Gehöft des Bauern Martens gestapelten deutschen Munition, die durch 30 deutsche und englische Feuerwerker entschärft wurde. Ursache: Unvorsichtigkeit beim Entschärfen, so daß die deutsche Bevölkerung keine Schuld am Unglücksfall trifft. Die Explosionen dauerten drei Stunden. Durch zwei äußerst starke Detonationen wurden zwei Häuser vollständig dem Erdboden gleichgemacht, viele Häuser stark beschädigt, abgedeckt und Fenster zertrümmert. Furchtbar sehen die Häuser in der Nähe der Unglücksstätte aus. 20 Tote – meistens Soldaten – und etwa 30 – 40 Verletzte.
[80] Der ehemalige Amtsvorsteher und Ortsgruppenleiter Willy Schurbohm, Hagen, der als Sonderführer im Kurland tätig war, wird sofort nach seiner Ankunft von den Engländern verhaftet, jedoch nach wenigen Tagen zwecks Bewirtschaftung seines landwirtschaftlichen Betriebes vorläufig beurlaubt. Kürzlich wurden die kriegsgefangenen Franzosen nach ihrer Heimat abtransportiert. Sie waren treue und gute Arbeiter und wurden auch dementsprechend behandelt. Hoffentlich folgen nun auch bald die Polen und Russen!
Sämtliche deutschen Autos und Krafträder mußten auf der sogenannten Rennkoppel in Segeberg an die englische Besatzungsbehörde abgeliefert werden.
8.6.1945. Dauernd herrliches Wetter. Der Roggen steht in Blüte, die Wiesen werden gemäht, die ersten Erdbeeren sind bereits reif. Man kann bereits die ersten Erbsen pflücken und nach wenigen Tagen die ersten Frühkartoffeln aufnehmen. Das Getreide steht weniger gut.
Das der Fa. Reemtsma gehörende Tabaklager bei B. Feil wird wegen Plünderungsgefahr abgefahren. 120 Ballen je 30 kg fehlen bereits. Bei der Verteilung von zwei Ballen an die Bevölkerung kam jeder zu seinem Recht.
Da die Polen und Russen nicht mehr arbeiten, herrscht in der Landwirtschaft großer Mangel an Arbeitskräften.
8.6.1945. Die Schulstube wird nach 4-5 Belegungen mit deutschen Soldaten geräumt, tadellos gesäubert und für die Polen als Tagesraum eingerichtet. Die Gemeinde hat den Polen einen guten Radioapparat zur Verfügung zu stellen.
12.6.1945. Bad Bramstedt erhält eine stärkere englische Besatzung, weitere 35 Häuser müssen geräumt werden. Auch Hitzhusen bekommt eine englische Besatzung von 30 Mann, die drei Häuser für sich in Anspruch nehmen. Dauernd fahren viele englische Panzer durch Bad Bramstedt Richtung Neumünster und dann weiter gen Osten, an einem Tage oft über 150 – wozu? Es stimmt etwas nicht!
18.6.1945. Auf der Straße herrscht dauernd reger Autoverkehr. Die ersten deutschen Kriegsgefangenen sind heimgekehrt: H. Behnke, W. Evers, Wilh. Kröger und Hans Karstens, Wilh. Krohn. Herzlich willkommen in der Heimat!
In der Nacht wurden in unserem Dorfe verschiedene Diebstähle ausgeführt und zwar hatten die Diebe es auf Lebensmittel abgesehen. Bei M. Kelting, Hr. Rühmann und Johs. Karstens wurden Keller, Speisekammer und Dachkammer entleert. Durch Engländer wurden bei Johannsen und Plambeck unbefugt Radio-Apparate beschlagnahmt. Die Besatzung eines englischen Panzers schoß von der Reichsstraße aus auf Hr. Rühmanns Arbeitspferde (Wr. Kamp), ein Pferd wurde am Bein verwundet. (Bem.: Es sollen Polen gewesen sein.)
[81] 2.7.1945. Die ganze Bevölkerung lebt in Spannung über das Schicksal und die Zukunft des Einzelnen und des gesamten Vaterlandes. Bisher haben sämtliche Beamte einen Fragebogen erhalten, in dem Auskunft über Parteizugehörigkeit und Wirksamkeit in der Partei verlangt wird. Ich mußte zum Beispiel angeben, daß ich am 1.Mai 1933 in die Partei eingetreten, von 1935 – 1944 Amtsleiter der National-Sozialistischen-Fürsorge und Inhaber der Medaille für Volkspflege gewesen sei, ferner: ob man von der Partei finanzielle Vorteile gehabt habe. Letzteres trifft bei mir nicht zu. Nach Prüfung des Fragebogens stellt mir der Schulrat Steffens durch den Bürgermeister folgendes Schreiben zu:
Das Schulamt. Bad Segeberg, den 19.6.1945.
An den Lehrer Herrn W. Mohr
in Föhrden Barl.
Auf Anordnung der Militärregierung haben Sie mit sofortiger Wirkung aus Ihrem Amte auszuscheiden.
Für das Schulamt: Der komm. Schulrat (gez. Steffens.)
Meine sämtlichen Bankkonten werden gleichzeitig gesperrt.
Diese Hiobsbotschaften treffen uns wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Wir fragen uns: Warum? Was soll aus uns werden? Werden wir vorläufig wohnen bleiben dürfen usw.? Gott sei Dank verfügen wir über reichlich Bargeld, Bruder Karl zahlt uns die Landpacht in Höhe von 750 RM, unsere Lebensmittelvorräte sind nicht gering und so halten wir uns schon eine Zeitlang ohne Gehalt über Wasser. Ebenso wie mir ergeht es 2/3 der gesamten Lehrerschaft des Kreises und warum? – Weil sie gute und aufrechte Deutsche sind, ihr Vaterland über alles lieben und stets nur ihre Pflicht kannten. Wie mir gestern Paul Harder (früher Lehrer in Hitzhusen) aus Wakendorf, der wegen seiner Ausscheidung aus dem Amte beim Schulrat vorstellig war, sagte, teilt die Militärregierung die Gründe der Entfernung aus dem Amte – wir kennen sie! – nicht mit, und die eventuelle Zahlung einer Pension sei Sache des deutschen Staates.
Seit dem 1. Oktober 1907, also fast 40 Jahre bin ich nun Lehrer der Gemeinde Föhrden Barl, habe viel Freude und nur wenig Leid während dieser langen Zeit erfahren, fast sämtliche [82] Bauern des Dorfes und deren Kinder waren meine Schüler, ihr Leid war mein Leid, ihre Freude meine Freude. Viele kamen zu mir, und gerne erteilte ich ihnen den begehrten Rat. So manchem im Dorfe und in der Familie habe ich immer und gerne geholfen, obgleich bereits feststand, daß ich mein Geld nie wiedersehen würde. Als Jäger habe ich jahrelang die heimatlichen Gefilde bejagt, als Fischer die Au abgefischt – ja enger als ich war keiner mit seiner lieben Heimat verbunden!
Als Geschäftsführer der Spar- und Darlehnskasse habe ich von 1921 – 1937 nur das Wohl der Mitglieder im Auge gehabt. Alle Verlockungen, mir finanzielle Vorteile zu verschaffen, habe ich stets abgelehnt, und so blühte die Wirtschaft der Gemeinde auf!
Ich habe mein 60. Lebensjahr bereits überschritten; aber obgleich ich mich z.Zt. alt und müde fühle, wird auch meine weitere Arbeit nur ein Ziel haben, nämlich mitzuarbeiten an dem Aufbau unseres armen, in allen Richtungen geknebelten deutschen Vaterlandes. Der Krieg ist verloren; aber trotzdem dürfen wir nicht verzagen: Deutschland darf und wird nicht untergehen!
3.7.1945. Infolge des fast 6-jährigen Krieges herrscht unter der deutschen Bevölkerung großer Mangel an Kleidung und Wäsche. Manch heimgekehrter Soldat weiß nicht, womit er sich kleiden soll. Die großen Bekleidungsläger wurden durch Feindeinwirkung zerstört oder geplündert. Jahrelang hat der deutsche Bauer seine ihm zugewiesenen ausländischen Arbeiter selbst einkleiden müssen. Die freigelassenen Russen und Polen haben in vielen Dörfern gestohlen und geplündert.
Und trotzdem werden jetzt auf Anordnung der Militärregierung in jeder Gemeinde große Abgaben von Wäsche und Kleidung verlangt. So wurde zum Beispiel in unserer Gemeinde die zweite größere Kleiderabgabe durchgeführt. Es wurden gefordert: 20 Herrenanzüge, je 10 Herren- und Damenmäntel, je 10 Bettlaken und -bezüge, viele Kleidungsstücke für Kinder, Unterwäsche – insgesamt 258 Teile. Trotz der größten Opferwilligkeit der Bevölkerung war es nur möglich, 222 Stücke aufzubringen. Wird sich die Militärregierung damit zufrieden geben oder wird sie Zwangsmaßnahmen anwenden? – Die abgegebenen Kleider usw. dienen zur Einkleidung der Ausländer, die bereits mit Kleidung lebhaften Handel treiben. Die Ausländer, die in Lumpen kamen, gehen bereits wie stolze Herren und Damen längs der Straße, und die allermeisten [83] deutschen Volksgenossen werden recht bald halb verhungert in Lumpen daherlaufen!
9.7.1945. Seit einigen Tagen fahren die ersten Personenzüge nach Richtung Kiel, allerdings nur bis Neumünster; denn dort muß wegen der Aufbau- bzw. Räumungsarbeiten noch wochenlang an der Wiederherstellung der Bahngeleise gearbeitet werden. Auch die Post kommt allmählich wieder in Betrieb. Nachdem vor etwa 14 Tagen gestattet wurde, Postkarten zu schreiben, ist nunmehr auch der Briefverkehr unter englischer Zensur freigegeben. Amtliche Briefe werden durch die sogenannte Bürgermeisterpost von Segeberg aus täglich in jede Gemeinde befördert.
Auf der Reichsstraße herrscht in den letzten Wochen ein äußerst reger Autoverkehr: Panzer, englische und beschlagnahmte deutsche Fahrzeuge rollen vorbei. Die Straße hat arg gelitten und zeigt an vielen Stellen tiefe Schlaglöcher und starke Beschädigungen.
Zum 10. Juli muß ich der englischen Militärregierung eine amtliche eidesstattliche Erklärung in englischer Übersetzung über meine Vermögensverhältnisse einreichen, die wohl mit meiner Steuererklärung beim Finanzamt verglichen werden soll, um festzustellen, ob ich mir als Amtsleiter der N.S.V. und durch den Krieg Vorteile verschafft habe.
In den letzten 14 Tagen hatten wir dauernd Regenwetter. Das Heu ist zum großen Teil minderwertig und nur zum kleinen Teil geborgen.
11.7.1945. Die letzten deutschen Soldaten, die in unserem Dorfe rund 8 Wochen einquartiert waren, gehen heute ins Lager, um von dort aus in ihre Heimat entlassen zu werden. Der Oberst Schanze muß sich in einem Offizierlager in Belgien stellen, wo von der alliierten Militärregierung untersucht wird, ob er ein Kriegsverbrechen begangen hat. Welch trauriges Ende nimmt unsere tapfere, einst den Tod nicht fürchtende Wehrmacht und mit welcher Schande wird sie behandelt! Werden wir jemals wieder ein deutsches Heer wiedersehen?
13.7.1945. Verschiedene Soldaten unserer Gemeinde, die sich zwecks Entlassung noch in Gefangenenlagern aufhalten, senden durch entlassene Soldaten Grüße an ihre Lieben und lassen sagen, daß sie nach etwa 10-14 Tagen ebenfalls eintreffen: Hs. Rühmann und Herb. Schnack. Ernst Kock traf vor wenigen Tagen in seiner Heimat ein.
[84] 14.7.1945. Sämtlichen Schulen ist von der Militärregierung über den Bürgermeister ein großer Fragebogen zwecks Ausfüllung übersandt. Es soll bis zum 18.7.1945 berichtet werden über Kinderzahl, Lehrer, Beschaffenheit der Gebäude, Klassenräume und Lehrmittel und ob Bedenken vorliegen, wenn die ihres Amtes enthobenen Lehrer – soweit sie nicht Aktivisten der N.S.D.A.P. sind – wieder eingesetzt werden.
Danach hat man scheinbar das Bestreben, den Schulbetrieb möglichst bald wieder zu eröffnen.
Bei schönem Wetter wird das Heu schnell geborgen. Der Autoverkehr hat in den letzten Tagen bedeutend nachgelassen. Überall herrscht Ruhe und jeder geht seiner Arbeit nach. Die allermeisten Polen haben unser Dorf verlassen, doch: Was wird aus den vielen Flüchtlingen aus dem Osten werden?
20.7.1945. Am 14. dieses Monats ereignete sich im benachbarten Wiemersdorf eine schwere Bluttat. Als der in der ganzen Umgegend beliebte ehemalige Amtsvorsteher, Bürgermeister und Sturmführer der S.A. Hans Schümann mit seinem Sohne (Wiemersdorf) in den ersten Morgenstunden vom Felde heimkehrten, wurden sie von etwa 15 Polen aufgelauert und verfolgt. Mit Gewalt drangen die Verfolger darauf in das Haus, in das die beiden Bedrängten geflüchtet waren, zertrümmerten dem Vater mit der Axt die Schädeldecke, durchstachen ihm die Schlagader am Halse, so daß der Tod bald eingetreten sein muß. Die Stubeneinrichtung wurde von den Polen kurz und klein geschlagen. Der Sohn mußte im schwerverletzten Zustande ins Krankenhaus gebracht werden. Vier Haupträdelsführer der Polen wurden verhaftet und nach Segeberg abgeführt. Da man einen Überfall der Polen auf das Leichenbegängnis befürchtete, mußte dieses durch bewaffnete Engländer beschützt werden.
In der Nacht vom 17./18. Juli wurden Keller und Speisekammer des Bauern Hans Schnack in Föhrden Barl von Dieben heimgesucht. Die Diebe waren durch das mit einer Brechstange gewaltsam geöffnete Kellerfenster eingestiegen und entwendeten sämtliche Fleischwaren. Der Abtransport wird durch ein Auto erfolgt sein. Auch für diesen Diebstahl kommen m.E. einzig ortskundige Polen, die man in Lägern untergebracht hat, infrage.
[85] Nach kurzer amerikanischer Kriegsgefangenschaft in Württemberg kehrte der Bauer Hans Rühmann, Föhrden Barl, am 18. Juli zu seiner Familie in die Heimat zurück. Er nahm zuletzt an Kampfhandlungen in Ungarn teil. Per Auto wurde Hs. Rühmann mit anderen Kameraden bis zur Kreishauptstadt Bad Segeberg gebracht, und von dort aus ging’s dann auf Schusters Rappen der Heimat entgegen. Wir begrüßen Dich, lieber Hans und freuen uns mit Deiner Frau und Deinen fünf Kindern zu Deiner glücklichen Heimkehr!
25. Juli 1945. Wieder geht eine Verhaftungswelle durch den Kreis Segeberg und zwar trifft sie diesmal die Führer der S.A. In Bad Bramstedt wurden Rühmann (Amtsgericht), Lehrer Köpke, Hauschild, Claußen (SS) und Rühne (Elektr.W.) in Gewahrsam genommen, – alles Volksgenossen, die m.E. gute Bürger und Volksgenossen sind und die es gut mit ihrem Vaterlande meinten.
Auch der erste Ortsgruppenleiter Karl Schlichting wurde durch die Engländer abgeführt. Auf seine Veranlassung sollen Gegnern der N.S.D.A.P. im Jahre 1933 durch die S.A. Fenster eingeworfen worden sein, auch hat er damals die alte Frau Meyer (Schloß), die ein Kinderheim betreute, durch S.A.-Leute durch die Straßen der Stadt führen lassen. Sie mußte ein Schild tragen mit der Aufschrift: „Ich habe arme Kinder bestohlen!“ Durch gerichtliche Untersuchung wurde später Frau Meyer für unschuldig erklärt. Genugtuung ist ihr jedoch nicht gewährt.
Die Polen – die meisten von ihnen sind bereits in Läger abgeführt worden – werden von Tag zu Tag frecher und gehässiger. Vor etwa 14 Tagen wurde ein Siedler in Mönkloh, als er nachts aus dem Fenster sah, von Polen, die ihn bestehlen wollten, angeschossen und schwer verletzt.
Am 21. Juli drangen zwei betrunkene Polen nachmittags um 5 Uhr ohne jegliche Veranlassung in das Haus des Bauern Wiggers, Hagen, um ihn zu mißhandeln. Als man deutsche Hilfspolizei (ehemalige Soldaten) herbeirief, sprang einer der Polen mit dem Messer auf den ersten deutschen Soldaten los, verletzte ihn an der Schläfe und entriß ihm das geladene Gewehr. Der Schuß, den der Pole alsdann abgab, ging fehl. In der Not machte nun der zweite Hilfspolizist von seiner Waffe Gebrauch und verletzte den Polen durch Rücken- und Bauchschuß schwer. Mittlerweile hatte sich auch die englische Polizei eingefunden, die darauf die Polen abführte.
[86] Auf dem Ausweichlager – Ziegelei Hagen – lagerten u.a. große Mengen an Speiseöl. Hiervon sind in letzter Zeit große Mengen gestohlen. Überall in der Umgegend werden jetzt Haussuchungen durchgeführt, doch an die Hauptübeltäter – an die Polen – wagt sich niemand heran.
Wieder einmal wurde bei dem Bauern Hans Rühmann, der soeben aus der Kriegsgefangenschaft zurückgekehrt ist und dessen vergrabene Vorräte (Konserven) bereits vor etlichen Wochen restlos den Polen in die Hände fielen, in der Nacht vom 20./21. Juli ein Einbruch verübt. Die Diebe – wahrscheinlich Polen – raubten sämtliche Kleider und Schuhe der Kinder und zwei Fahrräder. Der Kleiderschrank auf der Vordiele wurde vollständig ausgeplündert.
W. Schlüter, Bad Bramstedt, lagerte bei Hans Schnack wertvolle Woll- und Wäschevorräte. Eines Tages erschienen die Polen mit einem Engländer, beschlagnahmten die Waren und fuhren sie ab. Schlüters Verlust beträgt ca. 10.000 M.
In der Nacht vom 27./28. Juli verschafften sich Diebe, wahrscheinlich Polen, durch das gewaltsam geöffnete Fenster Zugang zum Keller und entwendeten sämtliche Fleischwaren, Butter, Zucker usw. bei Hs. Schnack. (Wiederholt.)
Am 22.7. kehrten Lehrer Fick, Hagen, und Heinz Thies, Hingstheide, – der Enkel unserer Nachbarin Frau Studt, aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Frau Else Thies, geb. Studt, erklärte noch vor kurzem: „Wegen Heinz bin ich auf alles gefaßt, wenn ich nur wüßte, wo er geblieben ist!“ Man freut sich mit den Eltern, die überglücklich sind.
Kollege Fick hatte die Regierung gebeten, seine Unabkömmlichkeit aufzuheben, trat im Sommer 1944 in die Wehrmacht ein und kämpfte seitdem im Westen. Seine Vaterlandsliebe, seine Aufrichtigkeit, Treue und Kameradschaft ließen ihm keine Ruhe, er mußte dort sein, wo das Vaterland seiner bedurfte. Auch er hat den Lauf der Geschichte nicht mehr aufhalten können und geriet am 18. April im Industriegebiet in englische Gefangenschaft. Am 23. Juli besuchte mich Kollege Aug. Fick, gab seine große Enttäuschung und Mißachtung über die nationalsozialistischen Führer kund, erzählte dann über die letzten schweren Kampftage, über den Verrat der leitenden militärischen Stellen und über den schrecklichen Zustand in dem Gefangenenlager (Remagen), in dem noch viele Kameraden an Hunger und Krankheit starben.
Am 25. Juli kehrte Major d. Fl., Hans Hasselmann, aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Herzlich willkommen! Er ist verheiratet mit Erna, geb. Schnack, also der Schwiegersohn des jetzigen Altenteilers Heinr. Schnack.
[87] 14. August 1945. Am 8. August begab ich mich per Bahn nach Neumünster, um mich im Städtischen Krankenhaus durch Dr. Graf wegen eines Leistenbruches operieren zu lassen. Da es an Kohlen, Lokomotiven und Personenwagen mangelt, läßt der Personenverkehr viel zu wünschen übrig. Nur wer im Besitze einer von der Eisenbahnverwaltung ausgegebenen Zulassungsbescheinigung ist, darf die Fahrt antreten. Offene Güterwagen dienen nicht selten zur Unterbringung von Reisenden. Die in den ehemals von deutschen Truppen besetzten Gebieten beschlagnahmten Eisenbahnwagen müssen nämlich wieder zurückgegeben werden.
Die weitere Umgebung des Bahnhofes von Neumünster bis weit in die Stadt hinein ist durch die letzten Fliegerangriffe vollständig dem Erdboden gleichgemacht. Weite Stadtgebiete bilden einen mächtigen Trümmerhaufen. „Durch die öden Fensterhöhlen weht das Grauen!“ Und all dies Elend haben wir einzig unserer starrsinnigen wahnsinnigen Regierung zu verdanken.
An verschiedenen Stellen sind die Aufräumungsarbeiten schon recht weit fortgeschritten. Im Straßenbild macht sich die englische Besatzung wenig bemerkbar, zwischen ihr und der Zivilbevölkerung besteht ein gutes Einvernehmen. Die Kinos haben ihre Tore wieder geöffnet. Deutsche Polizei regelt den Verkehr.
Das große, erst im Jahre 1930 erbaute moderne Städtische Krankenhaus ist bis auf den letzten Platz besetzt, so daß es schwer fällt, mich aufzunehmen. Schließlich werde ich auf Zimmer 399 (I. Kl.) untergebracht. Die Schwestern, die übermäßige Leistungen zu vollbringen haben, stammen vielfach aus den von Russen besetzten Ostgebieten. Sie haben schon lange das Lachen verlernt und machen sich schwere Sorgen um ihre Heimat und um ihre dort zurückgebliebenen Lieben.
Die Verpflegung im Krankenhaus ist kaum ausreichend. Fleisch und Milch bekam ich während meines 5-tägigen Aufenthaltes kaum zu sehen. Morgens und abends erhielten die Kranken insgesamt 8 kleine Scheiben Brot mit kaum hinreichender Butter, etwas Kunsthonig bzw. eine Scheibe Wurst und Käse. Das Mittagessen bestand aus fünf oder sechs Kartoffeln und als Gemüse erhielten wir rote Wurzeln oder an anderen Tagen gab es Gemüsesuppe. Das Essen war wohlschmeckend, doch satt bin ich an keinem Tage geworden. Zum Glück hatte ich Vorräte mitgenommen, die ich brüderlich mit den Schwestern und Ärzten teilte.
Die Lebensmittelversorgung der Bevölkerung in den Städten ist kaum ausreichend. Gemüse kommt we-gen der Transportschwierigkeiten kaum an den Markt und wegen einer geringen Gemüsezuteilung muß die Hausfrau oft stundenlang anstehen. Viel Gemüse geht per Flugzeug nach England. Das erste ameri-kanische Weizenmehl gelangte in diesen Tagen zur Verteilung. Uns steht ein furchtbarer Winter bevor!
[88] In den Großstädten, insbesondere in Hamburg, blüht der Schwarzhandel. Für hohe Preise ist dort, wie man hört, alles zu haben: Zigarren, Tabak, Fett, Fleisch, Kaffee, Kleidung usw. Für eine Zigarette zahlt man bis zu sechs RM, für 50 g Tabak 60 RM, für ein Brot 80 RM, für ½ kg Kaffee 1.000 RM usw.
Viele Arbeitslose, entlassene Soldaten und Offiziere finden auf dem „Schwarzen Markt“ Beschäftigung und hohen Verdienst, doch eines Tages werden sie von der Polizei geschnappt und schwer bestraft. Mit dem Sanitätsauto der Bramstedter Ortskrankenkasse, das Patienten nach Neumünster befördert hatte, konnte ich bereits (nach glücklich überstandener Operation) nach 5-tägigem Aufenthalt im Krankenhaus zu meiner Familie zurückkehren.
Seit dem 1. August dieses Jahres ist in der Gemeinde Föhrden Barl der Schulbetrieb, allerdings ohne Lehrer und Lernbücher, für die Grundschule wieder eröffnet. Schulbücher sollen demnächst von der Militärregierung geliefert werden. Den Unterricht erteilt Herr Lehrer Schulze, ein Flüchtling aus den besetzten Ostgebieten. Die Gemeinde hat bereits ein Gesuch bei der Militärregierung eingereicht, in dem sie um Wiedereinsetzung ihres alteingesessenen Lehrers bittet. Über mein Schicksal als Lehrer wird m.E. in Kürze entschieden werden.
Am 30. Juli fuhr ich mit dem Verkehrsauto nach Bad Segeberg, um auf der „Volksbank“ die von der Militärregierung geforderte Vermögensangabe notariell beglaubigen zu lassen. Bei dieser Gelegenheit stattete ich dem Schulamt einen Besuch ab, um wegen meiner Amtsenthebung durch die Militärregierung mit dem neuernannten Schulrat Rücksprache zu nehmen. Dieser sagte mir, daß bisher erst 53 von Lehrern des Kreises Segeberg eingesandte Fragebögen durch die Militärregierung geprüft wären. Daraufhin seien 32 Lehrer (von 53) ihres Amtes enthoben. Die Prüfung der restlichen 180 Fragebögen sei bisher nicht erfolgt. Nach Meinung des Schulrates sei die Amtsenthebung nur vorläufig, mancher Lehrer würde noch wieder in sein Amt eingesetzt.
Auch dem früheren Schulrat Lindrum, 67 Jahre alt, der ebenfalls seines Amtes enthoben wurde, statte ich einen kurzen Besuch ab. Er freute sich sehr, war aber äußerst niedergeschlagen; denn seine Wohnung war von den Engländern beschlagnahmt und seine gesamte Wohnungseinrichtung hatte er zurücklassen müssen, die Gehaltszahlung eingestellt, die Bankguthaben gesperrt und sein Haus in Kiel bei den letzten Angriffen dem Erdboden gleichgemacht. Lindrum wohnt jetzt bei dem ehemaligen Rektor und Kreisjägermeister Sach, der mit seiner Frau (Kreisfrauenschaft Segeberg) verhaftet wurde.
Im Segeberger Forst wird zur Zeit viel Holz gefällt. Zu beiden Seiten der Reichsstraße liegen noch viele ausgebrannte Autos, Opfer englischer und amerikanischer Tiefflieger.
Im Auto treffe ich die Frau des Lehrers Köpke, Bad Bramstedt, die ihren in Haft befindlichen Mann besuchen will. Sie hat ihn leider nicht mehr in Segeberg angetroffen.
[89] Für den Bauern Johannes Lohse, der ein altes Mitglied der N.S.D.A.P. war, wird der Bauer Heinrich Reimers zum Ortsbauernführer der Gemeinde Föhrden Barl ernannt.
In den letzten Nächten wurde in unserer Gemeinde bei H. Harbeck eine Gans gestohlen, und auf der Weide im Oster wurde ihm ein Mutterschaf abgeschlachtet.
Die in unserem Hause untergebrachte Frau Kuhlen – mit 2-jähriger Tochter- aus Danzig erhielt vor wenigen Tagen die freudige Nachricht, daß ihre Eltern und Geschwister aus Königsberg entkommen und in Lübeck untergebracht sind. Frau Kuhlen, hochbeglückt von dieser Botschaft, machte ihren nahen Angehörigen sofort einen Besuch und gedenkt demnächst nach Lübeck überzusiedeln. Grau Grothe mit Sohn und Kindermädchen werden uns ebenfalls im Herbste verlassen und zu ihren Eltern nach Kiel ziehen. Auch andere Evakuierte und Flüchtlinge haben unser Dorf wieder verlassen, um in ihre Heimat zurückzukehren – andere ziehen wieder zu -, den Ostflüchtlingen, denen allmählich ihre Barmittel ausgehen, erteilt der Russe bisher keine Einreise(erlaubnis). Die letzten polnischen Arbeiter (3) verlassen in diesen Tagen unsere Gemeinde, um in Lägern untergebracht zu werden. Aus Angst vor ihren Befreiern (!) wagen sie immer noch nicht in ihre Heimat zurückzukehren. Für die ausländischen Arbeiter findet am 8. August wieder einmal eine Kleider- und Wäscheabgabe statt.
In diesen Tagen kehrten der Bauer Herbert Schnack und der Kraftwagenfahrer Hugo Blunck aus der Kriegsgefangenschaft zurück. Seid herzlich willkommen in der Heimat!
Nur von Dir, mein lieber Kurt, hören wir immer noch nichts. Wo steckst Du? Ich glaube, Du bist in Kurland in russische Kriegsgefangenschaft geraten und wirst, nachdem nunmehr auch Japan zur Waffenstreckung gezwungen wurde, eines Tages in die Heimat, wo Frau und Kind und wir alle Dich mit Sehnsucht erwarten, zurückkehren. Hier wurde das Gerücht verbreitet, die 225. Division sei aus Kurland herausgekommen und befinde sich auf Fehmarn, doch wenn das der Fall wäre, hättest Du schon lange von Dir hören lassen. Alle von uns erfolgten Ermittlungen sind bisher erfolglos geblieben. Auch andere ehemalige Kurlandkämpfer haben noch keine Nachricht gegeben, ihnen und mit ihnen auch Dir, ist dasselbe Los erteilt: Kriegsgefangenschaft.
Bereits seit Anfang Juli hält Deine Erna und Klein-Peterlein sich bei uns auf und warten täglich auf Deine Heimkehr. Peter ist ein kleiner drolliger Flachskopf geworden, der in den wenigen Wochen der beste Freund seines Opas geworden ist. Er versucht bereits, die ersten Worte zu lassen. Er lacht und freut sich den ganzen Tag. In der kleinen Hella aus Danzig hat er eine gute Spielgefährtin gefunden. Jetzt steht er wieder neben mir, lacht mich an, zupft mich am Ärmel und möchte „Hopp, hopp Reiter“ machen. Bald werden Deine Lieben uns wieder verlassen, einige Tage bei Anne Vogel in Itzehoe bleiben, um zur Kartoffelernte wieder nach Gokels zurückzukehren.
[90] 23.8.1945. Am 18. dieses Monats, um 8.30 Uhr abends erschienen zwei Engländer und forderten mich auf, mich mit Decke und Wäsche zu versehen, um dann nach Segeberg abtransportiert zu werden. Auf Grund meines Gesundheitszustandes darf ich bis zum 25. des Monats hier bleiben, um mich alsdann in Segeberg bei der Militärregierung zu melden. Wie man vernimmt, werden sämtliche amtsenthobene Lehrer verhaftet und einem Umschulungslager, das bei Neumünster liegen soll, zugeführt. Bisher ist noch keiner von ihnen zurückgekehrt. Die Familie erfährt nichts, jede Verbindung mit den Lieben daheim ist unterbunden. Fast sämtliche Landlehrer sind bereits ihres Amtes enthoben und verhaftet. Werde ich auf Grund meiner Operation und meiner Krankheit von der Verhaftung und einer furchtbaren Leidenszeit verschont bleiben?
Im Segeberger Gefängnis.
Am 11. September stelle ich mich, am Tage zuvor von der Gendarmerie benachrichtigt, der Militärregierung in Bad Segeberg und werde von dieser dem Gefängnis zugeführt. Sämtliche Lebensmittel, Messer, Tabak, Pfeife usw. werden mir abgenommen, und dann wird mir Zelle 15, groß 25-26 cbm Rauminhalt, als Aufenthaltsraum zugewiesen. Ich muß diesen Raum mit fünf Leidensgenossen, darunter zwei Polen und ein Zigeuner, die wegen Mord, Waffenbesitz und Diebstahl haftiert waren, teilen. J. Siemsen, Schmalfeld, Chr. Jensen, Sülfeld, und Hg. Ahrens, Sievershütten, teilen mein Schicksal.
Verpflegung: morgens und abends je eine dicke Scheibe Brot, bestrichen mit Marmelade oder Quark, dazu eine Tasse Milch bzw. Milchsuppe und mittags ½ – 1 l Wassersuppe. Beaufsichtigt werden wir von ehemaligen kriegsgefangenen Polen und Franzosen, die uns das Leben schwer machen. Kaum läßt man uns Zeit, unsere Bedürfnisse zu verrichten. Dauernd läuft der Posten mit geladenem Revolver auf dem Flur umher und ruft: „Los, los! Schnell, schnell!“ Während einer Stunde am Tage werden wir auf den von der Außenwelt abgeschlossenen Gefängnishof geführt, um frische Luft zu schnappen. Wie wohl tun einem die Freiübungen und der Dauermarsch bzw. -lauf. Jegliche Unterhaltung ist verboten. Viele Bekannte treffe ich an: [91] (* Unterstrichen in Segeberg, nicht unterstrichene Namen in Neumünster-Gadeland.)
Dr. Schade – Kaltenkirchen (Arzt), Kruse – Weddelbrook, Hein – Nahe, P. Harder – Wackendorf II, H. Banck – Groß Harri (Lehrer), Siemsen – Schmalfeld, Schütt – Schmalfeld, W. Schlüter – Wackendorf, A. Steenbock – Wackendorf II, Köhler – Bünsdorf, Joh. Schnoor – Wackendorf, Jensen und Höppner – Bad Segeberg, Aug. Süllau, Paulsen – Bad Bramstedt, H. Schmuck – Weddelbrook, W. Schurbohm – Hagen, O. Hauschild – Quarnstedt. (Gauleiter Lohse, Kreisleiter Stiehr, viele weltberühmte Professoren, Gelehrte, 150 Studienräte, Generäle, Oberste, SS-Führer, viele Ärzte usw. in Gadeland)*
Meine Frau brachte mir zweimal Pakete mit Lebensmitteln, die ich brüderlich mit meinen Kameraden teilte. Im Gefängnis zu Segeberg waren es Tage der Hölle, und jeder von uns war daher froh, als es am 21. September hieß: Heute erfolgt der Abtransport nach Gadeland. Nur zum Teil erhielten wir unsere vor 10 Tagen abgegebenen Wertgegenstände zurück, manche wertvolle Uhr, goldener Ehe- und Siegelring, Banknoten, Messer, Rauchwaren usw. haben unsere Peiniger zurückbehalten. Ade, Segeberger Gefängnis, auf Nimmerwiedersehen! 21.12.1945.
Im Internierungslager Neumünster/Gadeland.
Das große Fabrikgelände der Fa. Köster ist bereits im Mai diesen Jahres als Internierungslager hergerichtet. Die mächtigen Fabrikhallen sind so gewaltig, daß sie ca. 12.000 Häftlinge aufnehmen können. Das gewaltige Lager ist durch Stacheldraht von der Außenwelt abgeschlossen und von englischen Posten streng bewacht. Während der Dunkelheit wird das Lager von mehreren Scheinwerfern, die von den Posten auf den Wachtürmen bedient werden, taghell beleuchtet.
Ankunft: Um elf Uhr gelangt unser Transport, etwa 40 politische Häftlinge, in Gadeland an. Wir werden in eine mächtige Halle geführt, in der wir nach Ablegung unseres Gepäcks mit dem Gesicht gegen die Wand Aufstellung nehmen müssen. Unsere Personalien werden aufgenommen, Wertsachen werden abgenommen und versiegelt. Mancher Kamerad, der von bösen Nachbarn oder Ausländern denunziert wurde, muß etliche derbe Faustschläge, ausgeteilt von englischen Feldwebeln, einstecken.
Darauf erfolgt die Einlieferung ins eigentliche Lager, in dem wir dem soeben neu entstandenen Block I zugeteilt werden. Hier empfangen wir Strohsack, eine Wolldecke und Eßnapf mit Löffel. Wir Segeberger haben uns zusammengehalten, und so gelingt es uns als Stubengemeinschaft (Stube 15 – Betten Nr. 169 – 180, Stubenältester Mohr) zusammenzubleiben.
[92] Schon nach einigen Tagen erhalten wir Bettgestelle, die Ordnung hält immer mehr ihren Einzug, die Belegschaft steigt von Tag zu Tag, so daß auch die unteren Räume belegt werden müssen. (Insgesamt 1.200 Mann.)
Verwaltung. Als Lagerführer ist der Arzt Thomsen aus Angeln von den Engländern bestimmt. Diesem steht sein Stab, geführt von dem „Spieß“ Lorenzen, einst Hauptsturmführer, mit seinen Schreibern und einem Dolmetscher zur Seite. Die Kranken werden im Revier durch den Blockarzt Dr. Schmidt (alles Nordschleswiger) betreut. Die zwölf Insassen einer Stube wählen ihren Stuben-, diese wiederum ihren Reihenältesten.
Die Engländer liefern die Lebensmittel, die in der Küche von unserem Küchenpersonal gekocht oder durch den Fourier direkt an die einzelnen Stuben verteilt werden (Kaltverpflegung). Das von den Engländern aus dem Segeberger Forst angefahrene frische Tannenholz wird durch unser „Holzkommando“ zerkleinert. Einen Engländer bekommt man im Lager selbst kaum zu sehen, der Lagerführer ist für Ordnung und Sauberkeit, für gerechte Verteilung der Verpflegung usw. dem Lagerkommandanten, einem englischen Oberst, gegenüber verantwortlich.
Vernehmung. Bereits am nächsten Morgen nach erfolgter Einlieferung werden wir ins Verwaltungsgebäude geführt und einzeln mit Nummernschildern photographiert (W. Mohr Nr. 107750), wenige Tage später erfolgt eine ganz genaue Angabe der Personalien, und von jedem Einzelnen werden Fingerabdrücke genommen (für Verbrecher-Album). Nach etwa fünf – sechs Wochen erfolgt die Vernehmung durch einen englischen Feldwebel, der mich fragte: „Aus welchem Grunde wurden Sie 1933 Parteimitglied? – Warum legten Sie im April 1944 Ihr Amt nieder? – Wie denken Sie heute über den Nationalsozialismus?“ – Ich schilderte ihm die schwere Wirtschaftslage, in der sich Deutschland 1933 befand: sieben Millionen Arbeitslose, die Landwirtschaft überschuldet, den Fabriken fehlte der Warenabsatz, Zwist der vielen Parteien. Wir hatten zu wählen zwischen Kommunismus und Nationalsozialismus. Ich entschloß mich als Bauernsohn, Nazi zu werden; denn Hitlers Programm versprach viel. In den ersten Jahren erlebten wir denn auch ein Aufblühen der Wirtschaft, jedem ging es gut. Den Krieg jedoch, den hat keiner von uns gewollt. Von Jahr zu Jahr entfremdeten [93] die führenden Männer sich immer mehr vom Volke. Sie bereicherten sich und wurden zum Teil vom Größenwahnsinn geplagt, verlangten vom Volke die größten Opfer, ohne selbst daran beteiligt zu sein. So kam es zwischen mir und dem Ortsgruppenleiter, dem Landrat und der Kreisleitung wegen Unterbringung von Flüchtlingen zum Krach, der zur Niederlegung meines Amtes als Leiter der N.S.V führte. Seit dieser Zeit habe ich mich vom Nationalsozialismus innerlich immer mehr entfernt und werde mich in Zukunft nicht wieder politisch betätigen!“ Mit den Worten: „Sie können mit Ihrer baldigen Entlassung rechnen.“ schloß meine Vernehmung.
Verpflegung. Die Kaltverpflegung besteht täglich aus ca. 420 g Brot, 20 g Fett, 30 g Kunsthonig und 2 – 3 mal in der Woche aus etwa 20 g Wurst oder 40 g Käse und etwa 70 – 100 g geräucherten Fischen. Jeden Morgen werden für jeden Häftling zwei Zigaretten oder 2,5 g Tabak ausgeteilt. Die Warmverpflegung: morgens ½ l Kaffee, mittags ½ l Gemüse- (Rüben-) Suppe mit wenig Fleisch und abends ½ l gesüßte Milchsuppe – für 1.200 Mann werden 80 – 100 l Milch geliefert. In wenigen Wochen waren die Schmierbäuche verschwunden und viele glichen bald einem Skelett.
Wie der Tag verläuft! Ich gehöre zu den Frühaufstehern, und so treffe ich mich oft schon um halb sechs mit anderen Kameraden im Waschraum, um mich kalt abzuwaschen und zu rasieren. Halb Sieben Wecken! Der Spieß schlägt an den Gong (Blech) und ruft: „Die Uhr ist halb sieben! Aufstehen! Guten Morgen Kameraden!“ Der Morgengruß wird von allen erwidert. Bald eilt alles in den Waschraum, andere bauen ihre Betten. Um sieben Uhr empfängt der „Stubendiensthabende“ beim Fourier die Kaltverpflegung, die in unserer Stube von Kay, Weddelbrook und Bäsel, Wackendorf I, peinlich genau verteilt wird. Andere Kameraden empfangen unterdessen den Kaffee und nun beginnt das gemütliche Kaffeetrinken. Ich sitze auf der Bettkante, bestreiche meine zwei Stullen mit Kunsthonig, schlürfe den heißen Kaffee dazu und plaudere mit meinen Kameraden von den Lieben daheim, über Entlassungen, über Verpflegung, Vernehmungen, Verhaftungen usw. Anschließend raucht jeder seine Zigarette oder sein Pfeifchen. Die Feuerbeschaffung stößt oft auf große Schwierigkeit. Doch mancher Kamerad verfügt noch über ein Feuerzeug und Benzin dazu liefert der hilfsbereite englische Posten.
[94] Um acht Uhr Hinaustreten zum Zählappell. Angetreten wird zu Hundertschaften. Der Lagerführer begrüßt uns nach erfolgter Aufstellung mit dem Gruß: „Guten Morgen, Kameraden!“ und aus 1.200 Männerkehlen schallt der Gruß zurück. Nachdem ein englischer Sergeant (Feldwebel) durchgezählt hat, eilen die meisten wieder ins Quartier, andere beginnen ihren Morgenspaziergang hinter dem Stacheldraht, unterhalten sich mit Kameraden der Nachbarblocks (D, H, G) oder machen Freiübungen. Bei schlechtem Wetter findet der Appell im Quartier statt.
Ab neun Uhr werden die Stuben durch den „Stubendiensthabenden“ mit den primitivsten Besen gesäubert. Vom Lagerführer dazu bestimmte Kommandos reinigen Treppe und Flur, Waschraum, Klosetts usw. Das Transportkommando schleppt die Verpflegung, die Feurung und die Pakete vom vorgefahrenen englischen Auto an Ort und Stelle. Wachen sind aufgestellt, die die Ordnung aufrecht erhalten oder die Ankunft eines englischen Offiziers dem Lagerführer melden.
Dreiviertel zehn: Fertigmachen zur Inspektion, die an unbestimmten Tagen (zweimal die Woche) durch einen englischen Offizier oder Sergeanten durchgeführt wird.
Nach der Inspektion liegt der lange Tag vor einem, und jeder kann ihn so verbringen, wie es ihm gefällt. Mancher liegt vor langer Weile stundenlang auf seiner Koje und liest ein gutes Buch, andere spielen Schach, Skat oder Doppelkopf, noch andere stopfen Strümpfe oder schnitzen mit den primitivsten Werkzeugen Schachfiguren, Zierkästen usw. Wissenschaftler arbeiten an einem Werk, Jäger unterhalten sich über das edle Waidwerk, andere nehmen an Kursen: Fremdsprachen, Gemüsebau, Chemie, Physik u.a. teil. Mit regem Interesse werden die Zeitungsberichte, insbesondere solche über den Belsen- und Nürnberg-Prozeß aufgenommen.
Sämtliche Berufe sind im Lager vertreten: Berühmte Professoren, wie z.B. Fischer und Remage (Naturwissenschaftler), etwa 50 Ärzte, 150 Studienräte, 100 Volksschullehrer, Afrikaforscher, Schriftsteller (Blunck und Busch), Bärenjäger, Staatsanwälte, Ind.Räte usw. Fast an jedem Abend: wissenschaftlicher Vortrag. Ein Lagerchor unter Leitung des Kapellmeisters der Musikhochschule von Hannover erfreut uns oft durch wunderbar gesungene alte Volkslieder.
Und wie war das Mittag- und Abendessen? Zu Mittag erhielt jeder ½ l Rüben- ganz selten einmal Kohl- oder Erbsensuppe mit etwas Rindfleisch (Wassersuppe) und zu Abend ½ l gesüßte Milchsuppe, d.h. 1.200 Mann erhielten 80-100 l Milch.
Kurz vor zehn Uhr erfolgt allgemeine Lüftung und darauf begibt sich jeder zur Ruhe.
[95] Mancher wälzt sich noch lange von der einen Seite auf die andere. Er denkt an seine Lieben daheim, an seinen Sohn, der in russischer Kriegsgefangenschaft schmachtet und seit April diesen Jahres kein Lebenszeichen von sich gab. Von Zeit zu Zeit blitzen von den Wachtürmen die Scheinwerfer auf, und ihre Strahlen erleuchten die Halle taghell. Lautes Schnarchen und Naturtöne werden vernehmbar und die ersten N.S.V.-Leute – „Mitglieder des Nacht-Schiffer-Vereins“ beginnen, die Latrinen aufzusuchen. Fortlaufend schleichen Geister durch die langen (70 m) Gänge.
Alte und neue Bekannte. In den ersten Tagen nach meiner Einlieferung werde ich von manchem alten Bekannten begrüßt. Ich muß erzählen und berichten, was in der Heimat vor sich ging und wie es mit ihrer Familie, ihrem Hofe usw. steht, ob Söhne bereits wieder heimgekehrt sind, wer von den Engländern verhaftet wurde usw., das Fragen will kein Ende nehmen. Von Block D treffe ich: Meiereiinspektor H. Reese – Wrist, W. Burmeister, Moordiek und Dr. Thomsen – Kellinghusen, W. Schurbohm – Hagen, Otto Hauschild – Quarnstedt, J. Pohlmann – Kattendorf, Hs. Schümann – Schmalfeld, Köhler – Bünsdorf, Kreisbaumeister Petersen – Segeberg.
Block G: H. Schmuck – Weddelbrook, Thomsen und Chr. Paulsen – Bad Bramstedt,
Block H: Büchler, Bad Bramstedt, H. Bank – Groß Harrie (Klassenkollege), Geel und Bustorf – Wiemersdorf.
Block I: Jensen und Dr. Eichstedt, Bad Segeberg, und als ich eines Morgens aus dem Fenster sehe, erblicke ich G. Blunck aus Föhrden Barl. Sofort eile ich nach unten, um das Neueste von Föhrden Barl zu erfahren. In der nun folgenden Zeit haben wir uns fast täglich getroffen und zusammen geplaudert.
Die meisten Bekannten hatte ich allerdings in meinem Block I: Hg. Ahrens – Sievershütten, Dr. Schade – Kaltenkirchen, W. Schlüter – Kisdorf, Paul Harder, Joh. Schnoor und A. Steenbock – Wackendorf II, Siemsen und Hs. Schütt – Schmalfeld, W. Timm – Nützen, G. Bäsel – Wackendorf I, Höppner – Bad Segeberg, K. Persicke – Wackendorf II, Süllau – Bad Bramstedt, W. Kruse und W. Kay – Weddelbrook, Dr. Thyssen – Wesselburen, Dr. Jebsen – Heide usw. Mit Professoren, Gelehrten , Ärzten, Studienräten, Offizieren der Luftwaffe und der Marine wurde die beste Kameradschaft gepflegt.
Tauschzentrale. Im Lager blüht der sogenannte „Schwarze Markt“. Als Zahlungsmittel dienen Zigaretten (je Stück 3-4 RM) und Brot (= 3 Zigaretten). Bei der Tauschzentrale ist alles zu haben: Schuhe, Wäsche, Anzüge, Seife, Zwirn, Zeltbahnen, Skatspiele usw. Mancher verkauft [96] seine zweite Hose, sein zweites Hemd oder Schuhe, um Zigaretten oder Brot dagegen einzutauschen; denn der Hunger ist groß!
Der englische Kommandant, ein Oberst läßt den Häftlingen eine humane Behandlung zuteil werden. Mißhandlungen sind streng verboten. Anfang November gestattet er sogar, daß Lebensmittelpakete beim Posten (bis Weihnachten liefen rund 4.000 Pakete ein) abgegeben werden. Diese werden alsdann von Lagerinsassen sortiert und den einzelnen Blocks zugeleitet. Jeder Paketempfänger ist verpflichtet, seinen Kameraden Lebensmittel abzugeben – etwa 30% -. Das Lager wird von englischen Posten bewacht (Wachtürme). Englische Offiziere und Sergeanten führen die Vernehmungen und Entlassungen durch. Die Verwaltung der einzelnen Blocks ist Sache des deutschen Lagerführers, der dem Kommandanten gegenüber verantwortlich ist.
Entlassung. Meinen Geburtstag am 19. Dezember verlebe ich im Kreise meiner Kameraden, die mir zu meinem Wiegenfeste manche Überraschung bereiten. Mein Geburtstags-Paket ist leider nicht eingetroffen – der morgige Nachmittag ist als Waschtag vorgesehen! Kaum haben wir am 20. Dezember die Rübensuppe eingenommen und die Löffel abgeleckt, da besteigt der Lagerführer die Bühne und wir hören das Wort „Entlassungen“! Die Spannung wächst, immer mehr Namen werden verlesen, es ist Totenstille in der großen Halle. Jetzt kommt der Buchstabe „M“ an die Reihe und – es ist nicht zu glauben – ich höre den Namen Wilh. Mohr. Meine Freude ist unermeßlich! Mit ca. 80 Kameraden erlangen wir nach dreimonatlicher Haft die Freiheit und dürfen mit unseren Lieben das Weihnachtsfest daheim feiern. Die Kameraden freuen sich mit mir und helfen fleißig beim Packen. Bald stehen wir in Reih und Glied am Ausgang, der Lagerchor singt zum Abschied seine Lieder. Kameraden nehmen Abschied und bitten, Grüße an ihre Lieben zu überbringen.
Im Verwaltungsgebäude werden uns vom Secret-Service unsere Wertsachen und Entlassungspapiere ausgehändigt, und dann treten wir den Weg in die Freiheit an. Auf dem Hauptbahnhof erfahre ich zu meinem Schrecken, daß der Hamburger Abendzug in Wrist nicht hält und vom Südbahnhof ist der Zug mittlerweile auch abgefahren. Zu meinem Glück hält vor der geschlossenen Schranke (Südbahnhof) das Lastauto der Fa. [97] Horn, Bad Bramstedt, das mich bis Bad Bramstedt mitnimmt. Keiner ist glückli-cher als ich! In Bramstedt kehre ich noch bei meiner Schwägerin Frida Schlüter – ihr Mann befindet sich z.Zt. in Untersuchungshaft im Gefängnis zu Bad Segeberg – ein, um mich zunächst einmal ordentlich satt zu essen, besuche noch die Frauen einiger meiner Kameraden, um herzliche Weihnachtsgrüße zu überbringen und treten dann den Heimweg an. Unbeschreiblich glücklich ist meine Frau, als ich um elf Uhr ans Fenster klopfe und meinen Namen nenne. Sie kann es kaum fassen, daß ihr Mann wieder da ist. Bald ist das Abendbrot fertig. Schöner hat mir noch keine Mahlzeit geschmeckt! Wir unterhalten uns noch bis um zwei Uhr nachts; denn das Fragen und Erzählen will kein Ende nehmen.
Ein neues Leben, ein neues Wirken und Schaffen kann im eigenen Heim, das meine Frau im Oktober bezogen hat, beginnen! 21.12.1945.
20.2.1946. Nach einer längeren Frostperiode trat Ende Januar Tauwetter mit schweren Regenfällen ein, die das Wiesental weit und breit überschwemmten und in weiten Gebieten Norddeutschlands urchtbare Verheerungen, die schwersten seit Jahrzehnten, verursachten. Der Flüchtlingsstrom will kein Ende nehmen. Jedes Zimmer, jede Kammer unseres Dorfes ist bereits belegt. Die Einwohnerzahl der Gemeinde hat die Zahl 300 weit überschritten, und die Zahl der Schulkinder beträgt z.Zt. 58.
Neben der Ernährungsfrage bereitet die Beschaffung der Feurung die schwersten Sorgen. Ich habe Anfang Januar im Walde fleißig dürres Holz gesammelt und Nachbar J. Harbeck stellte mir zwecks Anfuhr sein Gespann zur Verfügung, Schwager W. Schlüter, Bad Bramstedt, und Hs. Schnack hatten während meiner Abwesenheit meiner Frau nach ihrem unerwarteten Umzug Torf und gehackten Busch geliefert, die Gemeinde ließ uns zwei Raummeter Birkenholz anfahren, und so werden wir schon durchkommen.
Überall im Walde hört man die Schläge der Axt, furchtbar wird unter den Holzbeständen unserer einst so schönen Heimat aufgeräumt! Für die Flüchtlinge unseres Dorfes läßt die Gemeinde 240 Raummeter Holz schlagen und weitere 250 Raummeter sollen für Dithmarschen geliefert werden. Wenn man noch zwei Jahre mit diesem Raub fortfährt, sind unsere heimischen Wälder verschwunden. Der Segeberger Forst ist bereits zum größten Teil der Axt zum Opfer gefallen, die dicken Baumstämme werden an Ort und Stelle zersägt und die Bretter nach England verschifft.
[98] Um die Feurung für das nächste Jahr sicherzustellen, sollen die heimischen Moore ausgenutzt werden: Mindestens zwei große Bagger werden im kommenden Frühjahr auf dem Lentföhrdener Moor in Tätigkeit treten. Steinkohlen und Briketts sind nicht erhältlich; denn die Bergwerke sind in englischer Hand und die Verkehrsverhältnisse (so liest man jedenfalls in den Zeitungen) lassen die Beförderung von Kohlen einzig für lebenswichtige Betriebe zu.
Auch der elektrische Stromverbrauch ist noch recht beschränkt. Jeder Haushalt darf pro Tag ½ KW + 0,03 KW je Person verbrauchen. Wir kommen mit dieser Zuteilung ganz gut aus.
Die schwerste Sorge bereitet die Ernährung der Bevölkerung. Die Kornvorräte gehen in wenigen Wochen auf die Neige, die im Herbst eingekellerten zwei Zentner Kartoffeln (je Person), die bis zur neuen Ernte reichen sollen, sind von mancher Familie bereits verbraucht, Gemüse ist kaum erhältlich und die Fett- und Fleischrationen werden immer weiter gekürzt. Wenn die Siegermächte nicht bald eine große Hilfsaktion einleiten, steht eine furchtbare Hungersnot vor der Tür.
Ein weiteres Problem besteht darin, die vielen entlassenen Soldaten und Arbeitslosen zu beschäftigen; die großen Fabriken sind z.T. zerstört oder haben aus Mangel an Kohlen und Rohstoffen die Tore noch nicht wieder geöffnet.
Alle Männer bis zu 65 Jahren und Frauen bis zum 50. Lebensjahre sind verpflichtet, sich zwecks Registrierung beim Arbeitsamt zu melden. Wer sich der Anmeldung entzieht, erhält keine Lebensmittelkarte und wird schwer bestraft.
Nach der Sichtung der Beamtenschaft findet jetzt eine Säuberung der Gewerbebetriebe von führenden Nationalsozialisten statt. Alten Parteigenossen und Aktivisten der N.S.D.A.P. wird verboten, Inhaber einer Firma oder deren Betriebsleiter zu sein. Wer den ihm zugestellten Fragebogen nicht ausfüllt oder etwas verschweigt, wird mit Gefängnis bestraft. Alleine im Kreise Segeberg sind deswegen drei Lehrer ins Gefängnis gewandert und bis zu drei Jahren bestraft worden.
Laut Amnestie-Erlaß der Militärregierung wurde jedem aufgegeben, der noch im Besitze von Waffen oder Heeresgut ist, dieses in der Zeit vom 10 – 20. Januar abzuliefern.
Nachdem von der Militärregierung bisher drei politische Parteien zugelassen sind, finden überall u.a. auch in der Steenbock’schen Gastwirtschaft Wahlversammlungen statt, die allerdings nur schwach besucht werden. Jede Partei verspricht den Himmel auf Erden und versucht, alle Schuld der N.S.D.A.P. in die Schuhe zu schieben.
[99] In den Großstädten blüht der „Schwarze Markt“, auf dem sämtliche Knappwaren für Wucherpreise erhältlich sind: ½ kg Zucker 80 RM, Kaffee 600-800 RM, 1 l Kümmel 200-300 RM usw. Für Rauch-waren und Spirituosen ist alles zu haben. Mancher stellt sich seinen Schnaps nach eigenem Rezept in seiner „Schwarzbrennerei“ selber her. Oft hört man von einer demnächst bevorstehenden Abwertung des Geldes und mancher versucht – allerdings meistens vergeblich – sein Bargeld in „Ware“ anzulegen.
Die Jagd ruht noch immer und wird von den Engländern ausgeübt, ausgegebene Gewehre wurden wieder eingezogen. Die Jagdpächter sind verpflichtet, die Jagdpacht auch weiterhin zu entrichten. Durch J. F. Krohn, meinen Jagdkameraden, wurde in Hamburg der neue „D.J.V.“ ins Leben gerufen.
Viele Polen werden zwangsweise durch die Engländer von Lübeck aus per Schiff in die Heimat befördert, doch kehren viele von ihnen nach einigen Wochen von ihren eigenen Landsleuten oder den Russen vollständig beraubt und ausgeplündert mittellos zurück und gefährden die allgemeine Sicherheit. Polnische Banden überfallen nicht selten Einzelgehöfte (Delfs, Neumühlen, und Rickers in Wrack) und zwingen die Bauern mit vorgehaltenem Revolver zur Hergabe von Mobilien, Wäsche, Lebensmitteln und Wertgegenständen. Bei H. Kelting in Hingstheide wurden unter Zurücklassung des Kopfes und der Eingeweide nacheinander zwei große Schlachtschweine gestohlen. Nur selten gelingt es der Polizei, diese Räuberbanden zu fassen.
Vereinzelt kehren Ostflüchtlinge per Bahn oder in Trecks in ihre Heimat zurück, doch soll hier, wie in Briefen geschildert wird, furchtbare Not und großes unbeschreibliches Elend herrschen. Die Deutschen gelten dort – nach Berichten zurückgekehrter Flüchtlinge – als Freiwild, der Großgrundbesitz ist enteignet und verteilt, das Vieh fortgetrieben, die Landmaschinen und die Fabrikeinrichtungen nach Rußland abtransportiert.
Anfang Januar 1946 trifft die erste Kriegsgefangenenpost aus Rußland ein. Mancher Vermißte und Tot-gesagte schreibt seinen Lieben in der Heimat und deren Freude ist unermeßlich. Am 15. Februar kehren Fritz Fölster und Ernst Thies von Segeberg aus zu ihren Lieben zurück. Seid herzlich willkommen!
Der Geplagteste Mann innerhalb der Gemeinde ist ohne Frage der von der Militärregierung neuernannte Bürgermeister H. Harbeck, der in dieser schweren Zeit versucht, jedem Gemeindeangehörigen und Flüchtling sein Los zu erleichtern. Jedem, auch dem ehemaligen alten Parteigenossen, steht er mit Rat und Tat zur Seite und vermeidet jegliche Härte. Ihm zur Seite steht der vorläufig ernannte Gemeinderat, der aus zwölf Mitgliedern, darunter vier Frauen, besteht. [100] Nach meiner Entlassung aus dem Internierungslager Neumünster-Gadeland am 20.12.1945 konnte ich mich anfänglich schwer an das gute Essen gewöhnen, so daß ich mehrere Tage wegen Magenverstimmung das Haus hüten mußte. Es gab viel zu schreiben, um den Angehörigen tröstende Worte über das Los ihrer Lieben zukommen zu lassen. In den ersten Tagen hatte ich viel Besuch von Frauen, die sich nach dem Wohlergehen ihrer Männer erkundigten. Dank der guten Unterstützung, die mir Nachbar Johs. Harbeck, mein Bruder Karl, mein Schwager W. Schlüter u.a. mit Milch und anderen Lebensmitteln zuteil werden ließen, konnte ich mich in kurzer Zeit recht gut erholen, so daß wir bereits Anfang Januar per Auto (J. F. Krohn) einen Besuch bei unserer Schwiegertochter und unserem Enkel Peter Wilhelm unternehmen konnten. Der kleine, kaum zwei Jahre alte Sproß, der seinen Vater leider noch nie gesehen hat, ist ein hübscher stattlicher Junge geworden. Das Sprechen bereitet ihm große Schwierigkeit. Als ich ihm meine Pfeife anvertraute, saß er stundenlang auf meinem Schoß oder stolzierte in der Stube umher und war der richtige „Gernegroß“.
Es ist mir eine Lebensfreude, der Arbeit wieder nachgehen zu können und Arbeit gibt’s in Hülle und Fülle: Beschaffung von Feurung, Holzspalten, Begrandung der Auffahrt, Reinigung der überfüllten Jauchegrube, Beseitigung des mächtigen Aschhaufens, Bau eines Hühnerstalles mit Auslauf, Präparieren des selbstgezogenen Tabaks, Düngung des Gartens, Beschneiden der Obstbäume und des Weines usw. Bei schlechtem Wetter und am Sonnabend spielt man mit alten Bekannten einen Skat, Doppelkopf oder Schach. So gehen die Tage schnell dahin.
Mit der Wiedereinsetzung ins Amt wird es wohl vorläufig nichts werden, denn die von der Militärregierung ausgesprochene Amtsenthebung läßt bisher keinen Widerruf zu. Ich sammle nun Zeugnisse von Nichtparteigenossen, Eltern, Flüchtlingen, Evakuierten usw., aus denen hervorgeht, daß ich kein Aktivist der N.S.D.A.P. gewesen bin, mein Amt als Ortsgruppen-Amtsleiter der N.S.V. im Sinne der wahren Nächstenliebe ausgeübt und als Lehrer stets meine Pflicht getan habe. Diese Zeugnisse, so hoffe ich, werden mir zur gegebenen Zeit einmal sehr wertvoll sein.
Bereits am 23. Dezember besuchte mich der z.Zt. in unserer Gemeinde stationierte Gendarmerie-Wachtmeister, um meine Personalien aufzunehmen und diese zwecks Anmeldung bei der „Geheimen englischen Polizei“ einzusenden. Er erklärte mir, daß damit meine persönliche Anmeldung nicht mehr nötig sei. Um mir hierüber Gewißheit zu verschaffen, fragte ich sicherheitshalber trotzdem bei der geheimen englischen Polizei in Segeberg brieflich an, worauf am 1. Februar mir durch den Gendarmerie-Wachtmeister der Bescheid zuteil wurde, ich hätte persönlich in Segeberg zu erscheinen.
[122] Am 3.2.1946 fahre ich mit dem Verkehrsauto (Prahl) von Bad Bramstedt aus nach Segeberg, doch dort sagt man mir, daß die englische Polizei für den westlichen Teil des Kreises nach Bramstedt verlegt sei. Ich statte nun dem neu ernannten Schulrat Steffens einen Besuch ab, um mich bei ihm über die Zukunft der abgebauten Lehrer zu erkundigen. Der Schulrat berichtet mir über Verhandlungen zwischen dem Oberregierungs-Präs. mit der Militärregierung, die noch nicht abgeschlossen seien. Es sei zu erwarten, daß ein Teil der Lehrer wieder in ihr Amt eingesetzt würden, die älteren Lehrer müßten mit ihrer Pensionierung rechnen, andere Kollegen würden eine Teilpension erhalten und die restlichen Lehrer würden ohne Entschädigung und Pension entlassen.
Am Montag, den 5. März, begebe ich mich zur englischen Polizei in Bad Bramstedt, die dort in der Villa des Tierarztes Dr. Wilhelmi untergebracht ist. Der Engländer, dem ich vorgelassen werde, spricht sehr gut deutsch und fordert mich auf, Platz zu nehmen. Die Frage „Warum melden Sie sich erst heute?“ beantworte ich ihm zu seiner Zufriedenheit. Mir werden nun viele Fragen gestellt, unter anderem „Sie waren im Lager Gadeland, wie wurden Sie von den Engländern behandelt?“ – „Wie war die Verpflegung?“ – „Womit beschäftigten Sie sich im Lager?“ – „Wurden auch politische Vorträge gehalten?“ – „Wurde auch noch vom Nationalsozialismus gesprochen?“ – „Wie hoch schätzen Sie prozentuell die Zahl der Unbelehrbaren?“ – „Wie war der Besuch des Gottesdienstes?“ – „Woher mag es gekommen sein, daß die Besucherzahl von Sonntag zu Sonntag stieg?“ usw. Zwischen dem Engländer und mir entwickelte sich dann ein längeres Gespräch über Religionsfragen, „gottgläubig“, „deutsche Christen“ und dergleichen. Alle Fragen beantwortete ich so gut ich konnte und scheinbar war der Engländer von der Wahrheit meiner Darstellung überzeugt. Meine Ansichten über Religionsfragen verfolgte er mit regem Interesse.
Am 11.2.1946 erhalten wir die freudigste Nachricht unserer alten Tage: Käte Studt überbringt uns den ersten Brief vom 14.1.1946, das erste Lebenszeichen unseres lieben Sohnes Kurt aus russischer Gefangenschaft. Eigenhändig schreibt er in guter Schrift und mit fester Hand, daß es ihm gut geht und auf baldige Heimkehr zu seinen Lieben in der Heimat hofft. Er scheint um das Wohlergehen seiner Familie besorgt zu sein und bittet um baldige Beantwortung seines Briefes. Alle Verwandten, Nachbarn, Freunde und Bekannten freuen sich mit uns! Die alte Frau Studt, bei der Kurt als kleiner Junge stets ein- und ausging, fällt meiner Frau mit Freudentränen in den Augen um den Hals. Erna und Peterlein und die nächsten Verwandten werden sofort telefonisch benachrichtigt. Unser Glück, unsere Freude ist unermeßlich; denn nun wissen wir: Kurt lebt, und so Gott will, wird er eines Tages zu uns und den seinen zurückkehren!
[123] Adresse Kriegsgefangener Kurt Mohr, Moskau Rotes Kreuz, Postfach 254/5 339/11
Noch am selben Abend beantworte ich Kurts Karte mit wenigen Sätzen: „Es geht uns allen sehr gut. Erna und Peter sind in Gokels und Peter ist ein kleiner niedlicher Junge geworden. Wir warten auf Deine Heimkehr.“
Schon am nächsten Morgen übergebe ich die Karte der Bahnpost. Wie wird Kurt sich freuen, wenn er das erste Lebenszeichen von seinen Lieben aus der Heimat erhält! Am 14.2.1946 teilt der in unserer Gemeinde stationierte Gendamerie-Wachtmeister mir mit, daß ich als ehemaliger politischer Häftling unter seiner Aufsicht stehe. Alle acht Tage hat er der englischen Geheim- Polizei einen Bericht über mich einzusenden. Man muß nach Ansicht der Engländer ja ein Schwerverbrecher sein, und dabei bin ich mir keiner Schuld bewußt. Zu dieser Überzeugung wird auch früher oder später die Militärregierung gelangen!
5.4.1946. Unsicherheit – Nachtwache
Die Unsicherheit in Stadt und Land, insbesondere die nächtlichen Einbrüche, nehmen infolge der Lebensmittelknappheit immer mehr zu. Schon mehrfach wurden in Hamburg Brotwagen überfallen und Brotläden ausgeplündert. In der Nacht vom 4./5. April wurde bei dem Bauern Johs. Rühmann eine hochtragende Sau aus dem Stall geholt und auf der Hauskoppel abgeschlachtet. Welch ein Jammer! Die Diebe bringen das Fleisch an den „Schwarzen Markt“, wo es für 40 – 50 RM je ½ kg zum Verkauf angeboten wird.
In den Städten herrscht bereits die größte Hungersnot. Statt Kartoffeln gelangen Steckrüben zur Verteilung. Die Lebensmittelrationen wurden ab 1.3.1946 weiter gekürzt. Für die Woche gelangen zur Ausgabe: Brot 1.000 g, Nährmittel 250 g, Zucker 250 g, Fleisch 175 g usw. Im Schwarzhandel wird für Brot, Kartoffeln und andere Lebensmittel jeder Preis bezahlt. Mancher Arbeiter ist trotz der „Schwerarbeiterzulage“ so geschwächt, daß er der Arbeit nicht mehr nachgehen kann. Und hat denn überhaupt die Arbeit noch Sinn? – Wenn ich zum Beispiel auf dem „Schwarzen Markt“ meine Raucherkarte für 250 – 300 RM verkaufe, kann ich gut leben, als Arbeiter würde ich höchstens 150 RM im Monat verdienen.
Obgleich die Hühnerhalter für je Henne 60 Eier abzuliefern haben, gelangte in den letzten vier oder fünf Monaten nur ein Ei (je Person) an die Verbraucher zur Verteilung. Die Not steigt täglich! Die Kartoffelmieten werden, obgleich „Ausgehverbot“ besteht, bei Nacht geöffnet und ausgeräubert. [124] Vielen Bauern fehlen daher die Saatkartoffeln. Gestern abend wurde von dem alten Herrn Kröger folgende Geschichte erzählt: In Mühlenbarbek waren dem Bauern R. bereits viele Pflanzkartoffeln aus der Miete entwendet. Der Bauer erhielt von seinem Bürgermeister die Erlaubnis, bei der Miete „Wache“ zu halten. In der zweiten Nacht kamen denn auch drei Mann, öffneten die Miete und füllten ihre Säcke. Als nun der Bauer die Diebe zur Rede stellte, gaben sich diese als Kellinghusener Polizei aus, verhafteten den Bauern wegen Überschreitung der Polizeistunde (22.30 h) und nahmen ihn mit nach der Wache in Kellinghusen. Hier zog nun der Bauer die von seinem Bürgermeister ausgestellte Bescheinigung hervor, zeigte sie dem wachhabenden Engländer und schilderte diesem den Tatbestand. Nicht der Bauer, sondern die drei Polizisten, die als Diebe entlarvt wurden, wanderten ins Gefängnis.
Überall: auf Bahnhöfen, Hauptverkehrsplätzen und -wegen macht man Jagd auf die sogenannten „Schwarzhändler“. Vor wenigen Tagen wurde Nachbar Evers angehalten, als er per Rad mit einem Brot und einer Wurst von seinem alten Vater aus Fitzbeck zurückkehrte. Erst nach vielem hin- und herreden durfte er die „Ware“ behalten. Des Nachts bekommt man natürlich keine Polizei zu sehen; denn mit Räubern und Banditen anzubinden, ist bekanntlich lebensgefährlich. Die Angehörigen der Polizei sind meistens Flüchtlinge, unsere ehemalige Polizei befindet sich in den Internierungslagern Gadeland oder Neuengamme!
Zur allgemeinen Sicherheit geht seit etwa vier Wochen in unserem Dorf eine Nachtwache, deren Bewaffnung der Engländer abgelehnt hat. Jede männliche Person vom 18. bis 60. Lebensjahr ist verpflichtet, Nachtwache zu gehen. Revidiert wird die Wache durch den in unserer Gemeinde stationierten Gendarmen (Ostflüchtling) oder durch die englische Streife.
Der Flüchtlingsstrom will kein Ende nehmen. Wieder wurden von den Polen 1,5 Millionen Deutsche ausgewiesen und in die englische Besatzungszone abgeschoben. Von ihnen sollen 65 Flüchtlinge, nach neuester Meldung spricht man sogar von 90 Personen, innerhalb unserer kleinen Gemeinde Aufnahme finden. Bei diesen Flüchtlingen handelt es sich um die Ärmsten der Armen. Innerhalb zehn Minuten mußten sie ihre Wohnung bzw. Gehöft unter Zubilligung der Mitnahme von 15 kg Gepäck verlassen und wurden dann einem mächtigen Sammellager zugeführt. [125] Halb verhungert, mißhandelt, ihrer letzten Habe beraubt, die Frauen und Mädchen geschändet, so wurden sie dann zu uns abgeschoben. Man muß diese Armen bedauern; denn helfen kann man ihnen nicht allen, dazu ist die Not zu groß.
Wehe denen, die diese Not über uns gebracht haben und noch weiter bringen. Wie wollen diese Machthaber vor der Geschichte und vor ihrem Herrgott bestehen.
Die Schülerzahl stieg infolge des neuen Zustromes auf über 70 und wird noch weiter steigen! Nach einem neuen Erlaß werden die Steuern (Einkommens-, Vermögens- und Umsatzsteuer) um 50% erhöht, Telefon-, Portogebühren und Fahrpreise auf der Eisenbahn werden verdoppelt. Eine schwere Belastung der darniederliegenden Wirtschaft!
Alle in der Wirtschaft nicht dringend benötigten Pferde– auch Fohlen – sollen zwecks Einsparung von Halfter und auch Futter abgeschlachtet werden. Auch Polen verlangt für die Ostgebiete viele Pferde. Auch unter dem Rindviehbestand wird aufgeräumt. Sämtliche Kühe mit geringen Milchleistungen fallen dem Schlachtermesser zum Opfer.
Die Bestellung der Gärten ist in vollem Gange; denn jeder will nach Möglichkeit frühzeitig in den Besitz von Frühgemüse gelangen. Für jeden Flüchtling werden seitens der Gemeinde 80 qm Gartenland auf der Schulkoppel zur Verfügung gestellt, doch fehlt den meisten außer Dünger das nötige Saatgut, insbeson-dere Frühkartoffeln, Zwiebeln, Erbsen und Bohnen. Da außerdem viele Flüchtlinge von Gartenarbeiten nichts verstehen, wird die Landzuweisung trotz guten Willens der Behörde m.E. ein Fehlschlag werden.
Auch in diesem Jahre werden der Landwirtschaft nur geringe Mengen an Kunstdünger zur Verfügung gestellt. Wer „gute Freunde“ an richtiger Stelle sitzen hat und der Schieber hat natürlich alles in Hülle und Fülle.
In jedem Hause stehen vor den Fenstern kleine Kästen, die bereits mit Tabak besät sind.
Wegen Futtermangel wurde das Jungvieh bereits Ende März auf die Weide getrieben und Anfang April folgten die Milchkühe. Die Milcherzeugung ist stark zurückgegangen, so daß z.B. in Hamburg jede Person während der Woche 1/8 l erhält, und dabei schreibt man in den Zeitungen, daß schon manches besser geworden ist. Ja, das Papier ist geduldig!
Wegen Mißhandlung von Ausländern bzw. englischen Fliegern wurden der Bauer Otto Hauschild aus [126] Quarnstedt (Ortsgruppenleiter) und der Bauer Speck, ebenfalls aus Quarnstedt (SS-Scharführer) von dem Gericht der Militärregierung zu 2 bzw. 2 1/2 Jahr Gefängnis verurteilt. Der Meiereiinspektor Reese, Wrist (Ortsgruppenleiter), der sich seit Mai vergangenen Jahres im Internierungslager Gadeland befindet, verliert seine Anstellung, seine Frau, die einen Nervenzusammenbruch erlitt, wird von einer gewissen Gruppe schikaniert, und nunmehr soll die arme Frau auch noch die Wohnung räumen. Heinrich Schmuck und Wilhelm Kruse, Weddelbrook, wurden nach 5-monatiger Haft aus Gadeland entlassen und Kollege Fick, Hagen, kehrt aus Neuengamme zurück. Kruse war hochbeglückt, daß er im Kreise seiner Familie, guten Nachbarn, Freunden und Leidensgefährten das Fest der Silberhochzeit feiern konnte.
Wie man vernimmt, kann man nunmehr Einspruch gegen die von der Militärregierung ausgesprochene Amtsenthebung erheben. Die Prüfung erfolgt durch eine deutsche Kommission, gegen deren Entscheid bei der Revisions-Kommission Berufung eingelegt werden kann. Die Landesgenossenschaftsbank Segeberg ließ mir durch den Geschäftsführer der Spar- und Darlehenskasse mitteilen, ich möchte den Antrag auf Freigabe meines Vermögens stellen. Ich werde mich nicht beeilen, ich habe Zeit!
27.7.1946. In den letzten Wochen hat sich manches ereignet, doch wenig Gutes und die trostlose Lage auf dem Lebensmittelmarkt hat sich nur wenig gebessert. Ende Mai – bis in den Monat Juni hinein – herrschte insbesondere in den Städten eine furchtbare Hungersnot, die – Gott sei es gedankt – an unserem Hause vorüberzieht.
Täglich mehrt sich die Zahl der Ostflüchtlinge, die ihre Heimat ohne Mitnahme von Gepäck – also bettelarm – verlassen mußten, um bei uns aufgenommen zu werden. Die Zahl der Flüchtlinge in unserer Gemeinde übersteigt bereits die der Einheimischen – Gesamt-Einwohnerzahl 465. Täglich klopfen 20 – 30 dieser Ärmsten an die Tür der Bauern und betteln um Kartoffeln und Brot. Kartoffelschale wird von ihnen gesammelt, um daraus eine Suppe für die hungernden Kinder zu kochen. Die Zahl der Todesfälle steigt von Tag zu Tag. Alleine im Kurhaus in Bad Bramstedt, das zur Zeit als Flüchtlingskrankenhaus dient, sterben täglich oft fünf bis zehn Menschen, und die langen Reihen der Gräber auf dem Kirchhof sind und bleiben für immer Zeugen dieser furchtbaren Zeit. In den Ostgebieten sind die Gebiete entvölkert, die Dörfer haben teilweise keine Einwohner mehr, die Häuser verfallen, auf den Äckern wuchert das Unkraut, und in der englischen Zone wohnen bereits 325 Menschen auf einen Quadratkilometer.
In Paris streiten sich die Außenminister der Siegermächte um die Verteilung der Beute, ohne zu einer Einigung zu gelangen, es sei denn auf Kosten Deutschlands. Ist das die Erlösung, die Freiheit und Demokratie, die man dem Volke bringen wollte?
[127] Bis zum 21. Mai hatten wir Regen über Regen, und dabei herrschte eine übermäßige Kälte, worunter das Wachstum der Gemüsepflanzen arg zu leiden hat.
Wohl noch nie ist es auf dem Lentföhrdener Moor so viel Torf gegraben worden wie in diesem Jahre; denn auch die vielen Flüchtlingsfamilien müssen mit Feurung versorgt werden. Diesen wird von den Bauern das Moor unentgeltlich zur Verfügung gestellt, und der Bauer Krohn fährt mit seinem Trecker täglich 30 – 40 Männer und Frauen zum Torfmoor, um sie am Abend nach beendeter Arbeit wieder heimzuholen. Ich habe mir mit Genehmigung aus Hans Schnacks Moor fünf oder sechs Fuder Torf gegraben; denn einen Winter ohne hinreichende Feurung möchte ich nicht nochmals durchmachen! Täglich fahren Lastautos, beladen mit ausgerodeten Baumstümpfen oder Tannenbusch aus dem Segeberger Forst, an unserem Hause vorbei, um die Stadtbevölkerung mit Feurung zu versorgen.
27.7.1946. Die Heu- und Roggenernte kann man als gut bezeichnen und wurde bei schönem Wetter schnell geborgen. Auch die Frühkartoffeln lieferten reichlich Erträge, doch die Spätkartoffeln haben unter der im Juni einsetzenden Hitzewelle recht stark gelitten. Der Kartoffelkäfer, der erstmalig in unserer Gemarkung festgestellt wurde, richtete auf einigen Äckern arge Schäden an. Es wurde nichts unterlassen (Suchkolonnen, Einsetzung der Schule usw.), um diesen Schädling zu bekämpfen.
Das Verhältnis und Einvernehmen zwischen der einheimischen besitzenden Bevölkerung und den Flüchtlingen verschlechtert sich zusehends. Die Schuld liegt m.E. meistens auf beiden Seiten. Einige Bauern sorgen so gut es geht für die Flüchtlinge, behandeln sie als Volksgenossen und haben Verständnis für deren Notlage. Durch Mitarbeit in der Landwirtschaft beweisen die Flüchtlinge ihren Dank. Dort jedoch, wo sie einzig als Last empfunden werden, kommt es recht oft zu heftigen Auseinan-dersetzungen. Auch kamen aus dem Osten viele arbeitsscheue, verkommene Elemente, die dem Müßig-gange nachgehen, des Nachts Felddiebstähle begehen, das Vieh auf dem Felde abschlachten und ihre Be-tätigung auf dem „Schwarzen Markt“ suchen. Ich kann es verstehen, wenn ein Mensch, der eine schöne Wohnung oder einen seit Jahrhunderten in der Familie vererbten Bauernhof besaß, unzufrieden und abgünstig ist, doch vorläufig kann keiner daran etwas ändern, der Raum, auf dem allzu viele Menschen zusammengedrängt wurden, ist eben zu klein und vermag bei der darniederliegenden Industrie nicht die Menschenmassen zu ernähren und zu beschäftigen. Mancher Ostflüchtling ist träge, prahlerisch veran-lagt, und mit der Wahrheit nimmt er es nicht so genau. [128] Nur wenige von ihnen wollen Parteigenos-sen der N.S.D.A.P. gewesen sein, und so gelingt es ihnen recht oft, Einheimische, die ihre Zugehörigkeit zur nationalsozialistischen Bewegung nicht verschweigen können, zu verdrängen und führende Stellungen einzunehmen. Der Fischermeister aus dem Osten prahlt von den großen Aalen, die im Durchschnitt neun Pfund gewogen haben, der Jäger spricht von den großen Hasen, Rehen und Hirschen, der Bauer erzählt gerne von seiner herrlich eingerichteten 7-Zimmer-Wohnung, von seinen viel besseren Viehbeständen, von seinem viel größeren Besitz – daß einer von ihnen gewöhnlicher Arbeiter war, habe ich bisher kaum gehört. „Diese Leute sollten sich wegen ihrer Prahlereien und Verleugnung ihres Standes schämen“, erklärte mir Herr Reuter, ein einfacher, rechtschaffener Maurergeselle aus dem Osten, der vor kurzem mit seiner jungen Frau in unserem Hause untergebracht wurde.
Die politischen Parteien versuchen natürlich die Notlage der Flüchtlinge für ihre Zwecke auszunutzen, machten ihnen große Hoffnungen und Versprechungen, die niemals in Erfüllung gehen können. In unserer Gemeinde wurde eine Ortsgruppe der SPD gegründet, die bereits 35 Mitglieder, hauptsächlich Flüchtlinge, zählt. Es ist durchaus nicht ausgeschlossen, daß die Liste der SPD (Flüchtlinge) bei der im Monat September stattfindenden Gemeindewahl, von der viele Einheimische wegen ihrer ehemaligen Zugehörigkeit zur N.S.D.A.P. ausgeschlossen sind, die Mehrheit in der Gemeindevertretung erhalten und einen aus ihren Reihen zum Bürgermeister bestimmen.
Die Diebereien nehmen in letzter Zeit immer mehr zu. Die Ähren der Garben werden abgeschnitten, das Korn auf dem Felde ausgedroschen, die Kartoffeln aufgenommen und das Vieh auf den Weiden abgeschlachtet, und die Ware kommt alsdann an den „Schwarzen Markt“, wo sie für Wucherpreise verkauft wird. Für einen Rucksack voll Roggen erhält der Schwarzhändler den doppelten Preis wie der Bauer für ein Fuder ablieferungspflichtiges Brotgetreide. Dem Bauern Hans Schnack wurde ein Schaf auf der Weide abgeschlachtet, Johs. Rühmann sieben Hähne aus dem verschlossenen Viehstall gestohlen. Auf energisches Drängen des Rühmann ist es schließlich gelungen, eine ganze Diebesbande festzunehmen. Die sieben Hähne wurden im Schornstein der Rühmannschen Altenteilerkate, in der einzig Flüchtlinge untergebracht sind, gefunden und dem Eigentümer zurückgegeben. Als Täter kommt der Sohn des Vorsitzenden der SPD, [129] ein gewisser Schröder, und mehrere andere Flüchtlinge in Frage. Da Herr Schröder sich wegen dieses Diebstahls, Unregelmäßigkeit seiner Tochter bei der Milchverteilung, gerichtlicher Bestrafung derselben wegen Entwendung einer Brennschere bei einem Friseur in Kellinghusen und anderem belastet fühlte, wurde er zur Niederlegung seines Postens als Vorsitzender der SPD veranlaßt. Der Grundsatz: „Alles was dein ist, ist auch mein!“ ist also vom Gericht nicht anerkannt.
Auf Veranlassung der Militärregierung werden in jedem Kreise Entnazifizierungsausschüsse, deren Mitglieder aus Nazi-Gegnern oder doch zumindest aus Nicht-Nationalsozialisten bestehen soll, gebildet, die die Säuberung der Betriebe und der Wirtschaft von alten Parteimitgliedern (bis 1937 in die N.S.D.A.P. eingetreten) durchzuführen hat. Ich habe gegen meine Absetzung als Lehrer bei der Berufungsinstanz Einspruch erhoben und um Einleitung eines Verfahrens gegen mich gebeten. Vor mir und vielen anderen Leidensgenossen liegt eine dunkle Zukunft, von der niemand weiß, was sie uns noch bringen wird. Bis zum 15. Juli diesen Jahres mußten alle amtsenthobenen Lehrer ihre frühere Dienstwohnung räumen. Das ist der Dank für langjährige treue Arbeit als Landlehrer!
Am 15.9.1946 fanden, nachdem das deutsche Volk letztmalig im Jahre 1932 zur Wahlurne schreiten durfte, in allen vier Besatzungszonen die ersten Gemeindewahlen statt. Die Ortsgruppe der SPD (Sozialdemokraten) hatte in Wahlversammlungen eine rege Propaganda entfaltet und hatte sich durch Wort und Schrift die größte Mühe gegeben, insbesondere die vielen Flüchtlinge für sich zu gewinnen. Man versprach ihnen das Unmögliche: Arbeit und Brot, Bauernhöfe und Siedlungen, Wohnungen, Mobiliar und eine glückliche Zukunft. Auch von der CDU (Christlich Demokratische Union) und FDP (Freie Demokratische Partei) wurden gut besuchte Wahlversammlungen, die zur Aufklärung dienten, abgehalten. Mit der größten Spannung erwartete jeder Bürger den Ausgang dieser Wahl. Die SPD war sich ihres Sieges bereits so sicher, daß man sogar wagte, die Namen der zukünftigen Amtsträger zu nennen. Doch es kam ganz anders!
Sowohl die SPD wie auch die CDU hatten je eine Liste von je vier Kandidaten aufgestellt. Viele Ortseingesessene waren von der Wahl ausgeschlossen, denn sie waren entweder alte Nationalsozialisten (vor 1933) oder waren der N.S.D.A.P. vor dem 1.5.1937 beigetreten. (Anordnung der Militärregierung.)
[130] Jeder Wahlberechtigte konnte, da sechs Gemeinderäte zu wählen waren, auch sechs Stimmen abgeben. Mancher Wähler hat jedoch nur die vier Kandidaten seiner Liste gewählt. Die größte Enttäuschung erlebte die SPD bei den Flüchtlingen, die trotz der vielen Versprechungen, sich für die Liste der Eingesessenen entschieden.
Ergebnis der Wahl:
Wahlberechtigt: 192, gewählt haben 155.
Abgegebene Stimmen: CDU 342 SPD 230.
Stimmenverteilung: Heinrich Rühmann 93 (CDU), Friedrich Seider 85 (CDU), Frau Emma Krohn 85 (CDU), Doll 79 (CDU), Ernst Studt 60 (SPD), Johannes Behnke 58 (SPD), Willi Evers 56 (SPD), Frau Taube 56.
Unter Zugrundelegung des Divisors 82 sind die Kandidaten in folgender Reihenfolge gewählt: H. Rühmann, F. Seider, Ernst Studt, E. Krohn, Doll, J. Behnke.
Auf Anordnung der Militärregierung wurde der Besitz des Bauern Hans Schnack, groß 50 ha, unter Geschäftsaufsicht gestellt, und durch einen Treuhänder beaufsichtigt. Herr Schnack war altes Parteimitglied der N.S.D.A.P. aus dem Jahre 1930 und Kassenamtsleiter der Ortsgruppe. Am 19.9.1946 trafen wieder neun Ostflüchtlinge ein, die in unserer Gemeinde untergebracht werden mußten. Wie man vernimmt, wird jetzt das Flüchtlingslager bei Segeberg aufgelöst, obgleich noch weitere 100.000 Flüchtlinge aus Dänemark in Schleswig-Holstein Aufnahme finden sollen.
Im benachbarten Hitzhusen nahm die Polizei nach erfolgter Haussuchung, durch die undenklich viel Heeresgut wie: Militärstiefel, Anzüge, Decken, Autobereifungen und dergleichen, aber auch Schinken, Speck, Zucker und andere Knappwaren sichergestellt werden konnten, mehrere Verhaftungen vor. Die Täter (Pauls und Wieses Sohn) wurden vom englischen Militärgericht zu fünf bis neun Monaten Gefängnis und Geldstrafen verurteilt.
In Weddelbrook machte die Polizei einen guten Fang. Sie verhaftete acht bis zehn Personen wegen Diebereien, Schwarzhandel und Schwarzbrennerei. Der Plan dieser Bande, das Geschäftszimmer des Bürgermeisters auszuplündern, gelangte nicht mehr zur Durchführung.
Auch in Hasenmoor wurde eine Diebesbande festgenommen und in Fuhlendorf ein Landarbeiter wegen Schwarzschlachtung verhaftet.
In vielen Kreisen sind die Entnazifizier-Kommissionen in Tätigkeit getreten. Viele Geschäfte, deren Inhaber Mitglied der N.S.D.A.P. waren, erhalten einen Treuhänder, der bisherige Inhaber darf sein Geschäft nicht wieder betreten, den Familienangehörigen wird vorläufige Mitarbeit gestattet. (Itzehoe 16 Geschäfte, Kellinghusen 57 Geschäfte).
[131] In unserer Gemeinde wurde auch der Bauernhof Johs. Lohse unter Treuhänder gestellt. Durch eine neue, soeben veröffentlichte Verordnung der Kontroll-Kommission soll nunmehr die Bestrafung ehemaliger Parteigenossen, die in fünf Gruppen eingeteilt werden, durch die Besatzungsmächte unter Hinzuziehung deutscher Gerichte und Dienststellen erfolgen.
Ab 30.9.1946 werde ich (Arbeitsamt) Hilfsarbeiter in der Schlosserei Weibezahl, Bad Bramstedt. Weibezahl ist, wie ich, ebenfalls am 1. Mai 1933 der N.S.D.A.P. beigetreten und bekleidete das Amt eines Zellenwartes.
Am 30.9.1946 besuchen uns zu unserer größten Freude zwei Kameraden unseres Sohnes Kurt, die krankheitshalber aus russischer Kriegsgefangenschaft entlassen wurden: Jansen aus Rade und Voß aus Arpsdorf. Sie geben uns einen genauen Bericht über unseren Sohn, der mit 2.500 Kameraden in einem großen Lager am Stadtrand von Leningrad untergebracht ist und in einem Sonderkommando in einer mächtigen Staatsziegelei mit etwa 100 Mann als Zimmermann arbeitet. Die Verpflegung ist ausreichend, die Behandlung gut. Die Gefangenen erhalten täglich unter anderem fünf gute Zigaretten und 17 g Zucker.
In der Kreistagswahl am 15.9.1946 erhalten die bürgerlichen Parteien eine reine Mehrheit vor der SPD (36:8). Heinrich Rühmann wird zum Bürgermeister unserer Gemeinde gewählt.
Am 3.9. Beendigung des Nürnberger Prozesses, am 16.9. werden die meisten der Verurteilten durch den Strang hingerichtet und ihre Asche in alle Winde zerstreut. Reichsmarschall Hermann Göring gelingt es, durch Gift sich der Hinrichtung durch den Strang zu entziehen.
Das Internierungslager Gadeland, in dem auch ich drei Monate verbrachte, wird aufgelöst und die Insassen, unter ihnen unser früherer Ortsgruppenleiter G. Blunk, nach einem Lager bei Paderborn überführt.
Am 15.9.1946 bemerken wir im Südwesten einen mächtigen Feuerschein. Das Wirtschaftsgebäude des Bauern Otto Rehder in Hingstheide brennt bis auf die Grundmauern nieder. Viele Futtervorräte fallen den Flammen zum Opfer. Ursache des Brandes: Flüchtlinge hatten ein Rohr des Feuerherdes durch das Fenster geleitet, und so hatte das Strohdach Funken gefangen. Auch unsere Wehr war noch zur Brandstätte geeilt, um mit der Motorspritze einzugreifen, doch mangelte es an Wasser, so daß sie recht bald wieder abrücken konnte.
Die Lebensmittelzuteilungen werden auf 1.550 Kalorien erhöht (bisher 1.050 Kalorien).
Gelegentlich einer ärztlichen Schuluntersuchung im August diesen Jahres wurde durch den Flüchtlingsarzt Dr. Vogel festgestellt, daß über 50% aller Schulkinder unterernährt sind. Seit dieser Zeit wird, wie in den allermeisten deutschen Schulen, eine tägliche Schulspeisung durchgeführt. Die Lebensmittel werden durch das „Rote Kreuz“ zur Verfügung gestellt.
[132] Am 30. Oktober 1946 fand eine allgemeine Volkszählung statt.
Die Gemeinde Föhrden Barl hat zur Zeit 414 Einwohner, davon 187 männlichen und 227 weiblichen Geschlechts. Ich schätze die Zahl der Einheimischen auf etwa 180, so daß sich 234 Flüchtlinge aus den Ostgebieten in der Gemeinde aufhalten. Viele Kriegsgefangene sind noch nicht zurückgekehrt, mancher gilt noch als vermißt, die Opfer des sinnlosen Krieges sind gewaltig, und so ist es nicht zu verwundern, daß das weibliche Geschlecht an Zahl überwiegt. Die Zahl der Haushaltungen hat sich verdreifacht. Jedes heizbare Zimmer beherbergt eine Familie und ist Wohn-, Schlafstube und Küche zugleich.
18.11.1946
Die letzte alte Räucherkate unserer Gemeinde, Besitzer Fritz Fölster, wurde in diesen Tagen umgebaut und mit Schornstein versehen. Auch der altertümliche Beilegeofen, der vom Küchenherd aus geheizt wurde, wurde durch einen modernen Ofen ersetzt. In den letzten Jahrzehnten räucherten viele Bauern, ja sogar Schlachter aus der Stadt, mit Vorliebe die Schinken, Mettwürste und die Speckseiten bei der alten stets freundlichen „Oma Fölster“.
Wenn ich als Jäger an dieser alten Strohkate vorbeikam, zog meistens dicker Qualm aus dem oberen Teil der großen Tür und durch die „Blangdör“. Wie oft warf ich einen neidischen Blick nach den mächtigen Schinken und dicken Würsten. Vorbei ist die alte schöne Zeit, doch die Erinnerung bleibt!
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Im Frühjahr 1947, am .. .. [Datum unleserlich, korrektes Datum ist lt. Auskunft des Einwohnermeldeamtes Bad Bramstedt der 18.11.1947!] starb der Lehrer Wilhelm Mohr im Alter von 63 Jahren. Er war über 30 Jahre Lehrer in Föhrden Barl gewesen und hatte viel für Schule und Gemeinde getan. Die Föhrdener, die zu ihm zur Schule gegangen sind, erzählen oft und gern von ihrer Schulzeit und nie habe ich gehört, daß sie schlecht über ihren alten Lehrer sprachen. Nur Gutes und Angenehmes wissen sie zu berichten. – Nun ist dieser alte „Schulmeister“ nicht mehr und in der Chronik sind seit dieser Zeit keine Eintragungen mehr gemacht worden.
Wenn man liest, was Wilhelm Mohr hier in diesem Buch für die Nachwelt eingeschrieben hat, so muß man fast annehmen, daß er Tagebuch führte, so viel persönliches hat er dem Buch anvertraut. Wie muß dieser Mensch doch mit seinem Beruf verwachsen gewesen sein, daß selbst sein Privatleben von dem schulischen nicht zu trennen gewesen ist. So stelle ich mir den alten „Dorfschulmeister“ vor, der ganz in und mit seiner Schule [133] lebt, so daß der Mensch vom Lehrer nicht mehr zu unterscheiden ist. Ich glaube, daß kann man aber nur erreichen, wenn man, wie Wilhelm Mohr, so lange Lehrer in einer Gemeinde war.
Wenn ich nun als der ordentliche Nachfolger des alten Lehrers Wilhelm Mohr dieses Buch weiterführen soll, so muß ich erst einmal ganz kurz die Zeit streifen, die zwischen seinem Abgang aus dem Schuldienst nach dem Zusammenbruch 1945 und meinem Eintritt in den Schuldienst hier in Föhrden Barl im März 1948 liegt.
Deutschland lag 1945 zerschlagen am Boden. Alles Leben, sowohl das wirtschaftliche, als auch das gesellschaftlich-soziale, schienen erstorben zu sein. Nur langsam hat sich alles wieder normalisiert und heute noch sieht man hier und da noch Überbleibsel aus jener furchtbaren Zeit. Ich habe nicht die Absicht, die Geister jener Tage wieder heraufzubeschwören, doch einiges, was zum Verständnis der schulischen Verhältnisse nötig ist, muß ich erwähnen. – Nachdem man Wilhelm Mohr als sogenannten „Kriegsverbrecher“, wie man damals fast alle ehrlichen, braven Deutschen bezeichnete, seines Amtes als Lehrer enthoben hatte, war gar keine Schule hier in Föhrden Barl. Wie aus den amtlichen Schreiben aus jener Zeit hervorgeht, muß es überall sehr schwierig, wenn nicht unmöglich gewesen sein, einen einigermaßen geordneten Schulbetrieb auf die Beine zu stellen. Es fehlte eben an allem. Keine Lehrer, keine Bücher, keine Räume. Das hörte man allenthalben. Die Lehrer waren abgesetzt, die vorhandenen Schulbücher durften nicht benutzt werden und die Schulräume wurden vielerorts für andere Zwecke gebraucht. Wie ich aus den Akten ersehen konnte und aus Berichten erfahren habe, war die Situation in Föhrden Barl folgende:
[134] Am 1. August 1945 schickte das Schulamt den Lehrer Ottomar Schulz, einen 64-jährigen Berliner Lehrer, der als Ostflüchtling in Lentföhrden gewohnt hatte, nach Föhrden Barl, um den Schulbetrieb provisorisch wieder aufzunehmen. Der Mangel an Schulbüchern und die durch die vielen Flüchtlinge stark angewachsene Kinderzahl, – es waren an die 80 Kinder – erschwerten den Unterricht natürlich ganz kolossal. Daß unter diesen Umständen nicht viel geschafft werden konnte, ist nur zu verständlich. Was in dieser Zeit von den Kindern versäumt worden ist, konnte in den nächsten Jahren kaum, ja zum Teil überhaupt nicht, nachgeholt werden. Als ich am 15. März 1948 meine Tätigkeit als Lehrer hier aufnahm, habe ich das Erbe einer turbulenten Zeit übernommen. Außerdem wurde mir der Anfang hier schwer gemacht, weil das Dorf einen anderen Lehrer hierher haben wollte. Doch die Regierung entschied anders, und so habe ich meine Lehrertätigkeit, die ich 1945 in Thüringen auch beenden mußte, wie die meisten meiner Kollegen hier in Schleswig-Holstein wieder aufgenommen. Aller Anfang ist schwer – das kann ich wohl auch von meiner ersten Lehrertätigkeit hier in Föhrden Barl behaupten. Mir traten noch dieselben Schwierigkeiten entgegen, die schon meinem Vorgänger das Leben schwergemacht hatten. Schwierigkeiten auf rein schulischem, erzieherischem und organisatorischem Gebiet. Für den Unterricht fehlte es an allem. Kein Lehrbuch war dar, nach dem unterrichtet werden konnte, keine Hefte für die Kinder zum Schreiben. Die Disziplin ließ sehr viel zu wünschen übrig und nicht zuletzt erhob sich die Frage, [135] wie die vielen Kinder in einem Klassenraum unterrichtet werden sollten, um jedem Schuljahr so viel Unterrichtsstunden wie nur möglich zu geben. Es mußte in zwei Schichten unterrichtet werden. Langsam kamen dann die ersten Schulbücher. In Schleswig-Holstein wurde die Lehrmittel-freiheit eingeführt. Doch die bereitgestellten Mittel reichten bei weitem nicht aus, um den großen Bedarf an Lernmitteln nur annähernd zu decken. Es dauerte immerhin vier Jahre, bis alle Bücher angeschafft waren. Einen Lichtblick gab es, als der Gemeinderat im Herbst 1948 beschloß, eine zweite Lehrerstelle zu beantragen. So kam am 1. Mai 1949 der Junglehrer Otto Sommer als zweiter Lehrer nach Föhrden Barl. Jetzt konnte ein geregelter Schulbetrieb aufgenommen werden. Allerdings bedingte der eine Klassenraum eine Einteilung in Vormittags- und Nachmittagsunterricht. Doch der große Vorteil war, daß alle Schuljahre ihre vorgeschriebene Stundenzahl erhalten konnten, so daß Föhrden Barl als eine der ersten Schulen im Kreis die vorgeschriebene Stundenzahl für alle Schüler melden konnte. Da der Nachmittagsunterricht erfahrungsgemäß nicht den Wert des Vormittagsunterrichtes erreicht, wurde der Unterricht in den beiden Stufen (1. – 4. und 5. – 9. Schuljahr) abwechselnd erteilt, so daß jede Stufe ein-mal in den Genuß des Vormittagsunterrichtes kam. Zuerst wurde wochenweise, späterhin tageweise ge-wechselt. So ging das drei Jahre hindurch und der Schulbetrieb normalisierte sich immer mehr. Organi-satorische Schwierigkeiten, wie sie in anderen Schulen auftraten, gab es bei uns nicht, zumal die Schü-lerzahl durch die Abwanderung vieler Flüchtlinge (Umsiedlung) immer mehr herabsank, bis schließlich 1952 nur noch 49 Kinder die [136] Schule besuchten, gegenüber einen Höchststand 1950 von 84 Schü-lern. Damit war die Meßzahl von 50 Schülern für einen Lehrer unterschritten und es tauchte nun die Gefahr auf, daß die zweite Schulstelle wieder eingezogen würde. Der Gemeinderat allerdings bewilligte, trotz der großen finanziellen Belastung des Gemeindeetats, die zweite Schulstelle weiterhin, so daß nur der Schulrat bzw. die Regierung uns den zweiten Lehrer fortnehmen konnten. Das war dann auch im August 1952 der Fall. Im Kreis war durch den Tod eines Kollegen eine Stelle notwendig zu besetzen, und da der Schulrat keinen Lehrer zur Verfügung hatte, mußte unser Otto Sommer auf Anordnung des Schulamtes nach den großen Ferien seine Koffer packen und nach Margarethenhof bei Bad Segeberg übersiedeln, trotzdem sich Gemeindevertreter für sein Bleiben eingesetzt hatten. Nun war unsere Schule wieder einklassig, wie sie es früher immer gewesen war. Damit kam auch wieder ein ganz normaler Schulbetrieb zustande, d.h., die Kinder haben ihre volle Stundenzahl, brauchen jedoch nur vormittags zur Schule. Das ist natürlich für Schüler und Lehrer ein großer Vorteil, an dem auch das Elternhaus einen gewissen Anteil hat, denn in unserem rein bäuerlichen Bereich werden die größeren Kinder schon nötig im Hause gebraucht, sei es zum Einhüten oder als wertvolle Hilfe bei den Erntearbeiten. – In diesem Jahr (1953) sank die Schülerzahl auf 42, und es ist zu erwarten, daß sie auch noch weiterhin sinkt, so daß die Schule Föhrden Barl bald wieder das gleiche Bild zeigt wie vor dem Kriege.
[272] Die Schule bekommt eine Wasserleitung
Auf unserem Schulhof befand sich eine Pumpe, die den Schulkindern zum Händewaschen und Trinken zur Verfügung stand. Doch das Gesundheitsamt beanstandete die Anlage, weil kein ordnungsgemäßer Abfluß des ablaufenden Wassers vorhanden war. Außerdem war die Pumpe während des Winters oft lange Zeit nicht zu gebrauchen, da sie eingefroren war. Also mußte Abhilfe geschaffen werden. Ein provisorisches Abstellen der Mängel schien nicht ratsam. Auch wollte der Bürgermeister, es war der Bauer Johannes Lohse, wenn doch schon Geld ausgegeben werden mußte, gleich etwas Ordentliches schaffen. So kam das Projekt, eine Wasserleitung mit elektrischer Pumpanlage zu bauen, zustande. Im Frühjahr 1953 wurden durch die Gemeinde von verschiedenen Unternehmern Kostenanschläge für eine solche Anlage angefordert. Nach einer Gemeinderatssitzung wurde dem Klempnermeister Voß aus Wrist der Auftrag erteilt, in der Schule eine Wasserleitung mit Pumpanlage zu legen. Vorgesehen war, für die Schulkinder Wasch- und Trinkanlagen zu schaffen und Wasserleitung in die Küche und Waschküche zu legen. Nun galt es, einen geeigneten Raum zu finden, wo die Waschgelegenheit für die Kinder und der Druckkessel aufgestellt werden sollten. Nach manchen Überlegungen fand man in dem Lehrmittelraum, der sich hinter dem Klassenraum befand, den geeigneten Ort. Dort sollte sowohl die Wasch- und Trinkanlage, als auch der Druckkessel untergebracht werden. Nun mußte aber ein neuer Lehrmittelraum gefunden werden. [273] Dazu nahm man einen kleinen Raum der Lehrerwohnung, der zu diesem Zweck freigemacht wurde. Die kleine Unannehmlichkeit, einen etwas weiteren Weg machen zu müssen, wenn etwas aus dem Lehrmittelzimmer geholt werden mußte, wurde gern in Kauf genommen. In den Sommerferien ging es an die Ausführung des Projektes. Der Maurermeister und Bauunternehmer Hermann Blöcker aus Föhrden Barl erschien mit seinem Gesellen, um die notwendigen Maurerarbeiten auszuführen. Zuerst wurde der Waschraum betoniert und gekachelt. Dann mußten noch zwei Senkgruben für den Wasserabfluß gebaut werden. Jetzt konnte mit dem Bau der Wasseranlage begonnen werden. Gräben wurden gezogen und Rohre verlegt. Das Wasser holte man aus der Pumpe auf dem Schulhof, weil diese das beste Wasser gab. Nach drei Wochen lief das erste Wasser aus den Wasserhähnen. Das war ein schönes Ereignis für unser Schulhaus, brauchte man doch nun nicht mehr zu pumpen, sondern brauchte nur den Wasserhahn aufzudrehen, wenn man Wasser wollte.
[234] Unsere Dorfstraße wird Kreisstraße
Föhrden Barl hat verkehrstechnisch eine sehr gute Lage. Durch seine Lage an der Fernverkehrsstraße 206 ist die Ost-West-Verbindung nach Bad Bramstedt (Hitzhusen) mit Anschluß an die Fernverkehrsstraße 4 und nach Itzehoe über Wrist mit Anschluß an die Fernverkehrsstraße 5 sehr günstig. Doch nach den Nachbargemeinden im Norden (Quarnstedt) und im Süden (Weddelbrook) besteht keine ordentliche Verbindungsstraße. Nur auf schlechten Feldwegen kann man die Nachbargemeinden erreichen. Nach dem Norden bestehen jedoch nur schwache Bindungen, da Quarnstedt schon zu einem anderen Kreis gehört und dadurch schon keine Kommunalbeziehungen bestehen. Ganz anders liegt der Fall bei Weddelbrook. Dieses gehört schon kommunalpolitisch zu Föhrden Barl, da beide Gemeinden zu einem Amtsbezirk gehören. Auch familiäre Bindungen bestehen zu dieser Nachbargemeinde.
Nun tauchte im Frühjahr 1951 der Plan auf, die Verbindung von Föhrden Barl nach Weddelbrook durch eine ausgebaute Straße herzustellen. Der Anstoß dazu kam von Weddelbrook, das großes Interesse an einer guten Verbindungsstraße zur Hauptstraße 206 und weiter zum Bahnhof Wrist und damit zur Bundesbahnhauptstrecke Kiel – Hamburg hatte. So kam es zu Verhandlungen über den Ausbau des Feldweges über Krücken nach Weddelbrook zu einer festen Straße. Weddelbrook verpflichtete sich, den größten Teil der Kosten für den Ausbau der Straße zu übernehmen. Was an Vorarbeiten zu leisten war, wurde in vielen, ja zum Teil erbitterten, Verhandlungen, die zwischen [235] den interessierten Gemeinden und dem Kreisbauamt geführt wurden, erledigt. Föhrden Barl brauchte nur den Teil der Straße zu übernehmen, der durch das Dorf führte. Nach dem Ausbau wollte der Kreis die Straße als Kreisstraße übernehmen und für eine Teerdecke sorgen.
Nun konnte mit dem Straßenbau begonnen werden. Die Arbeiten wurden einer Baufirma übergeben, die im Rahmen von Notstandsarbeiten die Arbeitslosen der Gemeinden beschäftigte. Viele Monate hindurch war das Gespenst der Arbeitslosigkeit aus unserem Dorfe verbannt. Die Bauern waren durch Hand- und Spanndienste auch an dem Straßenbau beteiligt. Jeder Einwohner trug seinen Teil am Bau der neuen Straße bei. So wurde der Gemeindesäckel nicht allzu stark beansprucht. – Allerlei Arbeiten waren zu bewältigen. Der Weg mußte verbreitert werden. Neue Gräben waren anzulegen. Bei Krücken mußten große Erdmassen bewegt werden, um eine unnötige Steigung über die Weddelbrooker Lieth zu beseitigen. Aber dann war es doch so weit, die neue Straße konnte eingeweiht und dem Kreis übergeben werden. Es dauerte aber noch ein Jahr, ehe die Straße geteert werden konnte. Aber auch das wurde dann gemacht und nun führt durch unser Dorf anstelle der alten schmutzigen Dorfstraße eine feine glatte Teerchaussee, die dem Dorf gleich ein ganz anderes Gesicht gibt. Föhrden Barl ist stolz auf seine schöne neue Dorfstraße.
[236] Begradigung der Kurve in der B 206 und Bau eines neuen Kreisstraßenstückes (28.11.1965)
Das Jahr 1965 brachte in verkehrstechnischer Hinsicht bedeutende Veränderungen in der Gemeinde Föhrden Barl. Schon seit etwa zehn Jahren war die Begradigung der Kurve in der B 206 in Erwägung gezogen worden. Doch immer wieder war die Ausführung dieses Projektes verschoben worden. Als Folge der ungeheuren Zunahme der Verkehrsdichte bildete die Kurve eine immer größer werdende Gefahr für alle Verkehrsteilnehmer. Diese Gefahr wurde noch verstärkt durch die unübersichtliche Einmündung der Dorfstraße in die Kurve. Auch die Schulkinder waren auf ihrem Schulweg zunehmend gefährdet. So atmeten fast alle Dorfbewohner erleichtert auf, als im Sommer 1965 die Begradigung der Kurve in Angriff genommen wurde. Die Arbeiten gingen zügig voran. Zur Fundamentierung der neuen Straße wurden Sand und Kies aus einer Grube [237] des Bauern Fritz Fölster angefahren. Raupen und Bagger sorgten für ein rasches Legen des Straßenfundamentes, so daß schon Ende September das neue Straßenstück befahren werden konnte.
Vermutlich im Zuge des Ausbaues von Zubringerstraßen zum geplanten Flugplatz in Heidmoor wurde auch in diesem Jahr ein neues Kreisstraßenstück gebaut. Es verläuft in gerader Linie von der Gastwirtschaft Nittmann (ehemals Blöcker) bis zur Gastwirtschaft Emcke (ehemals Steenbock) und mündet dort in die Straße, die nach Weddelbrook führt. Der Bau der neuen Brücke über die Bramau wurde behindert dadurch, daß die Bramau in diesem Herbst mehrfach Hochwasser führte. Dadurch wurden die Bauarbeiten unterbrochen. Zum Teil wurden auch erhebliche Bauholzmengen weggeschwemmt. Der sehr früh hereinbrechende Winter (Mitte November: Schneeverwehungen und Temperaturen bis zu -10°C) verhinderte die Fertigstellung dieses Projektes.
[238] Die neue Kreisstraße gibt dann den schweren LKWs den Weg zur Nachbargemeinde Weddelbrook frei. Die alte Brücke ist wegen Baufälligkeit nur noch von Fahrzeugen mit beschränktem Gesamtgewicht zu befahren.
Am 23.11.1965 wurde auf der Gemeindevertretersitzung unter Vorsitz von Bürgermeister Max Fölster beschlossen, daß unser Dorf eine Beleuchtung haben soll. Wenn dann noch die Tatsache in Betracht gezogen wird, daß sich die Gemeinde finanziell am Ausbau eines Bürgersteiges an der neuen Kreisstraße und der Bundesstraße beteiligt, verstärkt sich der Eindruck, daß sehr viel für die Sicherheit der Bewohner getan wird.
[274] Lehrerwechsel Ostern 1962 Fritz Osterholz, apl. Lehrer
Zum 2.4.1962 wurde ich an die Volksschule Föhrden Barl berufen. Mein Vorgänger, Hauptlehrer W. Günther, hatte sich für die vakante Schulleiterstelle in Hitzhusen beworben. Dieser Schritt ist zu verstehen, da Kollege Günthers neue Dienststelle wesentlich bessere Voraussetzungen für sein berufliches Wirken bietet. Wie ich es beurteilen kann, hat Herr Günther hier recht gute Unterrichtserfolge erzielt. Daß das Ehepaar Günther bei Betrachtung der Persönlichkeiten nett, herzlich und hilfsbereit ist, konnte ich in dem halben Jahr, in dem wir die Dienstwohnung teilten, erfahren.
Da ich direkt von der pädagogischen Hochschule in Kiel hierher an die einklassige Schule berufen wurde, war der Anfang für mich recht schwer. Ich hatte zwar nicht mit Vorurteilen zu kämpfen wie mein [275] Vorgänger, denn ich bin selbst Bauernsohn und kannte daher das Milieu des Landes. Dadurch, daß ich mit den Bewohnern meist plattdeutsch sprach, mangelte es auch nicht an Kontakt-möglichkeiten. Andererseits bereiteten die Vielschichtigkeit des Unterrichts an diesem Schulsystem zunächst fast unüberwindbare Schwierigkeiten. Dazu kam noch die Verwaltung der Schule und das Gestalten von Dorfesten wie Kinderfest und Weihnachtsfeiern. Das alles war völliges „Neuland“ für mich. Da ich erst 21 Jahre alt war, fehlten mir auch jegliche Erfahrungen in diesen Gebieten.
In den 3 ½ Jahren meines Wirkens an dieser Dienststelle habe ich mir zwar viele Erfahrungen aneignen können. Außer der Mühe gab es auch viele Augenblicke der Freude. Dennoch wich in pädagogischer Hinsicht ein gewisses Unbehagen und die Unzufriedenheit über die Unzulänglichkeit dieses Systems nicht von mir.
[276] Abstimmung über den Anschluß an eine Dörfergemeinschaftsschule
Am Anfang des Jahres 1963 wurde vom Gemeinderat die Initiative für den Anschluß an eine Dörfergemeinschaftsschule ergriffen. Ins Auge gefaßt wurde der Anschluß an Hitzhusen. Doch auch die Gemeinden Wrist und Weddelbrook hatten Interesse daran, die Föhrden Barler Schulkinder zu übernehmen. Da jedoch der Gemeinderat eine Entscheidung über die Köpfe der Bürger hinweg nicht fällen wollte, wurde zu einer öffentlichen Gemeindeversammlung geladen, in der alle Wahlberechtigten Einwohner der Gemeinde durch Abstimmung Stellung zu diesem Problem nehmen konnten. Diese Stellungnahmen sollten als eine Art Meinungsforschung gedacht sein. Am 19.2.1963 erschienen 47 Bürger zu der Abstimmung. Nach einer Aussprache zu dem Problem wurden Wahlscheine mit folgenden Fragen ausgegeben:
[277]
A. Für eine Dörfergemeinschaftsschule?
Gegen eine Dörfergemeinschaftsschule?
B. Anschluß an Hitzhusen?
Anschluß an Wrist?
Anschluß an Weddelbrook?
Nach der Abstimmung nahm Altbauer Heinrich Harbeck die Auszählung vor. Sie erbrachte folgendes Ergebnis:
Für eine Dörfergemeinschaftsschule: 17 Stimmen = 36%.
Gegen eine Dörfergemeinschaftsschule: 30 Stimmen = 64%.
Auf die drei Anschlußorte entfielen etwa gleich viele Stimmen. Der Gemeinderat entschloß sich daraufhin einstimmig gegen den Anschluß an eine Dörfergemeinschaftsschule. Somit war dieses Problem erst einmal wieder auf Eis gelegt. Wenn sich die Bürger der Gemeinde länger mit diesem Problem befaßt haben werden, hoffe ich, daß auch hier die Einsicht allzu konservative Ressentiments verdrängen wird.
[278] Anschaffung neuer Schulmöbel
Da die alten Bänke schon lange nicht mehr den modernen Anforderungen an das Schulmobiliar entsprachen und auch nach gesundheitlichen Gesichtspunkten nicht mehr zeitgemäß waren, trug ich dem Bürgermeister Max Fölster den Wunsch nach Anschaffung neuer Schulmöbel vor. Herr Fölster fand den Antrag gerechtfertigt und setzte ihn am 6.4.1964 zur Beratung und Beschlußfassung auf die Tagesordnung der Gemeinderatssitzung. Der Antrag wurde durch Abstimmung angenommen. Herr Kock als Gemeindevertreter, Frau Hargens als Mitglied des Schulausschusses und ich fuhren zur Schulmöbelfabrik Richter in Uetersen. Ausgesucht und bestellt wurden: 10 Schülertische, 20 Schülerstühle, 1 Lehrertisch, 1 Lehrerstuhl, eine Wandtafel (in der Höhe verstellbar, 6 qm Schreibfläche). Die Stühle haben Kufen und entsprechen den Gütebedingungen des Kultusministeriums.
[279] Schon bei Schulbeginn nach den Sommerferien 1964 konnten die Schüler in eine völlig neu anmutende Schulklasse einziehen. Auch mir bringt die Beweglichkeit des Schulgestühls wesentliche Erleichterung in der Gestaltung des Unterrichtes.
Die alten Bänke wurden von Bürgermeister Fölster öffentlich versteigert. Sie dienen jetzt größtenteils als Gartenbänke oder Sitzgelegenheiten in Kinderzimmern.
Weitere Bemühungen um Schulzusammenlegungen
Bestrebungen von Wrister Seite
Am 15. Dezember 1965 fand im Café Reher eine Besprechung zum Thema „Dörfergemeinschaftsschule“ statt, zu der Gemeindevertreter und Lehrer der Gemeinden Hingstheide, Föhrden Barl, Quarnstedt, Siebenecksknöll, Wulfsmoor und Wrist eingeladen waren. Ebenso erschienen Landrat Matthiesen, Schulrat Hiller und zwei Herren von der Verwaltung.
[280] Landrat Matthiesen wies in seiner Vorrede zunächst auf die veränderte Lage in der Planung und Erstellung von Dörfergemeinschaftsschulen hin. Die Behörden der Kreise seien gar nicht so genötigt, in dem anfänglich starken Maße für die Dörfergemeinschaftsschulen zu werben. Viele Gemeinden seien schon von selbst zu der Überzeugung gelangt, daß eine solche Veränderung des Schulwesens erforder-lich sei. Wirklich seien Land und Kreise schon überfordert, finanziell diesen Umwälzungen gerecht zu werden. Für neue Schulprojekte seien daher erst in fünf oder sechs Jahren Mittel greifbar. Dennoch drängte der Landrat darauf, daß möglichst bald im Raume Wrist ein Schulverband gegründet würde.
In der anschließenden Aussprache meldeten die meisten angesprochenen Gemeinden Bedenken an, ja einige verhielten sich ablehnend [281] gegenüber diesem Vorschlag. Als Gründe gaben diese Gemeindevertreter folgende an:
Quarnstedt: Die kleine Schule ist leistungsfähig genug. Die Gebäude sind relativ neu.
Wulfsmoor: Ein Anschluß an Kellinghusen ist günstiger. Mittelschüler könnten auch befördert werden.
Hingstheide: Die Finanzschwäche der Gemeinden erlaube keine solch großen Projekte.
Föhrden Barl: Der Gemeindevertreter Klaus Harbeck erklärte, daß Föhrden Barl auch ein Angebot aus Hitzhusen habe, sich dieser Schule anzuschließen.
Schulrat Hiller und Landrat Matthiesen zerstreuten die meisten Bedenken, doch in einigen Dingen konnte keine Übereinstimmung erreicht werden. Die Lehrerschaft äußerte sich durchweg positiv zu dieser Planung [282] und hob dabei die pädagogischen Aspekte hervor.
Diese Besprechung hat keine konkreten Ergebnisse hervorgebracht. Sie sollte mehr als Sondierung der Meinungen und Interessen angesehen werden.
Bestrebungen von Hitzhusener Seite
Auf Anregung einiger Amtsausschußmitglieder hin wurde in Erwägung gezogen, ob nicht die Schulkinder aus den Dörfern Heidmoor, Mönkloh, Föhrden Barl, Hagen, Weddelbrook und Hitzhusen gemeinsam in den Schulen Weddelbrook und Hitzhusen unterrichtet werden könnten. Dadurch wäre ein intensiverer Unterricht gewährleistet, und außerdem könnten personelle Schwierigkeiten so überbrückt werden. Um zu einer klärenden Besprechung zu kommen, arrangierte das Amt Bad Bramstedt-Land eine Versammlung der Bürgermeister, [283] Elternbeiratsvorsitzenden und Lehrer der beteiligten Gemeinden am 6. Mai 1966 um 20.00 Uhr in Weddelbrook bei Wolters, zu der auch Herr Schulrat Lutz und Herr Wieck erschienen.
Nach kurzer Vorrede trugen die Bürgermeister ihre Meinungen vor. Viele verschiedene Vorstellungen über organisatorische und finanzielle Regelungen wurden erörtert. Es kam zu keinem annähernd übereinstimmenden Lösungsweg zu diesem Projekt. Daraufhin machte Herr Wieck vom Schulamt den Vorschlag, einen Ausschuß zu gründen, der eine oder mehrere brauchbare Lösungswege erarbeiten sollte. Dieser oder diese könnten dann den Gemeinderäten zur Beschlußfassung vorgelegt werden. Aus der Gemeinde Föhrden Barl gehörte Gemeindevertreter Max H. Krohn diesem Ausschuß an.
[284] Mit der großzügigen Unterstützung des Amt Bad Bramstedt-Land, besonders der des Amtshauptinspektors Steinhagen, gelang es dem Ausschuß, in kurzer Zeit einen Plan über den Transport der Kinder, über die Vermögensauseinandersetzung und die laufenden Kosten aufzustellen. Es war Verbindung mit der Firma Storjohann aus Kellinghusen aufgenommen worden, die ein recht brauchbares Angebot zur Beförderung der Kinder machte. Auf einer Versammlung am 29. Juni 1966 bei H. Voss in Hitzhusen wurde dieser Plan dem selben Personenkreis wie auf der ersten Versammlung – diesmal jedoch ohne Herrn Schulrat Lutz und Herrn Wieck – vorgelegt. Nach Begutachtung dieses Plans wurde beschlossen, alle Gemeindevertreter der betroffenen Gemeinden zu einer Versammlung [285] einzuladen. So sollte vermieden werden, daß durch Klatsch und Intrigen ein falsches Bild über diese Pläne entstehen könnte.
Diese Versammlung fand unter Beisein des Herrn Schulrates Lutz und des Herrn Wieck am 10. August 1966 um 20.00 Uhr bei Wolters in Weddelbrook statt. Hier gingen Meinungen und Vorstellungen wieder weit auseinander, und es hatte den Anschein, als ob eine Einigung nie zustande kommen würde. Mehrere Weddelbrooker sahen die Notwendigkeit einer Veränderung des Schulwesens nicht ein. Die Hagener wandten sich gegen das „Provisorium“ und forderten die Endlösung, d.h.: die Dörfergemeinschaftsschule in Hitzhusen.
Anfang Oktober berief Bürgermeister M. Fölster eine Gemeindevertretersitzung ein, in der beschlossen werden sollte, ob sich [286] die Gemeinde Föhrden Barl einer Dörfergemeinschaftsschule anschließen wolle. Nach kurzer Diskussion wurde der Beschluß mit fünf gegen vier Stimmen positiv gefaßt, jedoch mit der Einschränkung, daß auch die anderen Gemeinden sich anschließen würden.
Dadurch, daß die Gemeindevertretung in Hagen allein einen Beschluß ablehnte, war die Lage wieder völlig offen. Das Amt Bad Bramstedt-Land versuchte nun, durch eine Vereinbarung über ein Gastschulverhältnis wenigstens die übrigen Gemeinden zusammenzubringen. Die Kosten für das Gastschulgeld und den Transport wären in einem vernünftigen finanziellen Rahmen geblieben. Dieser Plan scheiterte jedoch daran, daß die Gemeindevertreter aus Föhrden Barl auf einer Sitzung, die [287] am 8. November 1966 um 20.00 Uhr bei Nittmann stattfand, den Vorschlag des Amtes mit einer gegen sieben Stimmen und einer Stimmenthaltung ablehnten.
Damit war die schulische Lage in Föhrden Barl erst einmal wieder auf Eis gelegt. Das ist meines Erachtens sehr bedauerlich, da der Zustand des Schulgebäudes und der sanitären Anlagen sehr schlecht ist und die einigermaßen zeitgerechte Herrichtung große Geldsummen erforderlich machen würde.
[zusätzlich eingefügte Blätter:]
Lehrerwechsel
Am 23. November 1966 bot mir Herr Schulrat Lutz die Schulstelle der einklassigen Volksschule in Bockhorn, Kreis Segeberg, an. Nach Ausschlagung eines weiteren Angebotes aus Bilsen, Kreis Pinneberg, entschied ich mich, die Versetzung nach Bockhorn zu beantragen.
Da Weddelbrook wegen geringer Schülerzahlen nur noch zwei statt drei Lehrerplanstellen zugebilligt wurde, ordnete Herr Schulrat Lutz den Kollegen Niebuhr für ein Jahr nach Föhrden Barl ab. Mit Herrn Niebuhr verbindet mich ein nettes kollegiales Verhältnis. Daher glaube ich, daß ein den Verhältnissen entsprechend reibungsloser Lehrerwechsel gewährleistet ist.
Unterschrift F. Osterholz
[zusätzlich eingefügte Blätter:]
Lehrerwechsel
Am 3. Dezember 1966 übernahm ich die Leitung der Volksschule Föhrden Barl. Meine bisherige Planstelle in Weddelbrook war wegen zu geringer Schülerzahl aufgehoben worden. Ich sollte die Volksschule in Föhrden Barl nur für das zweite Kurzschuljahr 1966/67 leiten. Danach sollte ich an die Schule Hitzhusen versetzt werden. Dort wird eine Planstelle wegen Pensionierung frei.
Während meiner Tätigkeit in Föhrden Barl gingen die Verhandlungen über einen Anschluß zu der Dörfergemeinschaftsschule in Hitzhusen weiter. Mein Vorgänger, Kollege Osterholz, hat bereits über die bisherigen Verhandlungen berichtet. So wie mein Vorgänger versuchte auch ich, die Gemeindevertretung von der dringenden Notwendigkeit eines Anschlusses an die Dörfergemeinschafts-schule zu überzeugen. Große Unterstützung fand ich in dem Bürgermeister Max Fölster. Aber auch er konnte die Gemeindevertretung nicht überzeugen. Im Laufe weiter Verhandlungen und Gemeinderats-sitzungen kam es dann so weit, daß einige Gemeinderatsmitglieder hinter dem Rücken von Bürger-meister Fölster mit der Gemeinde Wrist wegen eines dortigen Anschlusses Fühlung nahmen. In den letzten Verhandlungen hatte sich die Mehrheit des Gemeinderates für Wrist entschlossen, obwohl die baulichen Voraussetzungen nicht vorhanden waren. Der kürzere Schulweg wurde als Hauptargument vorgebracht. Als Bürgermeister Fölster von diesen heimlichen Verhandlungen erfuhr, kam es innerhalb des Gemeinderates zu einer sehr erregten und lautstarken Auseinandersetzung. Bürgermeister Fölster forderte eine erneute Abstimmung über einen Anschluß an Hitzhusen. Sieben Stimmen dagegen, zwei Stimmen dafür. Bürgermeister Fölster legte daraufhin sein Bürgermeisteramt mit der Begründung nieder, die Verantwortung gegenüber der Elternschaft nicht mehr tragen zu können. Er überreichte dem stellvertretenden Bürgermeister Ernst Kock das Amtssiegel. Herr Kock versuchte dann, mit aller Macht einen Anschluß an Wrist durchzudrücken. In einer weiteren Gemeinderatssitzung wurde dann für den Anschluß an Wrist mit großer Mehrheit gestimmt. Herr Fölster war der festen Überzeugung, daß ein solcher Anschluß finanzielle Belastungen zur Folge habe, die Föhrden Barl nicht verkraften könne. Da er an einem „Ausverkauf der Gemeinde Föhrden Barl“ nicht teilhaben wolle, legte er auch das Mandat als Gemeinderatsmitglied nieder. Alle drei vorgesehenen Nachfolger lehnten das Amt ab.
Außenstehende Personen, die bei diesen Verhandlungen dabei waren, spürten bald, daß hier nicht das Wohl der Schuljugend im Vordergrund stand, sondern daß es hier um rein persönliche Interessen ging.
Zu dieser Zeit endete dann auch meine Tätigkeit in Föhrden Barl. Zu Beginn des neuen Schuljahres übergab ich die Leitung der Schule an die Junglehrerin Fräulein Radge. Ich wurde an die Volksschule Hitzhusen versetzt.
Unterschrift Niebuhr
Lehrerwechsel
Am 30. August 1967 übernahm ich von Herrn Lehrer Niebuhr die Leitung der Volksschule. Da die Gemeindevertretung den Anschluß an Wrist beschlossen hatte, hoffte man bald auf die Auflösung des einklassigen Systems. Das Schulamt gab aber nicht seine Zustimmung. Nach Aussage des Herrn Schulrates Lutz war Föhrden Barl beim Bau der Schule Hitzhusen dorthin mit eingeplant worden.
Da die Gemeinde auf ihrem Beschluß – sich Wrist anzugliedern – beharrte, aber keine Genehmigung dazu erteilt bekam, verzögerte sich die Auflösung der Schule immer mehr. Deshalb beschloß die Gemeindevertretung am 14.2.1968 endlich, die Schüler des ersten bis vierten Schuljahres in Hitzhusen / Weddelbrook und die des fünften bis neunten Schuljahres in die Volksschule in Bad Bramstedt einschulen zu lassen. Diese Regelung entsprach der Planung des Schulamtes und wurde daher genehmigt.
Nach Verhandlungen mit den Schulträgern, der Firma Storjohann und der VHH wurde die Auflösung der Schule Föhrden Barl und die Einschulung in Hitzhusen bzw. Bad Bramstedt für den 1.8.1968 festgelegt.
Da in beiden Schulen keine zusätzliche Planstelle eingerichtet wurde, versetzte mich das Schulamt aus dienstlichen Gründen an die zweiklassige Volksschule Hasenmoor.
Unterschrift Asmussen 16.7.1968
[Ende der zusätzlich eingefügten Blätter]
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[Statistischer Anhang S. 101 – 103]
Volkszählung innerhalb der Gemeinde
Datum Ges.E.Z. männlich weiblich Haush.
31.12.1938 192 99 93 38
17.05.1939 184 96 88 39
Viehzählungen in der Gemeinde Föhrden Barl
Datum Pferde Rinder Scha- Schwei- Geflügel Zie- Bienen- Betriebe
fe ne gen v.
1.12.1902 64 442 451
1.12.1903 66 562 646 33
1.12.1910 68 685 1229
1.12.1912 75 708 1557 1006 6
1.12.1913 76 725 1773 7
1.12.1914 71 791 1456
15.3.1915 852
1.4.1915 516
1.10.1915 70 743 450 889
1.12.1915 70 654 377 9
1.4.1916 74 781 156 886 6
1.6.1916 78 884 138
1.9.1920 98 592 47 218 8
3.12.1938 124 881 14 389 1087H,33G,41E 5 21
3.12.1940 112 860 9 382 1000,41,60 4 17 Milchk.
3.12.1941 118 818 14 195 796,51,14 3 18 281
Schülerzahl der Volksschule Föhrden Barl
Jahr Schülerzahl Knaben Mädchen
1.4.1903 34 18 16
1.4.1908 43 21 22
1.4.1910 39 19 20
1.4.1913 33 17 16
1.4.1919 40 14 26
1.4.1920 37 29 8
1.4.1925 26 13 13
1.4.1928 26 13 13
1.4.1930 27 13 14
1.4.1931 29 15 14
1.4.1932 28 14 14
1.4.1933 31 15 16
1.4.1934 30 15 15
1.4.1935 29 14 15
1.4.1936 26 13 13
1.4.1937 28 13 15
1.4.1938 26 12 14
1.4.1939 25 11 13
1.4.1940 26 12 14
1.4.1941 24 12 12
1.4.1942 22 11 11
1.4.1943 25 13 12
1.4.1945 52 24 28
1.4.1946 58 26 32
1.4.1947 68 31 37
1948 80 40 40
1949 77 39 38
1950 84 40 44
1951 67 31 36
1952 49 22 27
1953 42 22 20
1954 35 21 14
1955 26 12 14
1956 27 14 13
[110] Quellen, Urkunden etc.
1) Amtsrechnungen des Amtes Segeberg von 1537 – Staatsarchiv Kiel -. Sie enthalten die Einnahmen des Amtes von 1537: die „Grundhür“, der „jarlyk Schatth“ aus den Kirchspielen Bramstedt, Kaltenkirchen, der „Fofteinde Pennink“ aus dem ganzen Amtsbezirk und kleinere Einkünfte.
2) Segeberger Amtsrechnungen von 1606 – 1720. (Staatsarchiv Kiel.)
3) Hufner Verzeichnis der Kirchengemeinde Bramstedt von 1655 – 1740.
4) Rechnungsbuch für die Schule in Föhrden Barl, angefangen 1836.
5) Schulchronik der Schule Föhrden Barl, angefangen 1886.
6) Grundbriefe der Familie Reimers seit 1753 und viele mir zur Verfügung gestellte Schriftstücke – Grundbuchauszug 1781, Testamente, Überlassungsverträge und dergleichen.
7) Funde aus Stein- und Broncezeit, usw.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[111] Schulchronik 1886 v. Lehrer Saggau. (Abschrift!)
Über die Schulverhältnisse in Föhrden Barl aus dem vorigen Jahrhundert habe ich nichts erfahren können. Zu Anfang dieses Jahrhunderts war ein Lehrer namens Harder hier eingestellt, und ältere Einwohner sind der Meinung, daß auch schon dessen Vater seinerzeit die Schule verwaltet hat.
Der Lehrer Harder hat die Schulstelle bis zum Jahre 1857 innegehabt, ist aber schon von 1842 an von Substituten vertreten, welche von dem Lehrer Kost und Logis und von der Gemeinde Gehalt erhielten. Nachdem Lehrer Harder im Jahre 1857 pensioniert – nach Ausweis der Schulrechnungsbücher mit 80 Rhtlr. oder 180 M jährlich – wurde Lehrer Reimers von Henstedt bei Kaltenkirchen nach hierher versetzt. Derselbe verblieb hier bis zum Jahre 1861, in welchem er die Schule in Brockstedt hiesigen Kirchspiels übernahm. Ihm folgte Lehrer Sievers, der ebenfalls nur vier Jahre hier gewirkt und 1865 nach Todendorf auf Fehmarn versetzt wurde.
Nachdem um diese Zeit den Schulgemeinden das Wahlrecht bewilligt war, wurden für die durch Abgang des Lehrers Sievers vakante Schulstelle präsentiert: Lehrer Essen, Lehrer Schröder und Lehrer Sachau. In der am 28. Dezember 1865 im Schulhause hier abgehaltenen Wahl wurde letzterer gewählt und vom 8. Januar 1866 von Pastor Krogmann in Bramstedt in sein Amt eingeführt.
Bis zum Bau des jetzigen Schulhauses (1857) hatte Föhrden Barl zwei Schulhäuser, eines in Barl, nördlich der Bramau, eines in Föhrden, südlich derselben. Der Lehrer hatte die Verpflichtung, alle vier Jahre mit der Wohnung, also auch mit dem Schullokal zu wechseln. Das nicht benutzte Schulhaus wurde während der restlichen Zeit vermietet. Den Grund zu dieser eigentümlichen Einrichtung bildeten die häufigen Überschwemmungen der Bramau, welche den Verkehr zwischen den beiden Dörfern Föhrden und Barl und insbesondere den Schulbesuch sehr erschwerten.
[112] Im Winter, bei Eisgang, konnten die jenseitigen Kinder überhaupt nicht kommen, bei offenem Wasser wurden sie per Wagen und später mit einem Boot übergefahren. Durch die Einrichtung zweier Schulhäuser suchte man diese Last möglichst zu verteilen.
In den Anfängen des Schulwesens soll in der Gemeinde jedoch – wie alte Leute wissen wollen – nur ein Schulhaus und zwar in Barl, bestanden haben; aber Streitigkeiten wegen des Überfahrens veranlaßten den Bau eines Schulhauses auch in Föhrden.
Als diese beiden sehr primitiv eingerichteten Schulhäuser den gesteigerten Anforderungen nicht mehr genügten, haben beide Dörfer sich geeinigt, ein gemeinschaftliches Schulhaus herzustellen und hat an den beiderseits gestellten Bauplätzen das Los für den von Hufner Fock gestellten entschieden. Die beiden alten Schulhäuser wurden als Eigenkaten verkauft und der erzielte Erlös zum Bau des neuen verwendet. Die Unannehmlichkeit des Überfahrens suchte man zunächst durch Herstellung eines Dammes für Fußgänger abzuhelfen. Da dieser aber dem Wasser nicht widerstehen konnte, hat man, trotz Abratens älterer Leute, einen vollständigen Fahrdamm durch das Wiesental gemacht und hat sich die Prophezeihung der Alten, daß auch dieser bei der nächsten Flut weggeschwemmt werde, nicht bestätigt.
Das neue Schulhaus ist für ca. 5.000 Rth. Courant (6.000 M) hergestellt; aber nur sehr mittelmäßig hergestellt, so daß während seines kaum 30-jährigen Bestehens schon manche Reparatur hat ausgeführt werden müssen. Im Jahre 1882 hat das Haus ein vollständig neues Dach erhalten. Im Jahre 1885 erhielt der Torfstall ein solches. Auch wurde in demselben Jahr der Eingang für die Kinder verordnungsmäßig hergestellt.
Bemerkung: Das Schulhaus in Föhrden erwarb der Schuster Stühmer und ist zur Zeit das Wirtschaftsgebäude des Kätners Plambeck.
Das Schulhaus in Barl kaufte Johann Mohr, ging später an H. Zornig über und wurde 1936 von H. Reimers erworben und abgebrochen. Mohr 1940
[113] Nach den Schulmatrikeln aus dem Jahre 1875 stehen dem Lehrer an Ländereien zur Verfügung:
1) der Schulgarten in Größe von 840 qm,
2) Schuldienstland in Größe von ca. 8,5 ha in drei ziemlich gleich großen Plätzen; zwei derselben liegen nördlich in ca. 0,4 km, der dritte südlich und ca. 0,5 km vom Hause entfernt. Letzterer dient auch zur Heugewinnung.
Das Schuldienstland wird vom Lehrer selbst benutzt und von der Schulgemeinde frei bearbeitet. Der Nutzungswert ist im Jahre 1864 unter Berücksichtigung der freien Bearbeitung abgeschätzt zu 184 Rth. 6 Sgr.
Diensteinkünfte der Lehrerstelle:
1) Dienstwohnung, deren Wert auf ortsüblichen
Mietpreisen zu veranschlagen ist auf 16 Rth. 40 Sgr.
2) Gartennutzung, zu veranschlagen auf 10 Rth.
3) Feurung von 32.000 Soden Starktorf und
9 Fuder Plaggentorf wovon 22.000 Soden und
6 Fuder im Wert von 25 Rth.
für den Hausbedarf des Lehrers und 10.000
Soden und 3 Fuder für die Heizung des Schul-
zimmers bestimmt sind.
4) Ertrag des Dienstlandes 184 Rth. 6 Sgr.
5) Lieferung von 4,17 hl (330 kg) Roggen und
2,78 hl (200 kg) Buchweizen, geschätzt zum
Werte von 22 Rth. 12 Sgr.
6) bares Gehalt des Lehrers 113 Rth. 12 Sgr.
Summe 4 – 6 320 Rth.
============
Das Heizen und Reinigen der Schulstube, letzteres unter Zuhilfenahme der größeren Schulkinder, hat der Lehrer bis auf weiteres übernommen. Das Reinigungsmaterial ist von der Gemeinde frei anzuliefern.
Laut Vf. [Verfügung] der königlichen Regierung vom 30. Juli 1888 wird das pensionsfähige Diensteinkommen der Lehrerstelle von Föhrden Barl auf 1.186,25 M festgesetzt.
Wie aus dem Protokoll vom 17. September 1889 ersichtlich ist, zahlt der Staat einen Jahresbeitrag zum Lehrergehalt in Höhe von 500 M z. Lehrergehalt .
[114] Diensteinkommen nach dem Gesetz vom 3. März 1897:
Grundgehalt 1.125,00 M
– darauf sind anzurechnen:
Wert für Feurung 75,00 M
Wert des Dienstlandes 552,60 M
Wert der Naturallieferung 67,25 M
bare Bezüge 430,20 M
Dienstwohnung und Garten 150,00 M
das pensionsfähige Einkommen: 1.275,00 M
der Alterszulagesatz 120,00 M
Lehrer unter vier Dienstjahren erhalten keine Feurung und 910,00 M in bar.
Am 1. Oktober 1902 wurde Lehrer Sachau, der seit dem Jahre 1865 den hiesigen Schuldienst verwaltet hat, pensioniert und verzog nach Hamburg-Eimsbüttel. Zu seinem Nachfolger wurde der Schulamtskandidat M. Hamann von der königlichen Regierung bestimmt, der die Schulstelle bis zum Dienstantritt des von der Schulgemeinde gewählten Lehrers Pottharst kommissarisch verwaltete.
Am 2. April 1903 fand die Einsetzung des Lehrers Pottharst durch den Ortsschulinspektor Pastor Hümpel statt. Lehrer Pottharst war in der Gemeinde recht beliebt und versuchte zwischen Schule und Elternhaus ein gutes Verhältnis herbeizuführen. Er machte mit Eltern und Kindern Ausflüge nach Hamburg, führte für die kleinen Schüler das „Vogelschießen“ ein und veranstaltete in jedem Jahre eine Weihnachtsfeier. Pottharst war der Gründer des Militärvereins von Wrist und Umgebung und war bis zu seinem Tode sein Vorsitzender.
Am 28. April 1905 starb infolge einer Magenblutung und kurzer Krankheit der Lehrer der hiesigen Schule, Eduard Pottharst, nach ungefähr zweijähriger Amtstätigkeit. Allzufrüh nahm auf Gottes unerforschlichen Ratschluß der Tod der tiefbetrübten Witwe den geliebten Gatten, den Vater, Ernährer und Versorger ihrer drei kleinen Kinder im Alter von 5, 4 und 2 Jahren, den [115] hochbetagten Eltern, welche einige Tage vor Beginn der Krankheit ihres Sohnes zum Besuche hierselbst eingetroffen waren, den geliebten Sohn. Die allseitige herzliche Anteilnahme der Gemeinde Föhrden Barl bei der Beerdigung des Verstorbenen legten Zeugnis ab, daß derselbe – trotz seiner kurzen Wirksamkeit in dieser Schule – es verstanden hatte, durch seine Tätigkeit sich das Vertrauen der Eltern der ihm anvertrauten Kinder zu erwerben. Zahlreich beteiligten sich auch an der Beerdigung der Wrister Männer-Gesangverein, dem der Verstorbene angehörte, sowie der erst vor kurzer Zeit von ihm mit ins Leben gerufene Wrister Kriegerverein, dessen Vorsitzender er war, und der den Verlust eines lieben hochgeschätzten Kameraden tief beklagte, usw.
Friede seiner Asche! gez. W. Benthien, Lehrer.
In der Zeit vom Tode des Herrn Pottharst bis zum 1. Oktober 1905 wurde die Schule vertretungsweise von Herrn Benthien, Hitzhusen, verwaltet.
Am 5. Oktober 1905 wurde der Schulamtskandidat Bahr mit der kommissarischen Verwaltung der hiesigen Schule betraut. Er besuchte das Seminar in Uetersen. Zum 1. Oktober 1907 übernahm Bahr eine Lehrstelle in Dithmarschen.
Am 18. Oktober 1907 wurde Lehrer Mohr durch den Ortsschulinspektor Hümpel in sein Amt eingeführt. Er entstammt einer alten Bauernfamilie der Nachbargemeinde Weddelbrook und besuchte das Seminar in Hadersleben.
Schon im Jahre 1908 regte Pastor Hümpel den Neubau eines neuzeitlichen Schulhauses an, doch konnte er sich nicht durchsetzen. Die damalige Schulstube war 5 m lang, 6 m breit und 2,75 m hoch. In diesem Stübchen mußten 45 Kinder unterrichtet werden. Das Schulkollegium schloß sich der Ansicht des damaligen Gemeindevorstehers Markus Studt an. Neue Aborte wurden errichtet und das baufällige Schulhaus gründlich überholt.
Das Gehalt des einstweilig eingestellten Lehrers wurde auf Veranlassung des Ortsschulinspektors Pastor Hümpel im Jahre 1909 auf 1.200 M festgesetzt. [116] Nachdem die Behörde mehrfach auf die Unzulänglichkeit der Schulstube und der Dienstwohnung im alten Schulhause hingewiesen hatte, wurde im Jahre 1910 der Neubau eines neuen Schulhauses durch das Schulkollegium beschlossen, und diesem Beschlusse wurde durch die Gemeindeversammlung einstimmig zugestimmt. Von den drei zur Verfügung gestellten Bauplätzen: 1) Johannes Studts Hauskoppel, 2) Markus Studts Hauskoppel und 3) Wilhelm Runges Garten – entschied sich die Mehrzahl der 33 stimmberechtigten Gemeindemitglieder für den Bauplatz auf M. Studts Hauskoppel, groß 2.530 qm, der alsdann für 2.500 RM gekauft wurde.
Nach einer Zeichnung und unter Aufsicht des Technikers Theege aus Segeberg wurde der Neubau im Laufe des Jahres 1911 durch den Zimmermeister Bartels und den Maurermeister Lindemann, beide wohnhaft in Wrist, aufgeführt. Die Arbeiten gingen flott vonstatten, so daß das Gebäude bereits am 13. [evtl. 18. – nicht lesbar] Oktober von dem am 12. Oktober neu erwählten Lehrer Mohr bezogen werden konnte. Nichts hatte die Gemeinde an der neuzeitlichen Ausstattung des Schulzimmers gespart.
Die Gesamtkosten des Schulhausneubaus beliefen sich inklusive Bauplatz, Einfriedigung und Schulzimmerausstattung auf 25.200 M. Das alte Schulhaus war unterdessen für 3.200 M an den Jagdaufseher Strohbeen verkauft worden, so daß nach Zahlung eines staatlichen Bauzuschusses von 8.000 M von der Gemeinde noch rund 11.000 M aufzubringen waren.
Die Einweihung des neuen Schulhauses fand am 14. Oktober 1911 statt. Sie gestaltete sich zu einer schönen Schulfeier, an der sämtliche Schulkinder mit dem Lehrer, Pastor Hümpel als Ortsschulinspek-tor und das Schulkollegium teilnahmen und die allen Anwesenden in ewigem Andenken bleiben wird.
Nachdem im alten Schulzimmer von diesem für immer Abschied genommen war, bewegte sich der Festzug nach dem neuen Schulhause, vor dem mit kurzen, beherzigenden Worten vom Baumeister der Schlüssel übergeben wurde. Die Kinder sangen während dieses Aktes: „Danket dem Herrn -„.
[117] Im geschmückten Schulzimmer hielt Pastor Hümpel eine Ansprache, in der er den Neubau als ein Geschenk Gottes, ausgeführt durch die Gemeinde, pries. Daraufhin unterhielten sich Lehrer und Schüler über den Spruch: „Wo der Herr nicht das Haus bauet etc.“.
Schulaufsicht
Bis zum Jahre 1920 wurde die Schulaufsicht nebenamtlich durch Geistliche der ev.luth. Kirche ausgeübt, so daß es selbstverständlich war, daß dem konfessionellen Religionsunterricht der breiteste Raum im Unterricht eingeräumt werden mußte. Die Kreisschulinspektoren seit dem Jahre 1907 waren: Pastor Jansen aus Henstedt bei Kaltenkirchen (bis 1912), Pastor Stocks aus Kaltenkirchen – bis 1920 -. Seit dieser Zeit besteht die staatliche Schulpflicht, die durch einen Kreisschulrat, einen Schulmann, durchgeführt wird. Auf Kreisschulrat Stendal folgte im Jahre 1925 Kisbye und nach dessen Ableben im Jahre 1930 der Kreisschulrat Linderum.
Bis zum Jahre 1933 war der Ortsgeistliche in Bramstedt gleichzeitig Ortsschulinspektor sämtlicher Schulen seines Kirchspiels. Er war berechtigt, Revisionen vorzunehmen, Stundenpläne, Pausenerteilungen und Lehrpläne mußten ihm zur Genehmigung vorgelegt werden. Alljährlich hielt er in sämtlichen Schulen seines Bezirkes eine sogenannte Schulprüfung ab, die sich großer Beliebtheit erfreute. Manchmal war die kleine Schulstube kaum groß genug, um den zahlreichen Besuch aufzunehmen. Nach beendeter Schulprüfung fand alsdann eine Schulkollegiumssitzung statt, in der der Geistliche den Vorsitz führte. Nach der Machtübernahme im Jahre 1933 ist es dem Ortsgeistlichen einzig noch gestattet, den ev.luth. Religionsunterricht in den Schulen zu überwachen.
Am 1. April 1939 lehnte Lehrer Mohr es ab, weiterhin den jüdisch-christlichen Religionsunterricht zu erteilen, trat aus der ev.luth. Kirchengemeinschaft aus und erteilt statt des Religionsunterrichtes „nationalsozialistische Erziehung“.
[118] Spiel und Sport (W. Mohr, 1941)
Im vorigen Jahrhundert wurde dem Spiel und Sport, also der körperlichen Ertüchtigung der Jugend, keinerlei Unterstützung beigelegt. Bis zum Jahre 1892 stand ein Spiel- und Turnplatz der Schuljugend nicht zur Verfügung. Zum Spielen in den Pausen benutzten die Schüler unserer Schule mit Vorliebe den Quarnstedter Weg sowie die zum Teil noch mit Heidekraut bewachsene neben dem Schulhause liegende Koppel des Vollhufners Reimers. Nach der alten Schulchronik aus dem Jahre 1886 wurde im Jahre 1892 ein Spiel- und Turnplatz ausgelegt und Turngerüste – Reck und Barren – darauf errichtet. Turnunterricht wurde aber trotzdem kaum erteilt, denn im Sommer wurde die Mehrzahl der größeren Kinder vom Unterricht dispensiert und der alte Lehrer Sachau wird kaum in der Lage gewesen sein, einen ordnungsmäßigen Turnunterricht zu erteilen. Auch wird er wegen seines Alters dem Sport wenig Interesse entgegengebracht haben. Im Jahre 1897 machte eine Verfügung der Regierung darauf aufmerksam, daß die Turnstunden voll gegeben und auch gehörig ausgenutzt werden.
Nachdem die Schulstelle seit 1.4.1903 mit einer jungen Lehrkraft besetzt worden war, wurde der Turnunterricht planmäßig erteilt. Nach der Machtübernahme wird der körperlichen Ertüchtigung der Jugend der breiteste Raum im Stundenplan zugebilligt – fünf Stunden -.
Seit dem Jahre 1920 soll – laut Regierungsverfügung – allmonatlich eine Schulwanderung unternommen werden. Daran haben sich alle Schulkinder vom 10. Lebensjahre ab zu beteiligen. Unsere erste Wanderung führte über Wrist zum Bokeler Mühlenteich und von dort zurück über Hasselbusch – Mönkloh. Ein Nachmittag der Woche wurde als „Spielnachmittag“ bestimmt. Es fanden während des Sommers gelegentlich der Wandertage oft Freundschaftsspiele im Schlagball mit den Nachbarschulen Hagen, Wrist und Weddelbrook statt.
Um den Wetteifer der Schuljugend im Sport zu fördern, wurden Bezirksspielfeste eingeführt, und die Entscheidungskämpfe wurden alsdann auf [119] dem Kreisspielfeste ausgetragen. Im Jahre 1921 stiftete die Bramstedter Lehrerkonferenz zwei Fahnen, die den Siegern unter den ein- und zweiklassigen, sowie den drei- und mehrklassigen Schulen zufielen. Auf dem Spielfeste vom 3. Juli 1921 zu Bad Bramstedt auf dem Sportfeld im Kaiser-Wilhelm-Wald, auf dem gleichzeitig die Wettkämpfe zum Kreisspielfeste in Bad Segeberg ausgetragen wurden, gingen unsere Schüler als Sieger unter den ein- und zweiklassigen Schulen hervor. Nachdem die Föhrdener Mannschaft beim Schlagball die Wiemersdorfer- und Weddelbrooker Schule erledigt hatte, siegte sie im Endspiel gegen die Hitzhusener Volksschule mit 71:6. Auch im Staffellauf ging Föhrden als Sieger hervor, und zwar wurden 800 m in 2 Min. 10 Sek. zurückgelegt. Im Dreikampf der 13- und 14-jährigen Knaben erzielte Max Fölster mit 320 Punkten den ersten Preis – Weitsprung 4,11 m, Schlagballweitwurf 66,75 m, 100-m-Lauf 14 Sekunden -. Willi Schnack erhielt den 11. Preis. Von den 11- und 12-jährigen Knaben errang Fritz Fölster den 1. und Hans Kröger den 3. Preis. Mit zwei großen und vier kleinen Kränzen geschmückt, kehrten wir als Sieger des Turniers mit der Fahne stolz in unser Heimatdorf zurück. Auf dem Kreisspielfest in Segeberg errangen Max und Fritz Fölster, sowie Hans Kröger – im Dreikampf – Preise.
Auch in den Wettkämpfen der nächsten Jahre stand unsere Schule noch oft den Schulen mit einer weit höheren Kinderzahl nicht nach, und mancher nach hartem Kampfe errungene Ehrenkranz wurde heimgebracht. Zum Beispiel nahmen am Spielfest, das am 23. Juni 1935 auf dem Sportplatze des Schützenvereins „Roland“ in Bad Bramstedt ausgetragen wurde, 19 Kinder unserer Volksschule teil, von denen 15 über 180 Punkte erzielten und damit eine Siegesnadel errangen: Ernst Fölster – 15 Jahre – 235 Punkte, Hans Karstens – 14 Jahre – 246 Punkte, Kurt Plambeck – 12 Jahre – 208 Punkte, Ernst Thies – 10 Jahre – 220 Punkte, Anne Fölster – 14 Jahre – 286 Punkte, Grete Seider – 14 Jahre – 243 Punkte, Irmgard Plötzky – 11 Jahre – 217 Punkte. Im Schlagball siegte eine aus Knaben und Mädchen zusammengestellte Riege zunächst über die Volksschule Hagen (28:16) und dann über Armstedt (13:12). Wegen Zeitmangel konnte [120] das Entscheidungsspiel nicht ausgetragen werden. Glänzende Leistungen, die allgemeine Bewunderung hervorriefen, wurden bei den Staffelläufen gezeigt.
Im Laufe der Jahre wurden nicht selten größere Radtouren, die zuweilen zu Unannehmlichkeiten mit den Eltern führten, unternommen. Diese führten uns nach Plön, Eutin, Bad Segeberg, Lägerdorf, Itzehoe, Barmstedt usw. So lernten die Kinder unsere schöne Heimat kennen und lieben.
Da auf dem Spielplatz bei der Schule die Spiele nicht ordnungsgemäß durchgeführt werden können, stellte die Gemeinde im Jahre 1920 auf der Schulkoppel ein Sportfeld zur Verfügung, daß anfangs stark in Anspruch genommen wurde. Seit dem Jahre 1937 konnten die Spiele wegen der kleinen Kinderzahl nicht mehr abgehalten werden. Der Sportplatz wurde daher zwecks Bewirtschaftung wieder verpachtet.
Im Jahre 1924 gründete der als eifriger Turner bekannte Max Fölster den Sportverein Föhrden Barl/Hagen, der in den ersten Jahren seines Bestehens erfolgreich wirkte. Fölster nahm sich auch der Kinder an und stellte eine Kinderriege auf, die rund 25 Mitglieder zählte. Zur Beschaffung der Turngeräte stellte die Spar- und Darlehnskasse Gelder zur Verfügung. Die Turnabende wurden abwechselnd in Föhrden und Hagen abgehalten. In jedem Jahre fand ein Turnerball statt, auf dem die Jugend ihre Leistungen zeigte. Dieses Fest erfreute recht bald jung und alt. Nachdem Max Fölster im Jahre 1927 bei der Polizei eintrat, übernahm Körner in Hagen die Leitung. Die Zahl der Schüler ging von Jahr zu Jahr zurück – H.J. – wegen Mangel an Beteiligung löste sich der Verein schließlich im Jahre 1935 nach reichlich 10-jährigem Bestehen auf.
Allgemein beliebt war in früheren Jahren der Kegelsport. Beide Gastwirtschaften unseres Dorfes verfügten über eine Kegelbahn. Der Gastwirt Blöcker riß eine offene Bahn im Jahre 1878 ab. Mehrfach schlossen [121] sich Kegelfreunde zu einem Club zusammen, doch nach kurzer Lebensdauer löste er sich recht bald wieder auf.
Nach der Machtübernahme widmet sich die Jugend eifrig dem Reitsport. Viele Bauernsöhne sind Mitglieder des S.A.-Reitersturmes in Kellinghusen. Otto Schnack, der leider im Jahre 1940 verunglückte, hat sich als Reitlehrer der Jugend unserer Gemeinde Verdienste erworben. Vereinzelt besuchen Bauernsöhne die Reit- und Fahrschule in Elmshorn.
[Ende Text Gegenwartschronik; es folgt die Vergangenheitschronik]
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[137] Vergangenheitschronik:
V O R W O R T 1939. v. Lehrer Wilhelm Mohr, Föhrden Barl.
Seit dem 1. Oktober 1907 bin ich nunmehr Lehrer in der mir lieb gewordenen Gemeinde Föhrden Barl. Als Jäger durchstreifte ich die heimatlichen Felder und Wälder und so ist mir kein schöner Platz, keine heilige Stätte unbekannt geblieben. Die Kinder meiner ersten Schüler sind bereits wieder durch mich aus der Schule entlassen worden. Jeder Weg, jedes Stückchen Erde der näheren Heimat ist mir, einem Gebürtigen der Nachbargemeinde Weddelbrook, hervorgegangen aus einem alten Bauerngeschlecht, bekannt. Es ist daher wohl verständlich, daß ich der Heimatgeschichte seit jeher ganz besonderes Interesse entgegengebracht habe. Ich habe mir daher die Lebensaufgabe gestellt, einen Baustein zur Heimatgeschichte der Gemeinde Föhrden Barl zu legen und möchte meine Nachfolger bitten, diese Arbeit mit allem Fleiß fortzusetzen.
Wie beschämend ist es, wenn ein Erbhofbauer über seine eigene Familie, die seit Jahrzehnten oder sogar Jahrhunderten auf dem Hofe lebte, kaum unterrichtet ist.
Daß unser Führer Adolf Hitler dem deutschen Volke durch Schaffung der Erbhöfe, durch Förderung des Siedlungswesens und den Bau von gesunden Arbeiterwohnungen wieder eine Heimat gegeben hat, ferner der Heimatgeschichte einen ihr gebührenden Platz im Schulunterricht eingeräumt hat, ist eine Großtat, deren Beurteilung ich der späteren Geschichte überlassen möchte.
In den meisten Bauernfamilien unserer Gemeinde kennt das Kind seine Eltern und die Großeltern, die vielleicht etwas über die [138] Urgroßeltern erzählt haben. So trostlos sieht es in der Familiengeschichte alter Bauerngeschlechter aus; aber die Geschichte des Dorfes ist noch erheblich kümmerlicher. Keiner, nicht einmal der „Schulmeister“ und „Burvogt“ haben dafür Interesse gezeigt.
Alte wertvolle Urkunden und Aufzeichnungen wurden, weil anscheinend wertlos, dem Ofen überliefert, oder fanden als Butterbrotspapier Verwendung. Nicht einmal die allerwichtigsten Gemeindebeschlüsse, aus denen die Aufteilung der Ländereien (1781), Regelung der Wasserverhältnisse und dergleichen hervorgeht, sind der Nachwelt erhalten geblieben.
Verklungen und vergessen, das ist der Fluch der vergangenen Zeit!
Im Jahre 1886 wurden die Lehrer durch ihre Behörde aufgefordert, eine Schulchronik zu schreiben, die meiner Ansicht nach die Geschichte des Dorfes hätte mit aufnehmen sollen. Dem damaligen Lehrer, der da schreibt: „Aus dem vorigen Jahrhundert habe ich nichts in Erfahrung bringen können“, bleibt der Vorwurf nicht erspart, etwas nie Nachzuholendes versäumt zu haben.
Viel Zeit und viel Mühe habe ich aufbringen müssen, um das Versäumte nachzuholen. So manches habe ich während meiner Amtstätigkeit alten Leuten ablauschen können. Diese sind meistens bei Unbekannten anfangs sehr zurückhaltend, nachdem man jedoch mit ihnen vertraut geworden ist, erzählen sie so gern aus der guten alten Zeit.
Wenn ich die nun folgenden Vermutungen und Wahrscheinlichkeiten als Tatsachen, als Geschichte, darstelle, so hat dieses seinen Grund darin, daß der Nachwelt an Hand von noch erhaltenen Namen (Fierth, Hünengräber, Schloßberg usw.) sowie auf Grund gemachter Funde, (Steinbeil, Bronzeschwert und Urnen und dergleichen), die Heimat so zu schildern, wie sie in früheren Zeiten wahrscheinlich ausgesehen hat.
[139] Wie unsere Heimat entstanden ist.
Unsere Heimat verdankt ihre Form und ihr Entstehen der Eiszeit. In unserer Gemarkung finden wir nicht selten mächtige Findlinge, die meistens in Lehm- oder Mergellager eingebettet sind, große Steinfelder sowie Kies- und Sandlager. Diese sind, wenn wir von den großen Kalk- und den darunterliegenden Salzlagern absehen, die ersten Zeugen aus grauer Vorzeit. Wie mögen nun diese Lagerungen entstanden sein?
Bevor Nord- und Ostsee durch Senkung der Erdoberfläche entstanden, wurde unsere Heimat von der Eiszeit heimgesucht. Damals traten mächtige Gletscher und Eisfelder von den Gebirgen Skandinaviens ihre Reise nach dem Süden an und bedeckten unsere Heimat. Alles erstarrte unter den Eis- und Schneemassen. Wenn man bedenkt, daß ein Gletscher sich im Laufe eines Jahres nur wenige Meter oder Dezimeter vorwärts bewegte, so müssen Jahrtausende vergangen sein, bis die Eismassen endlich unsere Heimat erreichten.
Mancher Felsblock, losgerissen im Gebirge, wurde auf dem weiten Weg zermalmt und in Kies, Sand und kleine Steine zermahlen.
Einer dieser Gletscher, der viele Quadratmeilen bedeckte, ließ sich auch in unserer Gegend nieder. Das Gletscherwasser bahnte sich nach und nach eine tiefe Rinne durch die Landschaft. Der Gletscherstrom, der die jetzige „Weddelbrooker Lieth“ und die „Quarnstedter Anhöhe“ als Breite hatte, floß dann weiter in den Hauptstrom, der dem Ozean sein Wasser zuführte.
Je mehr die Eisfelder auftauten, desto geringer wurden die Wassermassen, und das Flußbett des Urstromes trat immer weiter zurück, der Strom teilte sich in mehrere Arme, die noch heute zu erkennen sind. Die damaligen Inseln sind unsere jetzigen „Kämpe“, das sind sandige Äcker. Schließlich erreichte der Urstrom nur noch die Breite des heutigen Wiesentales und endlich, nachdem der Gletscher vollständig geschmolzen war, entstand die Bramau, die sich in unendlich vielen Krümmungen durch das Wiesental schlängelte. [140] Während der Gletscherzeit hatten sich an vielen Stellen Niederungen und Mulden gebildet, in denen sich das Wasser sammelte. So entstanden kleinere und größere Seen, die nunmehr die Au speisten. Aus ihnen bildeten sich im Laufe von Jahrhunderten unsere Moore, die uns mit Feurung versorgen und den Wasserstand der Au regulieren.
Um diese Zeit, also nach dem Ende der Eiszeit, mag unsere Heimat besiedelt worden sein.
Die Hünengräber aus der jüngeren Steinzeit.
Funde: Steinbeile, Flintmesser, Urnen und dergleichen. Fundort: Firth.
Es mag um das Jahr 4.000 vor unserer Zeitrechnung, also vor rund 6.000 Jahren gewesen sein! Schon damals war unsere Heimat von Bauern bewohnt. Diese standen, wie Funde aus der damaligen Zeit bezeugen, auf einer verhältnismäßig hohen Kulturstufe, aus Flintsteinen verfertigten sie ihre Waffen und Hausgeräte. Wie sorgfältig sind diese behauen und geschliffen! Der sogenannte „Flintmeister“ muß schon damals ein wirklicher Künstler gewesen sein – standen ihm doch einzig Steinhandwerkszeug, Sand und Wasser (zum Schleifen) zur Verfügung. Manch gute Steinbeile, Flintmesser usw. wurden in unserer Gemarkung in der Nähe der Hünengräber gefunden. Wie andere Funde bezeugen, zeigten unsere Vorfahren eine ganz besondere Begabung in der Anfertigung von Tongefäßen, mit denen sie wahrscheinlich auch einen lebhaften Tauschhandel betrieben haben.
Zeugen aus der damaligen Zeit sind ebenfalls die Hünengräber. Nach dem „Hausbriefe der Familie Reimers“ aus dem Jahre 1754 befanden sich einst auf dem Firth drei gut erhaltene altgermanische Grabstätten. Das mittlere, kleinere Hünengrab ist im Laufe der Jahre vollständig verschwunden. Aber auch das gen Osten gelegene Grab ist bereits zur Hälfte abgefahren. Auf Veranlassung des Lehrers Mohr schritt im Jahre 1933 die Behörde energisch ein, verbot die weitere Abfuhr von Sand und stellte die beiden noch verbliebenen [141] Grabstätten unter Naturschutz. Die erhalten gebliebenen Hünengrä-ber sind leider in der Mehrzahl bereits geschändet, das heißt, von unberufener Hand geöffnet, und zwar erfolgte dies durch sogenannte Schatzgräber, die in ihnen wertvolle Schätze vermuteten (1850 – 1890).
Die Hünengräber auf dem Firth sind Einzelgräber, während man in anderen Gegenden unserer Heimat auch Familiengräber findet.
Wie mögen nun diese Grabstätten entstanden sein?
In der jüngeren Steinzeit, etwa 3.000 – 4.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung, pflegten unsere Vorfahren ihre Toten zu verbrennen. In anderen Gegenden legte man sie in einen ausgehöhlten Baumstamm oder in ein Schiff (Fischer), das der Verstorbene in Ausübung seines Berufes während seines Lebens gesteuert hatte. Nach Einäscherung des Toten wurde die Asche in eine ca. 45 cm große kunstvolle Urne gefüllt und in eine quadratförmige Steinkammer gesetzt. Die Urne und auch die Grabkammer wurden darauf mit einem glatten Stein verschlossen. Recht oft wurden bei Frauen Schmuckgegenstände, die den Verstorbenen lieb und teuer gewesen waren, bei Kriegern Lieblingswaffen, mit ins Grab gelegt. Man findet daher in den Grabkammern unserer Hünengräber nicht selten Steinbeile, Flintmesser, Gold- und Bronzeringe und dergleichen. Bewährten Führern und Kriegern (Hunen), die sich um ihre Sippe oder Stamm verdient gemacht hatten, errichtete man ein Denkmal, ein „Hünengrab“. In einem Kreis von etwa 30 m Durchmesser wurde, wie noch heute ersichtlich ist, Soden auf Soden gelegt, bis in mehrwöchiger Arbeit ein Hügel von etwa 20 m Höhe entstanden war. Viele Jahre lang fand an dieser Grabstätte eine Totenehrung statt. Immer und immer wieder erzählte man sich von den Taten des Verstorbenen und an jeden erging die Aufforderung, diesem nachzueifern, ihn als Vorbild zu nehmen.
So vergingen Jahrzehnte und Jahrhunderte, bis schließlich der Name des Toten vergessen wurde. Der Grabhügel, den mächtige Findlinge umrandeten, bewuchs mit Heidekraut.
[142] Abschrift: D I E H Ü N E N G R Ä B E R. (v. W. Mohr) 1932
Vom Firth, der heiligen Stätte, zwei Gräber winken uns zu,
Dort fanden vor 6.000 Jahren zwei Führer die ewige Ruh‘!
Ihre Namen, die sind vergessen, die Geschichte bericht uns nicht mehr
Von ihren gewaltigen Taten, von ihrer Tugend und Ehr‘! –
Der Hun‘ versammelt die Recken auf dem Firth bei Vollmond manch Jahr,
Zu beraten das Wohl der Sippe, zu vermeiden Not, Krieg und Gefahr.
Er wies die Feinde aus dem Lande, bemeisterte Hungersnot,
Er zeigte sich stets als Führer, wenn winkte Gefahr und Tod —–.
Ein Bot‘ eilt von Hütte zu Hütte —„Was bringst du Neues uns?
Ist’s Gutes, ist’s böse Nachricht? Was gibt’s? – Tu schnell uns kund!“ —
„Heut‘ Nacht starb unser Führer, ein Vater und ein Held! —
Er hat den Wunsch geäußert, zu ruhen auf heiligem Feld —!
Drum wollen wir versammeln uns alle, arm und reich,
Wir wollen ihm bereiten ein Grab, dem Helden gleich!“ —-
Sie strömten aus den Wäldern in vollem Waffenschmuck –,
Die Frauen und die Kinder in Demut und geduckt! —
Im Baumsarg eingebettet, auf’m Fell, so weich wie Dun,
Mit voller Waffenrüstung, so ruht der Sippe Hun. —
Und Klagelieder tönen so dumpf und feierlich,
Darin besingt man den Toten als Held beim Morgenlicht. —
Am nächsten Tag die Krieger, die hatten große Qual -,
Sie richten auf dem Toten ein mächtiges Grabdenkmal —— .
In jedem Jahr versammelt der Stamm sich auf dem „Firth“,
Zu ehren seinen Toten als Bauer, Führer, Hirt! ——
Es kamen andre Zeiten, der Stamm zog in die Fern —!
Des Führers Nam‘ entschwunden —- Und hätten ihn so gern —-!
Mit Heide ward bewachsen des großen Führers Grab —-,
Den lieben Lerchen und Bienen lauscht früherer Zeiten man ab —!
Wir wollen die Toten ehren, ihre Gräber schützen fürwahr;
Denn diese berichten, erzählen uns Märchen — immerdar!
======================================
[143] Ein Hünengrab aus der Bronzezeit.
Daß auch in späteren Jahrhunderten unsere Heimat besiedelt war, beweist ein Hünengrab aus der Bronzezeit. Auch diese altgermanische Grabstätte, die auf Johannes Karstens Acker am Wege nach dem Herrenholz lag und kaum noch als Hünengrab zu erkennen war, wurde ums Jahr 1925 abgefahren. Den Sand benutzte man zur Ausbettung schlechter Wegstrecken. Die Grabkammer des Hünengrabes war zerstört oder eingefallen, eine Urne ist jedenfalls nicht gefunden – man hat bei der Arbeit auch nicht darauf geachtet -, die Steine der Grabkammer lagen zerwühlt durcheinander. Schließlich machte man doch noch einen wertvollen Fund, nämlich ein sehr gut erhaltenes Bronzeschwert, wie es – nach Urteil von Professor Rothmann, in Kiel, – noch selten in unserer Heimat gefunden ist. Das ..(?)griff fiel leider bei der ersten Berührung und Säuberung ab. Doch die Klinge zeigte eine Schärfe, wie die vom besten Stahl. Auch die sogenannte Blutrinne, wie überhaupt das ganze Schwert zeigt eine Kunstfertigkeit, als wenn es von dem modernsten Waffenschmied der Neuzeit angefertigt wäre. Wieder einmal ist damit der Beweis geliefert, daß unsere Vorfahren keine Barbaren waren, sondern Menschen von hoher Kultur und Kunst. In der Schmiedekunst, Weberei und Töpferei ist in der damaligen Zeit ohne Frage schon etwas hervorragendes geleistet.
Bemerkung: Das gefundene Bronzeschwert wurde dem Landesmuseum in Kiel zur Verfügung gestellt.
Flurnamen und Benennungen, die auf altgermanische Stätten schließen lassen.
Einige Flurnamen unserer Gemarkung lassen, wie die Hünengräber und Funde aus der Steinzeit, auf altgermanische Feierstätten schließen.
[144] Die Äcker bei den Hünengräbern werden bis auf den heutigen Tag „Firth“ genannt. Das Wort „Firth“ bedeutet „die Stätte der Feiern“. Hier wurden vor Jahrhunderten die Feiern der Hundertschaften stattgefunden haben, hier wurde über Krieg und Frieden entschieden, hier wurden die Volksversammlungen abgehalten, die Toten verbrannt, die Feiern und Wettkämpfe der Jugend abgehalten usw. Der „Firth“ mag auch gleichzeitig die Gerichtsstätte gewesen sein.
* Die umliegenden Äcker „Osterfortkamp“, möglicherweise benannt nach der altgermanischen Frühlingsgöttin „Ostara“, mögen dem Priester als Ackerland zur Verfügung gestanden haben. Das auf diesen Äckern angebaute Korn diente sodann als sogenannte Brotkornreserve in Kriegszeiten. Wenn diese meine Vermutungen zutreffen, dann könnte man das „Oster“, den Wald südlich der Bramau, als Wald der altgermanischen „Ostara“ ansprechen, als Waldgebiet, in dem das Wild geschont wurde (Wildreserven), und nur in Kriegszeiten erlegt werden durfte.
* Bem. Kaum zutreffend! Es heißt nicht Osterfortkamp sondern „Osterfurtkamp“. Bis zur Wiesenregulierung 1890 führte hier eine Fuhrt von Oster zum Kamp. Mohr 1.1.1943.
Weiter östlich an der jetzigen Chaussee in Richtung Hitzhusen lag einst ein großes Waldgebiet, „Hinkenholz“, besser „Hunenholz“ genannt. Dieser Wald lieferte einst den zerstreut liegenden Siedlungen und Bauerngehöften die Feurung und das Bauholz. Schließlich ist dieser Wald in den Besitz des Hunen übergegangen, dessen Besitz somit auf dem „Langen Hof“ am Rande des Hunenwaldes, hart an der Bramau gelegen, bestanden hat. Bestimmt eine herrliche Lage!
Nordöstlich des Hünengrabes lag einst eine altgermanische Grabstätte, der Urnenfriedhof. Nach der Einäscherung der Toten wurde die Urne an diese heilige Stätte gebracht. Der Urnenfriedhof lag in stiller Einsamkeit und wurde gehegt und gepflegt wie ein Garten. Die Toten sollten im Schlafe nicht gestört werden. (Bemerkung: es ist auch ja merkwürdig, daß diese Ländereien bis 1909 nicht beackert wurden!)
Dann wurden ums Jahr 1.000 unsere Vorfahren gezwungen, zum Christentum überzutreten, eine Religion anzunehmen, die ihnen fremd war. [145] Der Besuch und die Pflege der heiligen Stätten wurde von den Eindringlingen bei Todesstrafe verboten. Die Toten mußten nunmehr in heilige Erde in unmit-telbarer Nähe der Kirche in Bramstedt gebettet werden. Man erzählte vom Teufel, der auf dem Urnen-friedhofe einherginge, um die Toten zu peinigen, von Hexen und Gespenstern, die dort ihr Spiel trieben. So wurde damals gerade durch die „allein seligmachende“ christliche Kirche der Aberglaube gefördert.
So verödete der Urnenfriedhof, geriet in Vergessenheit und bewuchs mit Heidekraut. Auch die Hünengräber wurden durch die christliche Kirche geschändet, indem man die Findlinge, die das Hünengrab einst umrandeten, entfernte und Kirchen und „heilige“ Klöster daraus baute.
In vielen Stücken mußte, um unsere Vorfahren für sich zu gewinnen, die christliche Kirche nachgeben. Man übernahm altgermanische Feste, wie zum Beispiel das Osterfest (das Fest der Göttin Ostara), gab den Wochentagen die Namen der Götter: Donnerstag, Freitag zum Beispiel sind Tage des Gottes Donar und seiner Frau Frigga, stellte Jesus und seine Jünger – wenn es eben nicht anders ging – als Kriegshelden dar, und so gelang es den schlauen und listigen christlichen Priestern, unsere Vorfahren nach und nach – gleich „Schafen“ – gefügig zu machen.
Urnenfund. 1927
Eine gut erhaltene Urne unseres Urnenfriedhofes, der sich scheinbar unter dem Weg auf Hans Studt’s Hagener Kamp fortsetzt, wurde schließlich doch noch geborgen und konnte dem Landesmuseum in Kiel übergeben werden. Der Bauer Hans Studt stieß beim Tannenpflanzen auf seiner Koppel in etwa 40 cm Tiefe auf einen glatten Stein, unter dem sich eine mit Asche und Knochenresten gefüllte Urne befand. Diese wurde alsdann von Lehrer Mohr und den größeren Knaben seiner Schule sorgfältig freigelegt und geborgen.
Mitten in unserem Dorfe liegt ein schöner Hain, der Schulenbrook. Mächtige Eichen und Buchen beschatten einen unnatürlichen Hügel. Es ist [146] durchaus nicht ausgeschlossen, daß dieses kleine Gehölz eine Opferstätte unserer Vorfahren, ein heiliger Hain, aus dem bei Einführung des Christentums die Opfersteine entfernt wurden, gewesen ist.
Hat dort, wo nunmehr Johannes Lohse, Wilhelm Runge’s Nachfolger, wohnt, ein altgermanischer Priester seinen Hain gehabt? Bei Ausschachtungen 1933 stieß der Maurermeister Hermann Blöcker auf einen gewaltigen zugeschütteten Keller. Mehrere Buchendielen, unter denen Pferdeköpfe und ganze Skelette gefunden wurden, lagen übereinander. Daran kann man ersehen, daß an demselben Ort bereits mehrfach Bauten aufgeführt sind. Das Pferd war bekanntlich bei unseren Vorfahren ein heiliges Tier und wurde mit Vorliebe den Göttern geopfert.
Der Schloßberg.
Eben jenseits der Grenze unserer Gemarkung, direkt an der Chaussee, also schon auf Hitzhusener Gebiet liegt der sagenhafte „Schloßberg“. Während der Nacht wollen Fußgänger hier ein Wehgeschrei gehört und die „weiße Schloßfrau“ gesehen haben. Das alles ist selbstverständlich eine Sage.
Nach dieser Sage soll einst auf dem Schloßberg eine starke Burg gestanden haben, die von einem hartherzigen Ritter bewohnt wurde. An diesen mußten vorüberziehende Kaufleute hohe Abgaben zahlen. Die auf der damals schiffbaren Au fahrenden Handelsschiffe wurden nicht selten überfallen und ausgeplündert.
Wenn diese Erzählung den Tatsachen entsprechen würde, müßte man noch heute an dieser Stelle Felsen oder Balkenreste und dergleichen gefunden haben. Das ist aber nicht der Fall.
Ein alter Arbeiter, der den Acker an diesem geschichtlichen Ort gepflügt hat, will vor Jahren auf schwarze Stellen mit Kohleresten, sogenannte Feuerstellen, gestoßen sein und alte Topfscherben [147] gefunden haben. Diese Funde lassen vermuten, daß der Schloßberg etwa 200 – 500 Jahre n. Chr. eine altgermanische Fluchtburg gewesen ist. Diese lag, von Sumpf und Wasser geschützt, inmitten des hohen Waldes wohlgeborgen.
Nahte, was besonders nach der Völkerwanderung sehr oft vorkam, aus dem Osten ein wendischer Volksstamm oder dessen Krieger auf ihren Pferden, so zogen die Frauen, Greise und Kinder mit ihrem Vieh auf schwer zu erkennenden Waldwegen in die Fluchtburg. Diese hatte nur einen Eingang, war durch einen mit Dornenbüschen bewachsenen Erdwall und einen tiefen Graben geschützt. Der Feind wagte es nicht, bis dorthin vorzudringen.
Wenn die Gefahr vorüber war, kehrten die Flüchtlinge zu den Gehöften zurück. Doch meistens hatte der Feind das Haus zerstört, die Ernte vernichtet und die Arbeit begann von neuem.
Wie der Ort „Föhrden Barl“ entstanden ist.
Über die Entstehung unseres Dorfes berichtet keine Geschichte, Sage oder irgend eine Urkunde, sondern einzig der Name selbst. „Föhrden“ bedeutet Fuhrt, das ist eine seichte Stelle in einem fließenden Gewässer, die bequem mit Pferd und Wagen zu durchqueren ist, und „Barl“ hat die Bedeutung von „Bauerndorf“. „Föhrden Barl“ heißt demnach das Bauerndorf an der Fuhrt. Die geschlossene Ortschaft wird meines Erachtens nach Einwanderung des Volksstammes der Holsten (Sachsen), also zu Beginn unserer Zeitrechnung, entstanden sein. Wie nachgewiesen ist, hat sich der Volksstamm der „Holsten“ in unserer engeren Heimat am reinsten erhalten.
Woraus kann man nun schließen, daß unser geschlossenes Dorf um genannte Zeit entstand? – Bei manchen Bauernhäusern standen noch vor nicht [148] allzu langer Zeit mächtige, uralte Eichen, die nach und nach wegen ihres Alters gefällt werden mußten. Der letzte dieser geschichtlichen Zeugen wurde im Jahre 1933 abgeschlagen. Diese Eiche hatte in Mannshöhe noch einen Umfang von 4,20 m. Es liegt doch die Vermutung nahe, daß diese Eiche durch den ersten Siedler, der sich direkt bei der Brücke niederließ, zum Schutze seiner Hütte angepflanzt wurde. Auf Landwirtschaft mag dieser Siedler wenig Wert gelegt haben; denn seine Landstelle war – und blieb – nur eine Viertelhufe und als Folge kaum in der Lage, eine Familie zu ernähren. Der Hauptberuf dieses Siedlers ist aller Wahrscheinlichkeit nach der des Fährmannes gewesen, der die Wanderer nach Bedarf über die Au setzte und dazu Fischfang betrieb. Dieser wird zu damaligen Zeiten recht lohnend gewesen sein; denn die Au hatte damals undenkbar viele Krümmungen und war sehr wasserreich. Es ist anzunehmen, daß schon damals in Föhrden Barl acht Vollhufen bestanden. Eine Vollhufe war zu damaligen Zeiten ein Hof, der von vier Pferden bearbeitet werden konnte (etwa 90 – 100 ha). Grund und Boden blieb Gemeinbesitz, war unveräußerlich und wurde nach der „Dreifelderwirtschaft“ bearbeitet. Wenn man bedenkt, daß weite Flächen mit Heide, Wald und Busch – ( Flurnamen:“Bagholz“, „Rugenbusch“, „Im Busch“, „Hinkenholz“, „Oster“, „Rethorn“ usw.) – bewachsen war und viele Sumpf- und Moorgebiete vorhanden waren, ist anzunehmen, daß die Bauern zu damaligen Zeiten ein kümmerliches Dasein geführt haben.
Weite Gebiete, das „Herrenholz“ waren ferner im Besitze der Herren in Bramstedt oder Segeberg. Die ehedem freien Bauern hatten sich nach und nach „Grafen“ unterstellt, denen die Landesverteidigung und das Gerichtswesen übertragen wurde.
Da eine Vollhufe nur eine Familie ernähren konnte, zogen tatkräftige Jünglinge in die Umgegend und gründeten die ersten Siedlungen.
[149] Neue Siedlungen entstehen.
Junge, tatkräftige Bauernsöhne zogen aus, machten Heide und Moore urbar, entwässerten Sümpfe und rodeten Wälder. Die Ritter der damaligen Zeit gebrauchten gutes Pferdematerial und so wurde auf dem Herrensitz in Bramstedt ein Pferdegestüt gehalten. Auf dem „Herrenholz“ (einer unserer Flurnamen), das an das Breitenburger Moor grenzte, wurden zu damaligen Zeiten viele Pferde des Landesgestüts gegräst. Die Weiden der Hengste lagen wegen der Wolfsplage direkt am Rande des Moores und der Heide. Die näher liegenden, ungefährlicheren Weiden waren für die Stuten und ihre Fohlen bestimmt. Am Rande des Moores entstand damals die Siedlung Wulfsmoor, am Rande der Heide – Hingstheide. Außerdem entstand damals die Einzelsiedlung „Bargholz“ (Menge Holz). An der Krück, das heißt Krümmung, des jetzigen Stapelkampsbaches ließ sich ein in der ganzen Gegend bekannter Viehzüchter nieder, den man „Viehmann“ nannte und die Siedlung hieß „Krücken“. An der Bramau baute der Bauer „Hitz“ sein Haus, daher entstand die geschlossene Siedlung „Hitzhusen“. Die Ortschaft „Hagen“ ist eine Rodesiedlung (Hagen = Wald). Man hatte gelernt, Geräte und Handwerkszeug aus Eisen herzustellen, so daß man nunmehr den schweren Lehmboden bearbeiten und die mächtigen Eichen fällen konnte. (Familiennamen wie Rühmann = Rodemann, Bauer, Schult oder Schulz = Schulze (Gemeindevorsteher), Meier, das ist der Verwalter, Harbeck, Studt, Hingst, Schäfer entstanden.)
Um die Zeit, als unsere Vorfahren Christen wurden, entstand in der Heide die Mönchssiedlung „Mönkloh“ (Mönchs-Heide), die auf dem halben Wege Hamburg – Neumünster lag. Die Mönche betrieben Schaf- und Bienenzucht, förderten den Obstbau und führten den Buchweizen ein. Die Schafswolle wurde in Neumünster verarbeitet.
In die damalige Zeit fällt auch das Entstehen und baldige Aufblühen des Handwerkes. Handwerker, Jäger und Fischer galten [150] als besonders tüchtige Menschen und wurden im Volke geehrt und geachtet. Familiennamen, die dem Handwerk entstammen: Rademann, Rademacher, Schneider, Weber, Kielmann, Poth (Brunnen), Zimmermann. – ; ferner stammen von damals die Namen Fischer, Jäger, Fuchs, Wulf, Rabe, Hase u.a.
Geschichtliches:
Seit dem Jahre 1460 ist unsere Heimat Schleswig-Holstein durch Personalunion mit dem Königreich Dänemark verbunden und daher eng mit dessen Geschichte verknüpft. Unsere Vorfahren werden sich unter dem Schutze dieser Großmacht recht wohl gefühlt haben, und die Landwirtschaft blühte auf.
Der Schrecken des 30-jährigen Krieges ging nicht spurlos an unserer Heimat vorüber. Auch unser Dorf, an einer Hauptverkehrsstraße gelegen, hat sicher unter den Kriegsnöten oft schwer zu leiden gehabt.
Als der Dänenkönig Christian IV gegen die Kaiserlichen in den Kampf zog, lernte er (1628) auf seinem Durchzuge durch Bramstedt die dort im „Holsteinischen Haus“ im Dienst stehende Föhrden Barlner Bauerntochter Wiebke Kruse kennen. Der König nahm nach seiner Niederlage, verfolgt von den Truppen Wallensteins, die einfache Bauerntochter als Erzieherin seiner Kinder mit nach Kopenhagen. Später wurde sie dem König „zur Linken“ getraut. Da Wiebke jedoch nicht ebenbürtig war, siedelte sie nach Bramstedt über und wohnte nunmehr in dem Schlosse, das – von einem Burggraben umgeben -, hinter der Hudau lag. Der Herrensitz ging in den Besitz der Wiebke Kruse über. Sie soll für Bramstedt viel Gutes getan haben. Ihre Tochter – der einzige Sohn starb als hoher dänischer Offizier infolge einer Verwundung – heiratete den Grafen Kielmanssegge, der die Bramstedter Bauern als Leibeigene arg drangsalierte. Die Bauern unter ihrem Fleckensführer J. Fuhlendorf opferten zwei Drittel ihres Besitzes und erlangten so ihre Freiheit.
Messtorf, eine Bramstedter Schriftstellerin, gibt uns in ihrer Novelle „Wiebke Kruse“ einen Einblick in die Verhältnisse des Dorfes Föhrden Barl in den Jahren 1600 – 1625, [151] nennt die Namen einiger damals lebender Vollhufner, schildert die Harmonie, die unter den Bewohnern herrscht, dabei aber auch den Aberglauben, der sich unter der Bevölkerung breitgemacht hatte. Ob die Tatsachen und Namen historische Grundlagen haben, konnte ich nicht feststellen. Doch das eine steht fest: bis zum Jahre 1827 lebten die Nachkommen des Bauern Kruse auf der Vollhufe, die dann durch Einheiratung (Paul Rühmann, geb. 1797, Sohn eines Bauern aus Lockstedt, heiratete am 2. November 1827 die Tochter Elsabe, geb. 15.8.1799 in Barl, des Vollhufners Hinrich Kruse, verheiratet mit Anna Margaretha, geb. Möller.) an die Familie Rühmann übergeht. So hat sich die Vollhufe Kruse – Rühmann immer im Besitz derselben Familie seit mindestens 400 Jahren erhalten.
Während des 30-jährigen Krieges kam Wallenstein (1625 – 1629) auf seinem Marsche von Bramstedt nach Breitenburg, das von 300 Schotten unter Major Dunbar verteidigt wurde und viele geflüchtete Bauern mit Weib und Kind in seinen Mauern barg, durch unsere Gegend, plünderte und brandschatzte. „Die Stände sollten (später) Geld zur Abdankung der geworbenen Soldaten und zur weiteren Verteidigung des Landes bewilligen, lehnten es aber ab wegen der großen Not, Seuchen und Teuerung.“
Da Dänemark der Machterweiterung Schwedens entgegen arbeitete, fielen 1643 die Schweden abermals in Holstein ein „wie ein Platzregen aus hellem Wetter“. Die Kaiserlichen unter General Haller, die nichts anderes getan haben „als ganz Holstein aufgefressen“, kamen den Dänen zu Hilfe. Damals wurde eine Münze geprägt mit der Aufschrift „Was Haller in Holstein ausgerichtet, ist auf der anderen Seite zu sehen!“ Die andere Seite war aber leer. Der Friede kam 1645 zustande.
In den Jahren 1657 – 1660 durchzog die Kriegsfackel abermals unsere Heimat. In der sogenannten „Polackenzeit“ lagen die Kaiserlichen, Brandenburger und Polen ein ganzes Jahr in Schleswig-Holstein. „Michaelis übernachteten die Polen unvermutet in Bramstedt und Umgebung und raubten den Leuten, die sie überraschten, die Pferde.“ Als unser Land die Einquartierung nicht mehr ertragen konnte, [152] zog der große Kurfürst mit der „kurbrandenburgischen Armada“ durch Bramstedt und wurde im Flecken einquartiert. Der Kurfürst selbst übernachtete im Schloß. „Alles kostete den Flecken und das Kirchspiel viel Geld und Lebensmittel.“
„Die Polen ritten weit und breit, und weil es gefroren war, blieb ihnen in Büschen und Morästen an diesen und benachbarten Orten nichts verborgen.“ „Als der Friede dann 1660 geschlossen war und um die Zeit der Nachmahd die acht Regimenter der Verbündeten abzogen, wurden „dänische Völker“ in Flecken und Kirchspiel gelagert.“
Nordischer Krieg 1700 – 1721.
1713 verwüstete der schwedische General Steenbock unsere Heimat. Dynastische Streitigkeiten des 17. und 18. Jahrhunderts wurden auf dem Rücken und zum wirtschaftlichen und leiblichen Schaden des Bauern ausgetragen.
Nach dieser Zeit begann unsere Landwirtschaft wieder aufzuatmen und allmählich gelangten die Bauern wieder zu Wohlstand (Trachten). Doch mancher hatte die ungeheuren Lasten und Kontributionen nicht aufbringen können und mußte daher mit „dem weißen Stab“ sodann ziehen und seinen Besitz für den Lasten überlassen. Auch die im Jahre 1781 erfolgte „Einkoppelung“, wodurch die Aufteilung der Flurgemeinschaften erfolgte, hat wesentlich zum Aufblühen der Landwirtschaft beigetragen. Die landwirtschaftlichen Produkte wie Vieh, Korn, Butter, Eier und Wolle fanden nach dem Süden und ganz besonders über Hamburg und England guten Absatz. In jedem Herbst bewegten sich auf dem sogenannten „Ochsenweg“, von dem eine Nebenstrecke von Bramstedt über Föhrden Barl nach Itzehoe führte, große Viehherden nach dem Süden.
Die Befreiungskriege 1813 – 1815 bringen aufs Neue schwere Rückschläge. Franzosen, Russen und das Lützow’sche Freikorps durchziehen unser Land, requirierten Lebens- und Futtermittel, ganz besonders aber Pferde. In Föhrden Barl lagen 1814 Russen einquartiert. In diesem Jahren wurde der Hufner Joh. Fock geboren. Als die Mutter noch im Wochenbett lag, wurde sie von den Russen arg belästigt.
[153] Durch die sogenannte „Kontinentalsperre“ wurde der Handel mit England vollständig lahmgelegt. Die Bauern erstickten in ihren Waren, und die Steuern wurden wegen der Kriegslasten immer drückender. Einige Bauern unserer Gemeinde mußten ihre Vollhufe spottbillig (1.000 – 2.000 Thaler) verkaufen. Die Unzufriedenheit im Lande wuchs und erreichte ihren Höhepunkt durch den Staatsbankrott im Jahre 1844, wodurch das Geld vollständig wertlos wurde. Bei manchem national denkenden Bauern erwachte der großdeutsche Gedanke. Überall ertönte der Ruf: „Los von Dänemark!“. An dem Befreiungskrieg 1848 – 1850 nahm aus unserem Dorfe der Bauernsohn Hans Rühmann teil. Er war Bursche bei dem in unserer Heimat bekannten Leutnant Schmidt und nahm an verschiedenen Schlachten teil.
In der nachfolgenden Zeit nahm die Unterjochung durch die Dänen noch stärkere Formen an. Wer begütert war, konnte sich vom Militärdienst loskaufen, doch der „gewöhnliche Mann“ mußte im dänischen Heer dienen. So wurden z.B. Anton Fischer und Casten Blöcker – Dachdecker und Weber von Beruf – bei der schweren Artillerie in Kopenhagen drei Jahre eingezogen.
Da erfolgte endlich im Jahre 1864 die Stunde der Erlösung. In unserem Dorfe waren damals wochenlang Hannoveraner, Österreicher und Braunschweigische Soldaten, die sich gut gegen die Bewohner benommen haben, einquartiert. Der „Deutsche Krieg“ ging spurlos an unserer Gemeinde vorüber.
An dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 nahmen bereits einige Soldaten unseres Dorfes teil: Peter Schnack, der die Kämpfe bei Metz und Orleans mitmachte, Peter Steenbock und Stühmer.
Erst nach dem Jahre 1871 machte sich ein Aufblühen der Landwirtschaft in unserem Volke bemerkbar.
[154] Von der Landwirtschaft in früheren Zeiten.
Nach dem Hausbriefe der Familie Reimers aus dem Jahre 1785, den mir Joachim Kelting, Setzwirt der Reimerschen Vollhufe, zur Verfügung stellte, war der Grund und Boden der Gemarkung Föhrden Barl bis zum Jahre 1781 Gemeinbesitz sämtlicher Bauern.
Während in Ostholstein, überhaupt in Gegenden mit schwerem Lehmboden, der Großgrundbesitz und die Leibeigenschaft vorherrschten, lebte in unserer Heimat mit ihrem leichten Sandboden ein fleißiger und genügsamer Bauernstand. Der Grund und Boden war unverkäuflich. War ein Bauer verschuldet, so ging der Gesamtbesitz für 2.000 – 3.000 Taler in andere Hände über.
Die vier Vollhufner des Ortsteiles „Barel“ waren nach einem Hausbriefe der Familie Reimers aus dem Jahre 1753: Henny Kruse (jetzt Rühmann), Böge (jetzt Studt), Peter Harder (später Fock, Schnack) und Timm Fischer (jetzt Reimers). Die vier Vollhufen in Föhrden sind im Laufe der Jahre alle durch Verkauf in fremden Besitz gelangt
Alle vier Jahre wechselten die Bauern ihre Kämpe, das waren nämlich ihre Äcker. Saat und Ernte erfolgte bei allen Ländereien gleichzeitig; denn nach der Ernte bildete der „Kamp“ die Weide für das Vieh, das bis dahin im Kratt, insbesondere im „Oster“ gehütet worden war. Der Bachholz lieferte zu damaligen Zeiten das Heu, denn die Wiesen an der Bramau waren damals vollständig wertlos. Die Bramau schlängelte in unendlich vielen Krümmungen durch das Wiesental und trat bei Regenfällen regelmäßig über ihre Ufer. Die Wiesen waren zur Hauptsache mit Binsen und Wassergräsern bewachsenen und bestanden aus Sumpflöchern und zusammengetriebenen Sandhügeln. Der Bauer Hans Rühmann ebnete als erster seine Wiesen ein, warf Dämme auf und erprobte ums Jahr 1850 eine künstliche Berieselung, indem er durch ein Wasserschöpfrad, das durch eine Windmühle betrieben wurde, das Wasser der Au in einen höher gelegenen Graben leitete. Da diese Wiesen recht bald einen höheren Heuertrag lieferten, [155] folgten andere Bauern recht bald seinem Beispiel. Erst im Jahre 1888 schlossen sich dann die Gemeinden Föhrden Barl, Hitzhusen und Hagen zusammen und gründeten die „Bramau-Berieselungsgenossenschaft“. Bereits im Jahre 1891 war die Au reguliert und eingedeicht, die Wiesen eingeebnet und die Schleusen gebaut. Dann wurden die Wiesen unter die Bauern verteilt. Einzig der Bauer Hans Rühmann blieb im Besitze seiner früheren Wiesen, denn dies hatte er bei Gründung der Genossenschaft zur Bedingung gemacht. Auf seine Vorstellung ließ man auch den großen Bogen der Au bei der Schleuse bestehen. So liegen die Auwiesen der Rühmannschen Hufe noch heute direkt beim Hause und werden nicht, wie dies bei den anderen Wiesen der Fall ist, durch die Au zerstückelt. Die Heuerträge der Wiesen waren in den ersten Jahren nach ihrer Fertigstellung – trotz der hohen Kosten und Lasten – sehr gering, und mancher Bauer wäre seine Wiesen gerne wieder los gewesen. Doch recht bald steigerten sich die Erträge.
Die Wiesen im Bachholz konnten nunmehr als Weide benutzt werden. Die Landwirtschaft, ganz besonders die Viehzucht, blühte auf.
In früheren Zeiten wurde das Vieh der Gemeinde durch den Kuhhirten gehütet und zwar Kühe und Jungvieh getrennt. Außerdem bestand in jedem Ortsteil eine Dorfschäferei. Die Schafweiden wurden nach Auflösung der Schäfereien als letzte Flurgemeinschaften ums Jahr 1850/60 aufgeteilt. Der Schafstall in Barl stand auf der Koppel des Bauern Reimers und ist im Jahr 1860 niedergebrannt (jetziger Besitzer der Koppel: Hahn – Schwarzkopff). Bei diesem Feuer verbrannten viele Schafe. Der Schäfer, der den Brand durch seine Fahrlässigkeit mit seiner „Funsel“ verursacht haben soll, wurde wahnsinnig. Der Schafstall des Ortsteiles Föhrden stand auf dem „Scheeberkamp“, hinter Steffens – Krohns Garten am Staugraben. Als man die Wolle spottbillig aus dem Ausland, insbesondere aus Australien, beziehen konnte und die Schafzucht nicht mehr lohnend war, wurde auch diese Schäferei stillgelegt, der Schafstall abgebrochen, die Ländereien verteilt.
[156] Der Schäfer war ein Angestellter der Bauern, der Lohn bestand in freier Wohnung, etwas Ackerland („Scheeberkamp“), freie Weide für etliche Schafe und einem festen Gehalt. Außerdem strickte der Schäfer Handschuhe und Strümpfe, die mit Vorliebe gekauft wurden. Der Schäfer war der Tierarzt des Dorfes. Wenn ein Pferd oder eine Kuh erkrankten, wurde der Schäfer geholt, der die Krankheit feststellte und dann von seiner aus selbstgepflückten einheimischen Heilkräutern hergestellten Arznei verordnete. Der Schäfer galt als „kluger Mann“ und wurde daher von jedermann geehrt und geachtet. Über die Geschichte der Heimat, von Märchen und Sagen konnte der Schäfer im vertrauten Kreise stundenlang erzählen.
Am 10. November jeden Jahres, am sogenannten „Martini“, kamen die Bauern zusammen, rechneten ab und teilten den Gewinn. Der „Schulmeister“ nahm an dem Feste als Rechnungsführer teil. Dieses Fest wird noch heute gefeiert.
Der Viehbestand einer Vollhufe war in früheren Zeiten nur gering: vier Arbeitspferde, zwei Fohlen, bis 25 Stück Hornvieh – Kälber und Jungvieh eingerechnet -, fünf bis acht Schweine, 25 Hühner und 20 bis 60 Gänse bildeten das ganze lebende Inventar einer 100 Hektar großen Vollhufe.
Wie bereits eingangs erwähnt, erfolgte im Jahre 1781 die Aufteilung der Flurgemeinschaften (Äcker und Wiesen) nach der Anzahl der Vollhufen durch das Los. Bei der Verteilung bekam somit jeder Bauer guten und schlechten Boden. Daher liegen die Koppeln der Bauern in der ganzen Gemarkung zerstreut, jedoch immer in derselben Reihenfolge – so z.B. ist in Barl immer die Reihenfolge: Kruse, Böge, Harder, Reimers. Die einzelnen Koppeln wurden eingewallt, und der Wall wurde mit einem Knick bepflanzt. Der Knick gen Westen gehört in der Regel zum Grundstück. Durch Gräben wurde die Koppel in Stücke eingeteilt. Das Wasser leitete man durch künstliche Entwässerungsgräben in die Au. Der Stapelkamps-beeck und der Mühlenbeek sowie der Grenzgraben zwischen den Gemarkungen Föhrden Barl und Weddelbrook im „Bargholz“ sind solche damals angelegten Entwässerungsgräben. Vorher wälzten [157] sich die Wassermassen über „Herrenholz“ und „Bargholz“ und flossen dann über Hingstheide / Wulfs-moor in die Bramau. Nach der Aufteilung der Flurgemeinschaften konnte die Landwirtschaft aufblühen; denn nunmehr hatte jeder Bauer Interesse an der Verbesserung seines eigenen Grund und Bodens.
Während sich im Ortsteil „Barel“ die Vollhufen bis zum Jahre 1900 in ihrer vollen Größe erhielten, haben die Vollhufen in Föhrden nicht nur häufig ihren Besitzer verändert, sondern es wurden Ländereien ver- und gekauft, ja sogar ganze Vollhufen zerschlagen. Die Hauskoppel des Bauern J. Karstens und der Besitz des Bauern Johannes Rühmann gehörten ursprünglich zur Vollhufe Steffens. Kock – Johannsens Besitz und die Landstelle der Witwe Thies entstammen der Krohnschen (jetzt A. Feil) Vollhufe. 1896 wurde die Vollhufe J. Runge (jetzt Kröger) parzelliert. Abbauten: H. Keltings (ursprünglich als Gärtnerei gedacht) und Johannes Behnkes Besitz. Vollhufe Runge zerteilt in zwei Halbhufen. Besitzer W. Runge – J. Lohse und Heinrich Runge, Ernst Runge – B. Feil. Das Wirtschaftsgebäude der Witwe Thies war einst die Scheune der Krohnschen Vollhufe, Karstens Haus die Tagelöhnerkate der Vollhufe Koopmann – J. Runge (Kröger).
Föhrden und Barl werden seit jeher eine politische Einheit gewesen sein und daher auch nur einen „Burvogt“ gehabt haben; denn es gibt innerhalb der Gemarkung nur eine „Burvogtskoppel“ die 1910 als Unland an H. Kock, Heidekaten, verkauft wurde, jetziger Besitzer ist H. Harbeck.
Da „Rethorn“ und „Bargholz“, die Wiesen und die Wälder im „Oster“ und in „Richtung Stellau“ gemeinsamer Besitz der Bauern beider Ortsteile gewesen waren, wurden die Wiesen im „Oster“, „Bargholz“ und „Rethorn“ an alle Vollhufner verteilt. Die Wälder im „Oster“ teilten sich die drei Barlner Vollhufner – der vierte – Hans Rühmann – erhielt das „Hinkenholz“ – und der Wald „Richtung Stellau“ wurde unter die vier Hufner des Ortsteils „Föhrden“ verteilt (1850). (Das Lentföhrdener Moor wurde (laut Moorbuch Johannes Fock) im Jahre 1812 von der Gemeinde Lentföhrden gekauft.)
[158] „Das Moor“ Richtung Hagen war früher Eigentum der dänischen Krone und wurde dann 1866 durch die preußische Regierung parzellenweise verkauft. Heinrich Hase kaufte viele kleine Parzellen zusammen und schuf so 1908 einen größeren Besitz.
Viele Geräte, mit denen unsere Vorfahren zu damaligen Zeiten ihre Arbeit verrichteten, sind uns zum großen Teil völlig fremd geworden. Wir finden solche, wenn wir der sogenannten „Rumpelkammer“ eines alten Bauernhauses einen Besuch abstatten.
An der Wand hängt der Flegel, mit dem früher das Korn gedroschen wurde. Die gedroschenen Garben und das lose Stroh wurden mit der „Gaffel“, einer Art Holzforke, ausgeschüttet. Das Korn reinigte man mit einer selbstgefertigten Holzschaufel, indem man das gedroschene Korn damit gegen den Wind warf. Erst seit dem Jahre 1870 findet man bei uns im Dorfe die ersten Kornreinigungsmaschinen, „Stövmöhl“ genannt, die der damalige Lehrer Saggau nach eigenem Entwurf herstellte. Das Korn wurde nicht gewogen, sondern mit dem „Spint“ und „Hümpen“ gemessen. 4 Hümpen = 1 Spint, 4 Spint = 2 Zentner oder 1 Tonne. Noch früher benutzten die alten Bauern sehr oft den Ausdruck „Tonne“, meinen jedoch Doppelzentner. Erst ums Jahr 1880/90 kamen die ersten Dreschmaschinen auf, die anfangs mit Handbetrieb versehen waren, später durch einen „Göpel“ getrieben wurden. Die erste Dampf-Dreschmaschine trat auf dem Besitze meines Vaters ums Jahr 1897 in Tätigkeit. Diese ums Jahr 1900 modernsten Maschinen sind um das Jahr 1934 – als dies geschrieben wurde – schon wieder Altertümer.
Auf dem Spinnrad spann meine Großmutter noch vor 40 Jahren Wolle und Flachs. Die Fäden sammelte eine Spule. Durch eine Haspel wurden sodann die Fäden abgewickelt und geordnet. Der sogenannte Kratzer – das ist ein Brett mit etwa 200 – 300 fingerlangen Stahlnadeln – diente zum Auskämmen der gewaschenen Wolle.
[159] Als Beleuchtung benutzte man bis zum Jahre 1860/70 in den Wohnstätten Talglichter und in den Ställen die sogenannte Funsel. Die Talglichter wurden an langen Winterabenden aus geschmolzenem Talg gegossen. Dabei benutzte man eine Metallform, in die der Baumwolldocht gespannt wurde. Die „Funsel“ ist eine Blechkanne mit einem Seitenrohr, die durch Rüböl gespeist wurde. Als Docht verwendete man meistens getrocknete Binsen. Aus dieser Zeit stammen auch die verstellbaren Leuchter und die Lichtscheren, die heutzutage geputzt das Gesimse der Stube schmücken.
Die Petroleumlampe, die viele Male verbessert wurde, galt noch vor 60 Jahren für eine moderne Erfindung, aber nunmehr gehört sie schon wieder zu den Altertümern und hat dem elektrischen Licht – angelegt in unserem Ort im Jahre 1912/13 – Platz machen müssen.
Zwei Weber hatten in unserem Dorfe noch vor 70 – 80 Jahren vollauf zu tun, um auf den mechanischen, äußerst primitiven Webstühlen mit Handbetrieb die Leinwand zu weben. Auch das beiderwandsche Zeug wurde durch die Weber hergestellt. Das Linnen wurde mit der Elle gemessen. Im Frühling ließ man das Linnen an der Sonne bleichen. Man bediente sich des „Linngeeters“ und entnahm das Wasser dem „Bleekgraben“ vor der Bleekkuhle.
So ließen sich noch viele andere Altertümer aufzählen. In dieser oder jener alten Bauernfamilie unseres Dorfes findet man nicht selten diese oder jene Altertümer, auf deren Wert nicht genug hingewiesen werden kann, und ganz besonders dann, wenn es sich um uralte Familienandenken handelt.
Sie erzählen uns aus der Geschichte unserer Vorfahren und wie diese vor etwa 1.000 Jahren lebten.
[160] Wege und Verkehrsverhältnisse in früheren Zeiten.
Die Wege- und Verkehrsverhältnisse in der „guten alten Zeit“ waren die denkbar schlechtesten. Da die Flüsse vielfach unüberwindbare Schwierigkeiten bereiteten, führten die Hauptverkehrswege über den Mittelrücken. So führte z.B. eine wichtige „Landstraße“ von Bramstedt über das Herrenholz Richtung Stellau nach Itzehoe, eine andere über die Lutzhorner Heide, Weddelbrook, durch die „Fuhrt“ unseres Dorfes, über „Heidekaten“ nach Kellinghusen und dann weiter nach Rendsburg. Überall in der Heide u.a. auch in der Heide am Quarnstedter Weg, sah man noch um das Jahr 1800 eine ausgefahrene Wagenspur neben der anderen. Auch führte schon in früheren Jahrhunderten eine Straße (jetzt Chaussee) durch das „Hinkenholz“ nach Bramstedt, doch war diese meistens für Wagen unpassierbar, wurde durch Bäche überrieselt und die Fußgänger mußten, wie mir alte Leute erzählten, von einem Stein zum anderen springen. Auf diesen Wegen fuhren die Kaufleute mit ihren Planwagen von Dorf zu Dorf, kauften Eier, Butter, Wolle usw. oder tauschten diese Waren gegen Kolonialwaren ein. Diese sogenannten „Butterhändler“ beförderten meistens auch die Briefe. Ums Jahr 1850 wohnten in unserem Dorfe noch zwei solcher Händler, die wöchentlich mit „Pferd und Wagen“ nach Hamburg fuhren, nämlich Jochim Krohn und Kröger (jetziger Besitz A. Feil, Fr. Fölster).
Nachdem die erste Kunststraße gebaut (1830 – 1833) und die Eisenbahnlinie Kiel / Altona 1844 eröffnet wurde, schritt man im Jahre 1850 zum Ausbau der Chaussee Bramstedt – Wrist. Die Bauern von Föhrden Barl mußten zum Ausbau dieser Straße innerhalb der Gemarkung das Land und Material zur Verfügung stellen und 200 M in bar zahlen. Der damalige Burvogt Jochim Krohn, der als Butterhändler sicher großes Interesse an dem Ausbau gehabt hat, ließ Kies und Sand (Kies) auf dem Studt’schen Grundstück – Wrister Kamp – und der Hauskoppel von G. Steffens sieben. Viele Bauern und Arbeiter fanden beim Straßenbau eine lohnende Beschäftigung.
Nach Fertigstellung der Chaussee blühte der Verkehr auf, sogar die [161] Bauern aus dem Kirchspiel Kaltenkirchen verfrachteten ihre landwirtschaftlichen Produkte in Wrist und brachten alsdann vielfach Kunstdünger oder Futtermittel wieder mit zurück. Im Jahre 1879 eröffnete der Weber Casten Blöcker an der Chaussee eine Gastwirtschaft, in der sehr bald reger Betrieb herrschte.
Von Bramstedt nach Wrist verkehrten damals täglich mehrmals zwei Omnibuslinien, die Personen und Post beförderten. Hans Kröger, seit 1854 Omnibuskutscher, heiratete 1868 die Tochter des Bauern Mus von Heidekaten und ließ sich in unserem Dorfe als Bauer nieder. Die mit Pferden bespannten Omnibusse stellten im Jahre 1913 den Verkehr ein, der seit dieser Zeit durch Verkehrsautobusse aufrecht erhalten wird.
Die Chaussee nach Hagen wurde im Jahre 1913 ausgebaut.
Da der Kreis Segeberg wenig erschlossen war, plante man 1913 den Bau einer Bahn von Lübeck nach Wrist. Die Gemeinde beschloß damals, den Bau der Eisenbahnlinie zu unterstützen und für 20.000 M Aktien zu übernehmen, wenn die Gemeinde eine Bahnstation in unmittelbarer Nähe des Dorfes erhalten würde. Wegen Ausbruch des Weltkrieges 1914 und anderer unüberwindbarer Schwierigkeiten, gelangte das Projekt nicht zur Ausführung.
Um das Jahr 1856 wurde der „Damm“, der bereits als Fußsteig durch das Wiesental führte, erhöht und verbreitert, so daß er auch mit Pferd und Wagen befahren werden konnte. Bis dahin stand bei dem Bauern Böy (jetzt H. Harbeck) stets ein Pferd bereit, auf dem die Fußgänger gegen Bezahlung durch die Au ritten. Das treue Tier kehrte alsdann führerlos wieder in seinen Stall zurück. Im Jahre 1856 wurde, nach Fertigstellung des Dammes, die erste hölzerne Brücke gebaut, die allerdings bereits 1871 erneuert werden mußte – Bauherr Zimmermeister Lohse, Weddelbrook. Wegen Überlastung, die Bau und Unterhaltung der Brücke brachten, wurde der Gemeinde erlaubt, Brückengeld zu heben. Noch im Jahre 1909 stand auf jeder Seite der Brücke eine Tafel mit der Aufschrift: „Brückengeld! Je Pferd 10 Pf., je Kuh 5 Pf, je Schaf 2 Pf.“. Das Brückengeld wurde von dem jeweiligen Besitzer an der Brücke erhoben und [162] an die Gemeinde abgeliefert. Im Jahre 1909 wurde die unpassierbar gewordene, morsche hölzerne Brücke abgebrochen und die jetzige massive Brücke für 8.400 M durch die Bauunternehmer Bartels und Lindemann in Wrist gebaut. Der im Jahre 1910 beschlossene chausseemäßige Ausbau der Landstraße Föhrden Barl – Weddelbrook wurde bisher nicht erledigt.
Dagegen wurde der Ausbau der Dorfstraße nach Überwindung großer Schwierigkeiten endlich im Jahre 1920 zunächst bis Thies und H. Runge – jetzt B. Feil – und wenige Jahre später bis Johannsen, Steffens und H. Rühmann durchgeführt, so daß im Jahre 1934 sämtliche Dorfstraßen chausseemäßig ausgebaut waren. Im Jahre 1920 wurde auf dem Dreiangel vor dem „Schulenbrook“ das Kriegerdenkmal für die Gefallenen des Weltkrieges 1914/18 errichtet.
Nachdem im Jahre 1929 die Strecke Bramstedt – Itzehoe als Teerchaussee ausgebaut wurde, hat der Autoverkehr rapide zugenommen. Bereits im Jahre 1930 verkehrten auf dieser Strecke bei gutem Wetter stündlich 40 – 60 Autos. Schon mehrfach wurde mit der Gemeinde und dem Gastwirt Blöcker sowie dem Bauern Reimers wegen Beseitigung der Kurve verhandelt, leider bisher ergebnislos.
Bereits im Jahre 1939 wurden diverse Linien für die geplante Autobahn in unserer Gemarkung aus“gebakt“. Ob die Linienführung endgültig ist, soll noch entschieden werden. Vorläufig sind wegen des ausgebrochenen Krieges die Arbeiten eingestellt.
Noch vor reichlich 50 Jahren führten durch unsere Gemarkung undenklich viele „Rechtsteige“, die die Bestellung der Felder erschwerten und für die ganze Wirtschaft große Nachteile darstellten. So führte z.B. ein Steig von Fölsters Kate durch die Wiesen nach Weddelbrook, den ich als Junge oft passierte. Andere Rechtsteige gingen nach der Hagener Grenze, nach dem Bargholz, nach Hitzhusen, nach der Schule usw. Im Laufe der Jahre sind diese Steige nach und nach eingegangen und nur noch ganz vereinzelt vorzufinden.
[163] Das alte Föhrdener Bauernhaus.
Die alten, mit Stroh gedeckten Bauernhäuser werden seit dem Jahre 1900 immer seltener. Eines der schönsten derselben wird im Jahre 1927 – Besitzer Wilhelm Runge – Johannes Lohse – abgebrochen und muß einem Neubau weichen.
Das alte Föhrdener Bauernhaus mit seinen getäfelten Wänden hat die Form eines Rechtecks. Durch die „große Tür“ betreten wir die große Diele, die den größten Teil des Hauses einnimmt und hauptsächlich zum Dreschen benutzt wird. Hier hört man im Winter von morgens früh bis abends spät das Geklapper der Dreschflegel. Auf der einen Seite der großen Diele, die aus Lehm hergestellt ist, befindet sich der Kuhstall. Das Vieh wird von der Diele aus gefüttert und nach beendeter Fütterung werden die mächtigen „Kuhklappen“ geschlossen. Auf der anderen Seite der Diele liegen die beiden Pferdeställe, zwischen denen sich meistens eine sogenannte Häckselkammer befindet. In Verlängerung der Ställe finden wir die Kammern für die Knechte und Mägde. Über den Kammern und Ställen befinden sich die „Hilgen“. Der mächtige Boden mit mehreren Luken dient zur Lagerung des Korns und des Rauhfutters. Unter der Decke der großen Diele hängen Wurst, Speck und Schinken, die von der Küche aus geräuchert werden. Bauernhäuser mit Schornsteinen treffen wir erst seit dem Jahre 1860/70 an.
Von der Großen Diele aus gelangen wir in die Wohnung der Bauernfamilie. Zwischen den beiden Stuben liegt die mit Feld- oder Ziegelsteinen gepflasterte Küche mit dem „deutschen Herd“, über dem sich der mit Ruß geschwärzte „Schwiebogen“ wölbt. An einer langen verstellbaren Kette hängt ein großer „Schmorgrapen“. Über der Feuerstelle steht der Dreifuß, auf dem die Pfanne steht, in der Bratkartoffeln, Klöße usw. gebraten werden. Von der Küche aus wird auch der große Beilegeofen der Stube geheizt. Der Rauch zieht durch die Diele hin ab. Auf den Wandborden der Küche stehen Grapen und Töpfe sowie Teller und Küchengeräte.
[164] Betreten wir nunmehr von der großen Diele aus die Wohnstube. Die saubere Lehmdiele derselben ist mit hellem weißen Sand bestreut. Die Ruten der einzelnen Fenster sind mit Blei eingefaßt. Die Wände der Stube sind getäfelt und recht oft mit Schnitzereien oder Malereien versehen und enthalten meistens mehrere Wandschränke, die Kleidung und Wäsche der Familie bergen. Die Wandbekleidung birgt eine von Künstlerhand angefertigte Wanduhr, die durch zwei Bleigewichte getrieben wird. In die Wandbekleidung sind meistens die Schlafstätten, sogenannte „Kupbetten“, die durch Schiebetüren verschlossen werden können, eingebaut. In der Stubentür befindet sich ein ovales „Kiekfenster“, durch das der Bauer jederzeit seine Arbeiter auf der großen Diele unauffällig beobachten kann. In der Ecke der Stube stehen zwei Spinnräder und eine Haspel, an denen noch nach beendeter Tagesarbeit bis 9.00 Uhr abends die Hausfrau und die Töchter und Mägde Flachs oder Wolle spinnen.
Um den mächtigen Eichentisch versammeln sich zu den Mahlzeiten und am Abend nach beendeter Arbeit die Hausgenossen, die eine Volksgemeinschaft im wahren Sinne des Wortes bilden. Eine Zierde der Stube ist eine mächtige eichene Truhe mit kunstvoller Schnitzerei und den Buchstaben AK 1747; eine Mitgift der Bauerntochter Anna Karstens, die in diesem Jahre heiratete. Unsere Aufmerksamkeit erweckt außerdem noch der große Beilegeofen, auf dessen gußeisernen Platten wir folgende biblische Bilder erblicken: 1) „Salomo als Richter“ und 2) „Moses errichtet die eherne Schlange“. Die Vorderplatte zeigt das Bild eines Mannes mit einer Waage in der Hand – das Zeichen von Recht und Gerechtigkeit. Auf der Vordiele, die ums Jahr 1880 durch eine Quermauer von der „großen Diele“ abgetrennt wurde, stehen zwei große mit Eisenverzierungen beschlagene Koffer, die das selbstgefertigte Linnen, die Mitgift der beiden Töchter, bergen.
Wir verlassen das Bauernhaus aus der „Blangdör“ (Seitentür), über der in einem Balken folgende Inschrift zu lesen ist: Johann Karstens – Magdalena Karstens – 15. Maives, Anno 1802, also die Namen der Erbauer dieses stattlichen Bauernhauses.
Unter dieser Inschrift steht der Spruch: „Wer ein- und ausgeht durch die Tür – der soll bedenken für und für – daß unser Heiland Jesus Christ – die rechte Tür zum Leben ist.“ [165] Vor dem Bauernhaus liegt ein gepflegter Zier- und Gemüsegarten und daneben eine mit Stroh gedeckte mächtige Scheune, die Futtervorräte für das Vieh und Ackergeräte sowie Wagen birgt. Außerdem stehen unweit des Bauernhofes die Altenteiler- und eine Tagelöhnerkate.
Das Bauerngehöft wird von uralten Eichen umgeben.
Die massiven, meistens mit Pappe gedeckten neuzeitlichen Bauernhäuser sind ohne Frage bedeutend praktischer eingerichtet, doch verunzieren sie nicht selten das Landschaftsbild und zeugen von geringem Schönheitsgefühl ihres Erbauers. Die Wohnräume, die recht oft von den Wirtschaftsgebäuden getrennt liegen, zeigen die modernsten Einrichtungen. Das ums Jahr 1850 moderne, kunstvolle „Vertiko“ und die „Kommode“ haben dem Buffet und dem „Kredenz“ Platz machen müssen. Auf dem lackierten Fußboden liegen schwere Teppiche und vor den Fenstern hängen wertvolle Gardinen. Die „beste Stube“ mit ihrem scheinbar wertvollen Mobiliar darf hier und da fast während des ganzen Jahres kaum betreten werden! – Welch ein Unsinn! Der Beilegeofen hat einem Kachelofen und dieser wiederum einer Dampfheizung Platz machen müssen. Die Petroleumlampe wird durch das elektrische Licht ersetzt, die Hausfrau plättet und kocht elektrisch! In der Wirtschaft hat der Motor den Sieg davongetragen. Moderne praktisch einge-richtete Wirtschaftsgebäude und Viehställe verdrängen die „alten schönen Baulichkeiten“ immer mehr.
So ändern sich in wenigen Jahrzehnten die Zeiten! (1940. Mohr.)
[166] Führende Männer unserer Gemeinde während der letzten 100 Jahre.
Anhand des alten „Rechnungsbuches für die Schule in Föhrden Barl, angefangen 1836“, ist es mir möglich geworden, die führenden Männer unserer Gemeinde während der letzten 100 Jahre festzulegen. Wie mir der Bürgermeister mitteilt, sind ihm bei seinem Amtsantritt im Jahre 1934 weder Bücher mit der jährlichen Gemeinderechnung noch Gemeindebeschlüsse der früheren Jahre übergeben worden.
Der Leiter der Gemeinde Föhrden Barl wird bis zum Jahre 1870 „Burvogt“, von 1870 – 1898 „Ortsvorsteher“, von 1899 – 1934 „Gemeindevorsteher“ und seit 1934 „Bürgermeister“ genannt. Als folgende werden aufgeführt:
1836 – 1845 Paul Rühmann, Vollhufner in Barl,
1846 – 1849 Hinrich Steffens, Vollhufner in Föhrden, (starb 1850),
1850 – 1858 Jochim Krohn, Vollhufner in Föhrden, (Hof A. Feil)
Im Jahre 1854 wurde die Straße Bramstedt – Wrist, die vollständig durch unsere Gemarkung führt, chausseemäßig ausgebaut. Die Gemeinde stellte Grund und Boden zur Verfügung, zahlte 200 Mark in bar und lieferte das erforderliche Material. (S. 160). Der „Damm“ durch das Bramautal wurde aufgeschüttet und über die Au wird die erste hölzerne Brücke erbaut (1856). 1857 wurde das neue Schulhaus in Barl durch den Zimmermeister Burmeister aus Bramstedt für 2.405 Reichstaler gebaut, worauf die beiden alten Schulhäuser im Jahre 1858 für 1.098 Reichstaler und 64 Groschen an den Schuster Hartmann Stühmer – jetzt Plambeck – und den Arbeiter Hartmann – Nachfolger Hans Theegen, Johann Mohr, Heinrich Zornig, Abbruch 1937 durch H. Reimers – verkauft wurden. Bemerkung 1 Reichstaler = 3 Silbermark oder 36 Groschen und 1 Groschen = 4 Schilling. Den Bauplatz für das neue Schulhaus stellte der Vollhufner Johann Fock von seinem Garten kostenlos zur Verfügung.
Aus dem langjährigen Wirken als Leiter der Gemeinde und seiner fortschrittlichen Tätigkeit ist zu erkennen, daß dieser „Burvogt“ innerhalb der Gemeinde am rechten Platze stand.
[167]
1859 – 1861 Hans Rühmann, Vollhufner in Barl,
1862 – 1864 Johann Fock, Vollhufner in Barl, (Hof H. Schnack),
1865 – 1869 Jacob Koopmann, Vollhufner in Föhrden, (Hof J. Kröger),
1870 – 1874 Hans Rühmann, Vollhufner in Barl.
Neubau der Holzbrücke über die Bramau durch Zimmermeister Lohse, Weddelbrook. Das „Moor“ wurde parzellenweise verkauft. Die vier Vollhufner hatten die Absicht, sich das Ödland, welches zum Teil bereits durch „kleine Leute“ urbar gemacht worden war, zu teilen. Durch die Regierung, bei der Beschwerde erhoben war, wurde nun festgestellt, daß der dänische König rechtmäßiger Besitzer und das Land somit an den preußischen Staat gefallen sei – wurde nunmehr eine Parzellierung verfügt. Einige „kleine Leute“ mußten ihren bereits urbar gemachten Grund und Boden nochmals bezahlen.
1875 – 1881 Hinrich Steffens, Vollhufner in Föhrden, (starb …., Hof Krohn),
1882 – 1887 Markus Runge, Vollhufner in Föhrden,
1888 – 1895 Johannes Runge, Vollhufner in Föhrden.
Errichtung einer Zwangsfeuerwehr. Spritze und Uniformen zahlte der Junggeselle J. Runge aus seiner Tasche. Runge soll nur selten Steuern erhoben haben.
1896 – 1897 Hinrich Steffens, Vollhufner in Föhrden.
Er war beliebt bei jung und alt, und seine derben Aussprüche haben sich im Volksmund bis auf den heutigen Tag erhalten. Steffens war von 1889 bis 1902 Amtsvorsteher des Amtsbezirkes Weddelbrook.
1898 – 1911 Markus Studt, Halbhufner in Barl – jetziger Besitzer Johs. Harbeck.
1909 Bau der massiven Brücke über die Bramau (S. 160).
1910 chausseemäßiger Ausbau der Landstraße Föhrden – Weddelbrook beschlossen – nicht ausgeführt.
1911 – 1919 Jochim Kelting, Setzwirt der Reimerschen Vollhufe.
1911 Neubau des Schulhauses (S. …)
1913 Ausbau des elektrischen Lichtnetzes
1919 – 1921 Karl Feil, Halbhufner in Föhrden.
Chausseemäßiger Ausbau des „Dammes“ bis Thies und H. Runge. Bau des Kriegerdenkmals (Kolbe, Itzehoe.)
[168]
1921 – 1922 Markus Studt, Rentner in Föhrden Barl, (gestorben im Frühjahr 1922).
1922 – 1934 Wilhelm Runge, Halbhufner, später Rentner in Föhrden Barl.
Der chausseemäßige Ausbau der Dorfstraße bis Johannsen, Steffens und Hr. Rühmann wird fortgesetzt. Ausbau des elektrischen Ortsnetzes bis Johannsen und Seider.
1934 – 1943 Albert Feil, Halbhufner Föhrden Barl,
der nicht gewählt, sondern auf Vorschlag der Ortsgruppe der N.S.D.A.P. zum Bürgermeister der Gemeinde ernannt wurde.
1943 – 1945
Nachdem der Bürgermeister Feil zur Wehrmacht (Wachmann in Hasenmoor und Föhrden Barl) eingezogen ist, wird der Ortsgruppenleiter der N.S.D.A.P. zum kommissarischen Bürgermeister der Gemeinde ernannt und vereinigt damit alle Gewalt in seiner Hand. Er regiert und herrscht wie ein allmächtiger König und erwirbt sich dadurch die Feindschaft vieler Ortsbewohner, Flüchtlinge und Evakuierter. Verhaftung durch Militärregierung. Internierungslager Gadeland.
1945 – ….
Heinrich Harbeck wird von der Militärregierung als Bürgermeister eingesetzt. Hoffentlich wird es ihm gelingen, das sinkende Schiff in den sicheren Hafen zu bringen. Gemeinderat wird ernannt: 12 Mitglieder, davon 4 Frauen. Z.Zt. sind ca. 150 – 160 Flüchtlinge in der Gemeinde untergebracht.
[169] Wie die Gemeinde den Weltkrieg miterlebte, berichtet von Lehrer W. Mohr.
Schon seit Jahren wird die Spannung unter den europäischen Staaten, verursacht durch die Einkrei-sungspolitik Englands, immer größer. Eine schwüle Gewitterstimmung ruht über ganz Europa. Mit ban-ger Vorahnung auf eine ernste, schwere Zeit, vernehmen wir die Ermordung des österreichisch-ungari-schen Thronfolgers, des Erzherzogs Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajewo. Mit Spannung werden die Verhandlungen zwischen den Großmächten verfolgt, bis Deutschland, herausgefordert durch die russischen Heeresansammlungen an der deutschen Ostgrenze, am 1. August die „allgemeine Mobilmachung des deutschen Heeres“ anordnet, der 2. August ist der erste Mobilmachungstag.
Ich verlebe meine Ferien in Bad Bramstedt. Die ganze Bevölkerung ist in Erregung! In Gruppen stehen die Volksgenossen auf den Straßen, und an ihren ernsten Gesichtern und bangen Fragen ersieht man den Ernst der Lage. Extrablätter der Bramstedter Nachrichten bringen die wichtigsten Meldungen, und wie ein Lauffeuer geht es noch in später Abendstunde von Mund zu Mund: Deutschland hat Rußland den Krieg erklärt. Auf dem Bleek erschallen die ersten „Böllerschüsse“. Um durchfahrende Automobile kontrollieren zu können, wird auf der Brücke eine „Kettensperre“ angebracht. Auf dem Marktplatz sammeln sich hunderte von Menschen und singen Vaterlandslieder. Pastor Hümpel besteigt den Roland und hält eine zu Herzen gehende patriotische Ansprache, die mit dem Deutschlandliede und einem Hoch auf Kaiser und Reich endet. In der Kirche werden die ins Feld ziehenden jungen Krieger einsegnet. Bis spät in die Nacht sind sämtliche Gaststätten bis auf den letzten Platz gefüllt. Freunde nehmen Abschied, Kinder reichen dem Vater – vielleicht zum letzten Male – die Hand; denn schon am nächsten Morgen in aller Frühe fahren die ersten Krieger fort, um sich in Neumünster, Segeberg oder Altona ihrem Truppenteil zur Verfügung zu stellen.
Bei meiner Ankunft in Föhrden Barl, wohin ich am nächsten Tage zurückeile, haben die ersten Soldaten unseren Ort bereits verlassen. In Bramstedt findet im „Buten Dor“ die erste Pferdemusterung statt. Das verbleibende Pferdematerial ist so minderwertig, daß es schwer halten wird, die vor der Tür stehende Ernte zu bergen.
[170] Der Eisenbahnverkehr ist für Zivilpersonen gesperrt, und nicht weniger als etwa 120 Eisenbahnzüge, beladen mit Geschützen, Soldaten usw. rollen täglich durch Wrist nach der Front. Wir eilen täglich mit Erfrischungen und Butterbroten an die Züge, um unseren Soldaten eine Freude zu bereiten. Die Eisenbahnwagen sind mit Zeichnungen und Aufschriften bemalt, die zeigen, mit welcher Begeisterung unsere Krieger für die heilige Sache kämpfen werden. Am 3. August zieht der erste größere Pferdetransport an der Schule vorbei. Als einer der Reiter begrüßt mich der Bauer Johannes Karstens von hier. Von Vaterlandsliebe beseelt, bitte ich die Regierung, meine Unabkömmlichkeit aufzuheben, damit ich meine Pflicht an der Front erfülle. Die Behörde lehnt meine Bitte mit der Begründung ab, daß ich meine Pflicht in der Heimat zu tun hätte.
Groß ist die Begeisterung und der Opfersinn der Schuljugend. Sie gibt am liebsten alles her, um das Los unserer Krieger zu erleichtern, um dem Vaterlande durch Opfer zu dienen. Die Reisekasse wird zur Verfügung gestellt, um Wolle zu kaufen, und in den Handarbeitsstunden und in der Freizeit werden Strümpfe gestrickt oder anderweitige Wollsachen angefertigt. 217,60 RM werden für das Rote Kreuz gespendet und über 100 RM den vertriebenen Ostpreußen überreicht. Zu Weihnachten werden den 15 eingezogenen Kriegern unserer Gemeinde Pakete mit Wollsachen, Pfeifen, Tabak usw. und von Kinderhand geschriebene Weihnachtsbriefe übersandt. 15 Paar Strümpfe wurden außerdem noch der kirchlichen Frauenhilfe – dem Roten Kreuz – zur Verfügung gestellt. Wie gern geben die Kinder! Der eine bringt eine Kiste Zigarren, der andere zehn Schachteln Zigaretten, ein dritter Kautabak oder mehrere Pfeifen. Es ist eine Freude, diese Zeit als Leiter einer kleinen Landschule verleben zu dürfen. Bald laufen die ersten Dankschreiben ein, und an jeden Morgen werden Briefe und Karten, die die Kinder erhalten, vorgezeigt und verlesen.
Wie leuchten die Augen der Kinder, wenn Kriegsmeldungen eintreffen und wenn nach kurzen Schulfeiern die Kinder die Schule wieder verlassen können.
[171] 1915. Trotz Mangel an Arbeitskräften wird das Land in gewohnter Weise bestellt. Größere Kinder, bejahrte Männer und insbesondere unsere Frauen verrichten Arbeiten, zu denen sie in anderen Zeiten kaum fähig gewesen wären. Leider richtet die anhaltende Dürre im Frühjahr und Sommer 1915 großen Schaden an. Während der Ernte setzt alsdann ein langanhaltender Landregen ein, so daß das Korn zum großen Teil schlecht geborgen wird. So wird die Ernte des Jahres 1915 eine völlige Mißernte. Weihnachten 1915 sind – bei einer Einwohnerzahl von 200 – 34 Militärpflichtige zum Heeresdienst einberufen. Auf Veranlassung des Lehrers wird innerhalb der Gemeinde eine Geldsammlung durchgeführt, die 101 RM erbringt, und jedem Soldaten kann ein schönes Weihnachtspaket u.a. 19 Paar Strümpfe, ins Feld geschickt werden.
1916. Gelegentlich der Schlacht am Skagerak am 31. Mai 1916, in der es der deutschen Flotte gelingt, über die weit überlegene englische Flotte einen Sieg davonzutragen, wird seitens der Behörde eine Schulfeier angeordnet.
Im Herbst 1915 und Frühjahr 1916 macht sich eine allgemeine Teuerung bemerkbar, von der jedoch unsere Landbevölkerung, die von den Erzeugnissen der Landwirtschaft lebt – und Kleidung gegen diese eintauscht – wenig und gar nicht betroffen wird. Zu Beginn bzw. vor Ausbruch des Krieges kosteten die Waren s. Tabelle, stiegen dann: s. Tabelle
Ein Zentner Schweine Lebendgewicht 45 RM – 150 Mark. Die Regierung setzt Höchstpreise fest: 60 – 114 Mark je Zentner.
Rinder je Zentner 40 Mark – 120-130 Mark, Ei 5 Pfennig – 24 Pfennig, ein Pfund Wolle 3-4 Mark – 11 Mark, ein Pfund Kaffee 1,20 Mark – 4 Mark, ein Pfund Seife 23 Pfennig – 2 Mark, 1,5 Zentner Gerstenschrot 10 Mark – 75 Mark, Ochsenfleisch 60 Pfennig – 2,50 Mark, ein Pfund Butter 1,20 Mark – 8 Mark. Die Regierung ist, um die Unzufriedenheit der Verbraucher zu beseitigen, genötigt, Höchstpreise (Kartensystem) festzusetzen: Kartoffeln Zentner 7 Mark, Butter je Pfund 2,50 Mark, Roggen je Zentner 11 Mark, Hafer 18 Mark, Buchweizen 30 Mark, Hasen je Stück 3,50 Mark, Rehfleisch ½ kg 0,70 Mark usw. Um die Hühner mit Futter zu versorgen, wird seitens der Schule eine Ährenlese durchgeführt. Gesammelte Mehlbeeren, aus denen Kaffeeersatz hergestellt werden soll, werden der Reichsstelle übersandt (Zentner 10 Mark).
1917. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten werden immer größer. Im Winter 1916/17 [172] werden die Kartoffeln äußerst knapp, so daß Steckrüben in ungeheuren Mengen als menschliche Nahrung Verwendung finden. Die sogenannten „Hamsterfahrten“ der Großstädter auf das platte Land nehmen immer mehr zu.
Um den Schleichhandel zu unterbinden, muß die Gemeinde im Frühjahr 1918 11.500 Stück Eier (je 25 Pfennig) abliefern, im Schleichhandel zahlt man 0,70 Mark.
Mai – Juni 1918. Immer größer wird die Not im Lande. In Scharen kommen die Großstädter zu uns aufs platte Land, um Brot und andere Lebensmittel zu kaufen oder zu erbetteln. Aus den bleichen und hohlen Gesichtern ersieht man die Not und das Elend der Großstadt. Die Unzufriedenheit der Landbevölkerung, hervorgerufen durch Wucher und Knappheit der Lebensmittel, durch Falschmeldungen der Presse, wächst überall im Lande, und daher schimpft jeder auf den Krieg und auf die Regierung, der zum großen Teil dieses Elend zuzuschreiben ist.
Juli – Oktober 1918. In der Heimat wütet die sogenannte „spanische Grippe“ (Unterernährung) und fordert unter Greisen, Kindern und jugendlichen Frauen manches Opfer. Um die Verordnungen kümmern sich nur noch wenige, der Wucher blüht: ein Hühnerei 1 Mark, ein Pfund Butter kostet im Schleichhandel 30 Mark. Schämen sollten sich diese Blutsauger, von denen es auch in unserer Gemeinde genug gibt und die daher mitschuldig sind, den Zusammenbruch unseres einst so starken Vaterlandes herbeigeführt zu haben. Der Herbst zieht ins Land, der Friede ist damit nicht gekommen! Den Zusammenbruch sieht man mit Riesenschritten nahen!
Die Kinder nahmen an den Zeichnungen der Kriegsanleihen [teil], z.B. vierte Anleihe 325 Mark: Bernhard Feil 20 Mark, Paul Rühmann 20 Mark, Martin Kelting 30 Mark, Albert Feil 20 Mark, Heinrich Rühmann 20 Mark, Geschwister Kröger 60 Mark, Geschwister Johs. Studt 30 Mark, Emma Steffens 25 Mark, Geschwister W. Rühmann 60 Mark, Willi Schnack 10 Mark. Zeichnungen auf die fünfte Anleihe 440 Mark, siebente Anleihe 350 Mark, achte Anleihe 580 Mark.
Als erster Frontkämpfer wird am 22.4.1915 der Arbeiter Rudolf Fölster mit dem Eisernen Kreuz II. Klasse wegen Tapferkeit vor dem Feind ausgezeichnet (Schlacht bei Moulin). Wenig später erhält dieselbe Auszeichnung der Gefreite Gustav Blunck, Sohn des Arbeiters Wilhelm Blunck, als Führer eines Stoßtrupps.
[173] Das Jahr 1918 fordert furchtbare Opfer. Der Jagdaufseher Wilhelm Strohbeen verliert in der Frühlings-Offensive seine beiden Söhne Walter und Robert (18 und 19 Jahre), die noch vor kurzem meine Schüler waren. Beim Rückzuge im Herbst geraten Wilhelm Wolters, Willi Zornig und Herrmann Blöcker in französische Gefangenschaft. Der Bauer Johannes Schnack ruht, hingerafft durch eine heimtückische Krankheit (Blinddarmentzündung), für immer in Frankreichs blutgetränkter Erde. Johannes Karstens wird auf dem Rückzuge schwer verwundet, so daß ihm sein rechtes Bein amputiert werden muß.
Am Morgen des 2. November bricht unter der Marine in Kiel die Revolution aus, die sich sehr schnell über ganz Deutschland verbreitet. Am Morgen des 2. November ziehen etwa 30 Marineangehörige durch unseren Ort; Marschrichtung Hamburg. Auf Befragen erklären sie mir, daß sie sich von ihrem Truppenteil unerlaubt entfernt hätten, weil ihnen der Urlaub verweigert wurde.
Der Eisenbahnverkehr in Wrist stockt. Der Bahnhof wird von der Marine besetzt, und auf den Bahnsteigen sind mehrere Maschinengewehre aufgestellt. Die Wache, etwa 20 Mann, liegt im Wartesaal 3. Klasse. Ich habe dringend in Neumünster zu tun. Auf Bescheinigung der Gemeindebehörde wird mir vom Soldatenrat die Benutzung der Eisenbahn erlaubt. Der Zug ist völlig überfüllt. Die Mitfahrenden, fast alles heimkehrende Soldaten, nehmen auf der Plattform, auf Trittbrettern, ja sogar auf den Dächern der Eisenbahnwagen Platz. Der Bahnbeamte macht den Soldatenrat darauf aufmerksam, daß der Zug doch vollständig überfüllt sei, doch die „Roten“ kümmern sich nicht darum und lassen den Zug abfahren. Es hat auch alles gutgegangen. – – Die Ereignisse überstürzen sich!
Auch an unserer Gemeinde geht die Revolution nicht spurlos vorüber. Nach Vorschrift muß ein sogenannter Arbeiter- und Bauernrat gebildet werden. Karl Feil, Heinrich Hahn und Wilhelm Runge werden in den Bauernrat, Wilhelm Blunck, H. Zornig und Lehrer Mohr (Schriftführer) in den Arbeiterrat gewählt. Aus Bramstedt erscheinen die Bevollmächtigten: Schatz, Sovilowski und Borre und ordnen eine Schulfeier an und befehlen die Hissung der roten Fahne. Ich lehne dieses Ansinnen mit der Begründung ab, daß ich nur der Anordnung meiner vorgesetzten Behörde Folge leiste. Auch der Gemeindevorsteher Kelting, lehnt die Hissung der roten Fahne ab.
[174] Die Mitglieder des sogenannten Arbeiter- und Soldatenrates nehmen die Posten nicht etwa an, weil sie revolutionär eingestellt sind, sondern einzig, um roten Parteibonzen einen Eingriff in unsere Gemeindeverwaltung unmöglich zu machen. Auf Veranlassung des nunmehr eingesetzten „Rates“, der über große Rechte verfügt, wird zunächst die Lebensmittelversorgung innerhalb der Gemeinde geregelt. Getreide- und Kartoffelvorräte werden beschlagnahmt und der Großstadt waggonweise zugeführt.
Im Januar 1919 sind die meisten Soldaten von ihren Truppenteilen entlassen und in ihre Heimat zurückgekehrt. Der Ort ist festlich geschmückt. Am Eingang des Dorfes ist eine Ehrenpforte errichtet. Am 11. Januar 1919 werden die heimgekehrten Krieger in der Gastwirtschaft von Peter Steenbock festlich begrüßt. An der gemeinsamen Kaffeetafel nehmen etwa 80 Personen, darunter 34 heimgekehrte Soldaten teil. Lehrer Mohr dankt in einer Ansprache den heimgekehrten Kriegern im Namen der Gemeinde für die großen Opfer, die sie der Heimat gebracht haben. Durch Vorträge, Konzert und Gesang wird hinreichend für Unterhaltung gesorgt. Ein Tanzkränzchen beendet ein schönes Fest, das schönste Fest seit langen Jahren.
In treuer Pflichterfüllung starben den Heldentod:
Heinrich Fischer verm.September 1916 a.d. Somme Brüder, Vater
Herrmann Fischer gef. 14.7.1916 Thiepval Anton Fischer, Kätner
Willi Fölster gef. 11.6.1918 Roze sur Matz Markus F. Vater
Ernst Kaack gef. 12.2.1916 St. Etiene Verlobter v.A.Harbeck
Johannes Schnack gest.31.7.1918 Feldlazarett Stenay V.Peter Schnack,Bauer
Ernst Seider gef. 26.9.1915 aux Boeux V. Hans Seider, Bauer
Hans Reimers gef. 2.10.1915 Kriegslazarett Chauny V. Reimers, Bauer
Wilh. Steffens gest.19.6.1915 Champagne V. H. Steffens, Bauer
Karl Kock gef. 25.9.1915 Dolgimar Russland V. A. Kock, Bauer
Wilh. Kock gef. 17.6.1916 Ville de Chammont “ “ “
[175]
Robert Strohbeen gef. 25.3.1918 Favreuil V. W. Strohbeen,
Walter Strohbeen gef. 16.7.1918 Chery a.d. Marne Jagdaufseher
—————————–
Wie unsere Gemeinde die Geldentwertung und den Ruhrkampf miterlebte.von W. Mohr. 1923/24.
Nach Beendigung des Weltkrieges sind die Preise der zum Lebensunterhalt erforderlichen Produkte sprungweise gestiegen, die Steuern in einem Maße emporgeschnellt, die Staatsschulden (Kriegsanleihen) haben eine solche Höhe erreicht, daß jeder vernünftig denkende Mensch sich fragen muß: „Was soll nun werden?“ Man spricht von „Teurung“, von „hohen Löhnen“, von „Kriegsgewinnen“, die Millionen erreichen. Daß diese Erscheinungen der Anfang von der größten Geldentwertung aller Zeiten werden soll, daran denkt keiner. Im April 1919 verdient ein Arbeiter monatlich 300 – 400 Mark, ein Knecht 200 Mark und die Kost. Manche Bauern unserer Gegend verkaufen den von ihren Vätern übernommenen Hof für Hunderttausende Mark, und schon nach wenigen Monaten kommen sie zu der Erkenntnis, daß eine nicht endende Geldentwertung eingesetzt hat. Die Preise steigen von Tag zu Tag.
In den Jahren 1919/21 wird die Dorfstraße bis zum Denkmal chausseemäßig ausgebaut, wodurch die Gemeinde in eine ungeheure Schuldenlast geriet. Zwecks Erledigung der Arbeiten hatte die Gemeinde zwei Schubkarren herstellen lassen. Aus dem Erlös einer einzigen Karre, die nach Beendigung des Straßenbaues verkauft wurde, konnten die Kosten des gesamten Straßenbaues begleichen werden.
Den scheinbar hohen Holzpreisen fällt der Rest des sogenannten „Hunenholzes“ zum Opfer. Der Besitzer Clahsen, Westerhorn, verkauft im Herbst 1920 den ca. 7 ha großen Waldbestand für 200.000 Mark an die Stadt Altona. Im Frühjahr 1922 ist das Geld bereits so entwertet, daß der Besitzer kaum in der Lage ist, mit dem Erlös einen kleinen Teil des Waldbestandes, rechts von der Chaussee an den Auwiesen belegen, wieder aufzuforsten.
Im Frühjahr kosten Schweine je Zentner 2.200 Mark, Mais 400 Mark, ein Pfund Reis 8,50 Mark, Kaffee 70 Mark, Butter 50 Mark, ein ha Ackerland bewertet man mit 30.000 Mark. Kartoffeln je Zentner 200 Mark.
[176] Während die Preise für Produkte um das 30-fache gestiegen sind, folgen Löhne und Gehälter bedeutend langsamer (10-fach). Die Not der arbeitenden Bevölkerung, insbesondere jedoch die der Rentner, wächst von Tag zu Tag. Viele Rentner überlassen ihr Grundvermögen – Haus und Garten – einem Bauern, der ihnen dafür ein Altenteil auf Lebenszeit gewährt.
Frühjahr 1923.
Nachdem das deutsche Volk die übernommenen untragbaren Lasten des Versailler Friedensdiktates nicht mehr aufbringen kann, besetzen die Franzosen das Ruhrgebiet. Die Arbeiter leisten passiven Widerstand usw. Viele Ruhrkinder finden in unserer Provinz Schleswig-Holstein Aufnahme, davon alleine im Kreis Segeberg 1.200. In unserer Gemeinde nehmen Heinrich Hahn zwei, Lehrer W. Mohr und Gustav Blunk je ein Kind aus dem Ruhrgebiet auf. Die allermeisten Bauern haben die Schwere der Zeit scheinbar noch nicht erfaßt! Alle vier Kinder entstammen Bergarbeiterfamilien. Die „Ruhrspende“ in unserer Gemeinde erbringt: 40 Zentner Roggen und 350.000 Mark in bar. Viele Gemeindemitglieder geben gern und mit Freuden, um den Notleidenden im Ruhrgebiet zu helfen, und um sie im Kampf zu stärken. Leider sind auch diese Opfer umsonst gewesen.
Sommer 1923.
Die Armut im Volke steigt mit der zunehmenden Geldentwertung. Die Geschäftsanteile der Spar- und Darlehnskasse e.G.m.u.H. werden für je Mitglied auf zwei Milliarden Mark erhöht. Für Geld wird pro Tag 5 – 10 % Zinsen berechnet. Die Löhne können bei weitem der schnellen Geldentwertung nicht folgen, und viele sozial eingestellte Bauern zahlen den Lohn in Form von Sachwerten. Ein Knecht bekommt z.B. monatlich zwei Zentner Roggen als Lohn. Die Bauern gehen dazu über, ihre Schweine und Ochsen gegen Korn (ein Zentner Lebendgewicht – sechs Zentner Getreide) zu verkaufen. Papiergeld bis zum Werte von hunderttausend Mark wird kistenweise als Altpapier an Produktenhändler verkauft. Für eine Million Mark erhält man eine Schachtel Streichhölzer. Als damaliger Geschäftsführer der Spar- und Darlehnskasse gehen mir Unsummen durch die Hände, meine Frau und ich zählen und rechnen oft bis morgens vier Uhr, ohne die ungeheure Tagesarbeit erledigt zu haben. In jeder Woche fährt einer von uns mehrfach zur Landesgenossenschaftsbank in Altona, um die vielen Milliarden Mark möglichst schnell wieder einzuzahlen. Diese ungeheure Arbeit wäre [177] nicht mit Geld zu bezahlen gewesen! Doch am Monatsschluß reicht die Entschädigung nicht, um die Lichtrechnung zu begleichen.
Oktober 1923.
Schon zahlt man in Hamburg und auch in vielen hiesigen Geschäften mit der „Hamburger Goldmark“, einem wertbeständigen Zahlungsmittel. Jeden Mittag gibt die Reichsbank den Kurs des Papiergeldes bekannt und recht oft ist der Wert desselben in einem Tage um 100 % gefallen. Mancher geht dazu über, sein Geld bald möglichst in Sachwerten: Baumaterialien, Futtermittel, Kleidung und Genußmittel anzulegen. Fast jeder Bauer unserer Gemeinde hat einige hundert Zentner Futtergetreide gelagert, so daß hier und da die Kornböden die Vorräte kaum zu fassen vermögen. Mit Vorliebe wird mit kurzfristigen Wechseln, die auf Milliarden und Billionen Mark lauten, bezahlt, obgleich für diese Unsummen täglich bis 15 % an Zinsen verlangt werden.
November 1923.
Durch Einführung der sogenannten Rentenmark wird endlich ein wertbeständiges Zahlungsmittel geschaffen. Eine Billion Papiermark = eine RM. Anfangs bringt mancher diesem neuen Zahlungsmittel das größte Mißtrauen entgegen, und so zahlt man noch Anfang November für einen Zentner Schweine 80 RM oder 160 Billionen Papiermark. Der Bauer Johannes Kröger liefert zwölf Schweine ab und erzielt für 30 Zentner Lebendgewicht 4.800 Billionen Papiermark, also rund 5.000 RM. Dieses Glück ist allerdings nur einzelnen zuteil geworden.
Aber schlecht geht es Spekulanten, die Futtermittel auf Wechsel gekauft haben. Ich erinnere einen Fall, wo ein Bauer 100 Zentner Gerste zu 18 Billionen Mark je Zentner gekauft hatte. Die Laufzeit des Wechsels dauerte 30 Tage. Das Konto wurde bei Fälligkeit des Wechsels – 15 % Tageszins – zuzüglich Zinsen in Höhe von 8.100 Billionen Mark mit 9.900 Billionen Mark belastet. Da der Bauer diesen Betrag nicht sofort abdecken konnte und trotz der Stetigkeit der Währung Banken noch immer Tageszinsen von 2 – 3 % in Rechnung stellten, hatte der Bauer, verursacht durch 100 Zentner Gerste, in kurzer Zeit eine Schuldenlast von 20.000 RM. In den nächsten Monaten sank dann der Zinsfuß von 48 auf 24 und schließlich auf 12 und 8 % p.a.. Viele Bauernhöfe überschuldeten (Ursache Wucherzins der Banken) und gelangten zur Zwangsversteigerung. Die Erbitterung vieler Bauern steigt von Tag zu Tag!
[178] Die Bauern unserer Gemeinde haben ihr Geld in Sachwerten angelegt, sich jedoch von gefährlichen Spekulationen ferngehalten. Ohne Frage hat die im Jahre 1921 auf Veranlassung des Lehrers Mohr gegründete Spar- und Darlehnskasse e.G.m.u.H. in diesen Jahren etwas Hervorragendes geleistet und manchen Bauern vor unüberlegten Schritten bewahrt.
1924.
Die Wucherpreise sinken infolge des Überangebotes und der mangelnden Kaufkraft der breiten Masse. Die Schweinepreise gehen von 80 RM je Zentner rapide auf 60, 50, 40, 35 RM zurück, die Rindviehpreise sinken von 80 auf 32 RM. Im Sommer richtet die Maul- und Klauenseuche großen Schaden unter den Viehbeständen an, so daß viele, vor wenigen Monaten noch so reiche Bauern Verluste über Verluste erleiden, die sie schwer überwinden werden!
Die Hauptgenossenschaft Kiel stellt der Spar- und Darlehnkasse hohe Gräser- und Schweinemastkredite zur Verfügung, wodurch es unseren Bauern ermöglicht wird, den Viehverkauf bis zum Eintritt steigender Preise hinauszuschieben. Große Verluste, die überall in der Landwirtschaft wahrzunehmen sind, treten bei den Bauern unserer Gemeinde nicht ein.
Von der Jagd.
Wie schon an anderer Stelle erwähnt, befanden sich in unserer Gemarkung ausgedehnte Wälder und zwar besonders im „Oster“, wo die nunmehr gerodeten Weiden noch mit Wald und Kratt bewachsen waren, im sogenannten „Herrenholz“, im „Hinkenholz“ und „Ohlen Wiesch“. Trotz dieser großen Waldbestände waren Rehe und Hirsche bei uns nicht beheimatet. Erst nachdem die Segeberger- und Lutzhorner Heide aufgeforstet worden waren, also in der letzten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wechselten Rehe, die insbesondere im Frühjahr und Sommer in den Bramauwiesen gute Äsung fanden nach unseren Wäldern hinüber, um sich schließlich bei uns als Standwild niederzulassen. Der alte Johannes Blöcker erzählte mir, daß er als 12jähriger Knabe im Jahre 1872 zwei Rehe in unserer Gemarkung erstmalig gesehen hat. Reichlich waren zu damaligen Zeiten die Bestände an Hasen, Rebhühnern, Schnepfen und Enten. Weite Flächen waren noch Unland, die [179] Bramauniederung war noch nicht reguliert und der Kunstdünger in der Landwirtschaft noch unbekannt. Dem einheimischen Wild war hinreichend Nistgelegenheit, Schutz und Ruhe gegeben. An der Au mit den vielen Rethscharten und Schilfbeständen nisteten alljährlich viele Enten und andere Wasservögel. Fasanen wurden zum ersten Male durch Hamburger Jagdgesellschaften in unserer Gemeinde um die Jahrhundertwende ausgesetzt, vermehrten sich alsdann jedoch sehr schnell, so daß sie bereits nach wenigen Jahren als Standwild angesprochen werden können. Mein Vater, der Landmann Claus Mohr in Weddelbrook, Pächter der benachbarten Gemeindejagd, erlegte ums Jahr 1895 seinen ersten Fasanenhahn, den er ausstopfen ließ. Wir Kinder wunderten uns über den hübschen Vogel. Auch Birkwild kam in unserer Gegend vereinzelt vor, insbesondere im „Neuen Moor“, wo es mir vergönnt war, drei dieser schönen Vögel zu erlegen (1919). Ob in früheren Zeiten die Füchse bereits schon so zahlreich aufgetreten sind, habe ich leider nicht erfahren können.
Bis zum Jahre 1866, also in der Zeit vor der Vereinigung unserer Heimat mit Preußen, hatte jeder Grundbesitzer das Recht, auf seinem Grund und Boden zu jagen. Daß unter solchen Umständen die Jagd schwer zu leiden hatte, ist allzu verständlich. Nachdem auch das preußische Jagdgesetz bei uns Geltung erlangte, wurde es besser. Die Gemeindejagd war viele Jahre an einen gewissen Kröger aus dem benachbarten Bramstedt verpachtet. Die fürs Jahr zu zahlende Pacht betrug 20 Thaler. Geschossen wurde zu damaligen Zeiten mit dem einläufigen Vorderlader. Pulverhorn, Zündhütchen, Schrot und Ladestock gehörten zur Ausrüstung des Jägers. Erst ums Jahr 1890 bürgerte sich die Vogelflinte (Hinterlader) in Jägerkreisen immer mehr ein. Im Jahre 1877 schlossen sich mehrere Bauern unserer Gemeinde zusammen (Hans Rühmann, Hinrich Steffens, Cl. Reimers), um die Jagd selbst auszuüben. Der Pachtzins betrug 200 Mark p.a.. Der Wildbestand hatte sich bedeutend gehoben, so daß in jedem Jahre durchschnittlich erlegt wurden: 150 Hasen, 300 Rebhühner, 50 Enten und in späterer Zeit bis 15 Stück Rehwild. Wildkaninchen waren hier nicht heimisch und wurden ums Jahr 1890 durch Graf Luckner in Bimöhlen erstmalig in unserer Heimatprovinz ausgesetzt und haben sich von hier aus schnell verbreitet. Wohl wurden auf Anstand oder auf Treibjagden gelegentlich Füchse erlegt, doch im [180] allgemeinen kümmerte sich niemand um die Niederhaltung des Raubwildes und um die Hege des Wildes. Alles Wild, welches vor den Lauf kam, wurde mit der Schrotflinte erbarmungslos zur Strecke gebracht. Als eifrige Nimrode sind der Hufner Peter Schnack und der Gastwirt Peter Steenbock zu erwähnen. Beide Jäger verfügten bereits damals über erstklassige Jagdhunde. Der Jagdschein kostete zu damaligen Zeiten drei Mark.
Infolge von Neid und Abgunst der Bauern unter sich, wurde die Gemeindejagd im Jahre 1903 an einem hamburger Kaufmann namens Thode für 2.100 Mark p.a. verpachtet und P. Steenbock mit der Beaufsichtigung derselben betraut. Im Jahre 1905 überließ Thode die Pachtung dem Brauereibesitzer Ludwig Dorn aus Kellinghusen. Dieser war äußerst entgegenkommend und erlaubte es den ansässigen Jägern – auch mir – die Jagd auszuüben. Manche frohe Stunde haben wir in diesen Jahren im Kreise der Kellinghusener Jäger verlebt.
Als im Jahre 1911 die Pachtperiode abgelaufen war, wurde die Jagd meistbietend auf sechs Jahre für 2.050 Mark p.a. an den hamburger Jagdverein „Hubertus“ verpachtet. Die hamburger Jäger haben sich in unserer Gemeinde keiner besonderen Beliebtheit erfreut und behandelten die Bauern von „oben herab“. Ihr Jagdaufseher Strohbeen – von Beruf Musiker -, der bereits einige Jahre vorher von der Gemeinde die „alte Schulkate“ käuflich erworben hatte, galt als vorbildlicher Jäger und Heger. Mit großem Eifer und Erfolg fing er das Raubwild, errichtete Futterplätze und hegte das Wild. Im Jahre 1912 fing er in der Gemarkung ca. 40 Füchse, über 100 Wiesel, etwa 15 Iltisse, mehrere Marder und 2 Fischotter. Daß sich unter dieser vorbildlichen Hege der Wildbestand schnell hob, ist selbstredend. Die Jahresstrecken erreichten bei 200 Hasen, 3 gute Rehböcke, 200 – 300 Fasanen und vieles mehr. Im Jahre 1913 mußte die Treibjagd wegen Munitionsmangel vorzeitig abgebrochen werden, waren doch allein in einem Waldtreiben rund 350 Fasanen geschossen worden. Die Kaninchenplage nahm von Jahr zu Jahr zu. Ich schätze die Zahl der vom Jagdaufseher im Laufe eines Jahres erlegten Kaninchen auf ca. 700 Stück. Unter diesem Wildreichtum hatte die Landwirtschaft schwer zu leiden, und so kann man es wohl verstehen, wenn der Wunsch laut wurde, die Gemeindejagd wieder an Ortsansässige zu verpachten. So kam es, daß die Jagd ab 1.4.1918 für 700 Mark an den ins Leben gerufenen „Jagdverein Föhrden Barl“ verpachtet wurde. Allzu viele Jäger und wenig Heger traten dann dem jungen Verein bei, wodurch die Jagd [181] zu leiden hatte. Die Jahresstrecke betrug etwa: 10 Rehböcke, 100 – 120 Hasen, 150 Rebhühner, 40 Fasanen, 30 Enten. Die Raubtiervernichtung wurde ganz besonders von Heinrich Hahn und Wilhelm Mohr ausgeübt. Durch die vielen Jäger konnte die herrschende Kaninchenplage schnell behoben werden.
Um die darniederliegenden Jagden zu heben, wurde auf Veranlassung des Lehrers Mohr wurde im Jahre 1924 der „Hegering Mittelholstein“ ins Leben gerufen. Durch diese Neugründung wurden sämtliche Jagden des westlichen Teiles unseres Kreises zusammengeschlossen. Der Hegering erstrebte eine waidmännische Ausübung der Jagd, eine allseitige Wildhege und -fütterung, einen geregelten Lockabschuß, eine allseitige Raubwild-, sowie Krähen- und Elsternvertilgung, Züchtung hochwertiger Jagdhunde, die Blutauffrischung des Hasen- und Fasanenbestandes usw. In jedem Jahre fand eine Trophäenschau statt, die regelmäßig sehr gut besucht wurde.
Was der Hegering anstrebte, brachte uns dann das neue Jagdgesetz der nationalsozialistischen Regierung. Wir Jäger können unserem Reichsjägermeister Hermann Göring nur aus vollem Herzen dankbar sein!
Bei der Neuverpachtung der Föhrdener Gemeindejagd im Jahre 1928 mußte der Pachtpreis auf 1.200 Mark erhöht werden. Da der Wildmangel jedoch von Jahr zu Jahr spürbarer wurde, erfolgte durch das Pachteinigungsamt beim Amtsgericht in Bad Bramstedt eine Herabsetzung des Pachtzinses auf 840 Mark. Trotz größter Hege war es leider nicht möglich, den Wildbestand wesentlich zu heben. Die Jahresstrecke erbrachte ca.: 80 Hasen, 70 Rebhühner, 20 Fasanen, 30 Enten und 200 Kaninchen, sowie 6 Stück Rehwild.
Nach Ablauf der Pachtperiode erfolgte Weiterverpachtung der Jagd an den Jagdverein, der sechs Mitglieder zählte, für 700 RM p.a.. Wegen Unstimmigkeit innerhalb der Mitgliederschaft löste sich im Jahre 1936 der Jagdverein auf, und die Verpflichtungen des Vereins wurden von Gustav Blunck und Wilhelm Mohr übernommen. Diese üben gemeinsam mit J. F. Krohn, Hamburg, die Jagd aus. Auch weiterhin nimmt der Wildbestand – ausgenommen Rehwild – Bestand 60 – 70 Stück – von Jahr zu Jahr ab, so daß sich die Pächter genötigt sahen, in den Jahren 1939/40 und 1940/41 keine Treibjagden abzuhalten.
Jahresstrecke 1940/41: 25 Hasen, 3/7 Rehwild, 20 Rebhühner, 10 Fasanen, 5 Enten, 13 Füchse.
eingetragen im Dorfbuch 21.1.1941.
[182] Feuersbrünste während der letzten 100 Jahre.
In den letzten 100 Jahren wurde unser Dorf mehrfach von Feuersbrünsten heimgesucht. Ums Jahr 1850 brannte, nach Berichten alter Leute, der Schafstall der Bauernschäferei in Barl – der auf der Hauskoppel des Erbhofbauern Hahn / Schwartzkopff (damaliger Besitzer war Reimers) stand, vollständig nieder. Der Brand soll durch unvorsichtiges Umgehen des Schäfers mit einer Stallaterne gewesen sein. Viele Schafe fanden den Tod in den Flammen. Der Schäfer, der nur das nackte Leben rettete, wurde wahnsinnig und starb in der Irrenanstalt.
23.3.1883 fiel das Haus des Webers und Gastwirtes Peter Steenbock dem Feuer zum Opfer. Der
Neubau wurde nach dem Grundriß des alten Gebäudes errichtet. Ursache des Brandes:
fahrlässiges Hantieren mit der Lampe.
Im Juni 1875 wurde das Gehöft des Vollhufners Reimers durch Blitzschlag eingeäschert. Das Gebäude
wurde damals in seiner jetzigen Form neu errichtet.
Im März 1892 durch Brandstiftung des Eigentümers wurde das Gewese des Kätners Röth vernichtet und
nicht wieder aufgebaut (Heidekate III). Um einen Torfdiebstahl zu verheimlichen, hatte Röth
das Feuer gelegt. Er wurde zu fünf Jahren Zuchthaus verurteilt.
Im Dezember 1897 brannte das Gewese des Vollhufners Johannes Runge, der die Ländereien parzelliert hatte
und nach Neumünster verzogen war, vollständig nieder. Mutmaßliche Ursache:
Brandstiftung durch den Mieter, der einen Versicherungsbetrug zu begehen gedachte.
28. August 1933 Am 28. August 1933 wurde unsere Gemeinde durch eine furchtbare Feuersbrunst
heimgesucht. Der Kornschuppen, der vollständig mit Getreide ge-füllt war und das mit Stroh
gedeckte Wohnhaus des Bauern Heinrich Schnack brannten nieder. Durch Eingreifen der
Wrister und Kellinghusener Feuerwehren mit ihren Motorspritzen war es nach schwerer
Arbeit möglich, das Wirtschaftsgebäude und das Viehhaus mit harter Bedachung, gefüllt mit
Futter- und Getreidevorräten, zu retten. Als die Decke bereits zusammenzubrechen drohte,
sprang ich noch schnell in die Stube und rettete so die alte wertvolle Wanduhr.
Brandursache: vermutlich Selbstentzündung oder Kurzschluß. Deckung des Brandschadens
– ca. 20.000 RM – durch die Neuendorfer Brandgilde.
[183]
Am 31.8.1934 nachmittags vier Uhr ertönte das Feuerhorn. Als ich – Mohr – auf die Straße trat, bemerkte
ich in südlicher Richtung mächtige Rauchwolken, die ein Großfeuer vermuten ließen. Das
Gehöft des Erbhofbauern Heinrich Rühmann stand bald darauf in hellen Flammen. Ich
schwang mich schnell aufs Rad und war einer der ersten an der Brandstätte, so daß ich
eifrig an den Rettungsarbeiten teilnehmen konnte. Das gesamte lebende und tote Inventar
wurde gerettet, dagegen fielen die gesamten Erntevorräte dem Feuer zum Opfer. Sämtliche
Feuerwehren, die erst kürzlich zur „Freiwilligen Feuerwehr des Amtsbezirkes
Weddelbrook“ zusammengeschlossen waren, waren bald zur Stelle und ebenso hatte sich
auch die Wrister Feuerwehr mit ihrer Motorspritze eingefunden. Wegen Wassermangel
mußte die Bekämpfung des Feuers eingestellt werden, und man beschränkte sich auf den
Schutz des Nachbargebäudes. Wäre rechtzeitig genügend Wasser zur Stelle gewesen, so
wäre meines Erachtens der Wohnflügel mit Leichtigkeit zu retten gewesen. Den Schaden,
den ich auf ca. 15.000 RM schätze, hatte die Landesbrandkasse zu tragen.
Brandursache: vermutlich Selbstentzündung durch allzu frisch eingefahrenen Hafer.
ins Dorfbuch eingetragen: 23.1.1941. Mohr.
Denkmäler der Gemeinde.
Die ältesten Denkmäler unserer Gemeinde sind die Hünengräber auf dem „Fierth“, die ums Jahr 1935 von der Schuljugend mit Birke bepflanzt und auf Antrag des Lehrers Mohr unter Naturschutz gestellt wurden.
Der Krieg 1870/71 brachte für unsere Gemeinde keine Opfer. Nach Heimkehr der Krieger pflanzte man zwei Friedenseichen und zwar auf den Dreiangeln bei Gastwirt Peter Steenbock und vor der Hofstelle des Bauern Schnack.
Auf Anregung verschiedener Gemeindeangehöriger beschloß man in einer Versammlung, durch freiwillige Spenden die Mittel zum Bau eines Gefallenenehrenmales, das für ewige Zeiten an die großen Blutopfer des Weltkrieges 1914/18 erinnern sollte, zu beschaffen. Die bald darauf durchgeführte Sammlung erbrachte 3.500 Mark, der Jagdverein stiftete 650 Mark. Den Rest der Baukosten, die auf 5.000 Mark veranschlagt wurden, wollte die Gemeinde übernehmen. Nach vielem Hin- und Herreden wurde man sich schließlich darüber einig, das Denkmal nach Fertigstellung der Chaussee auf dem [184] Dreiangel vor Wilhelm Runges „Schulenbrook“ zu errichten. Leider war der Bauer Heinrich Reimers, der doch von seinem im Weltkrieg gefallenen Bruder Hans Reimers die Vollhufe geerbt hatte, nicht bereit, einen günstigeren Platz zur Verfügung zu stellen und auch andere Grundbesitzer, die doch auch unseren Toten Dank abzustatten hatten, lehnten ebenfalls ab. Das Denkmal wurde von der Firma Kolbe, Itzehoe, hergestellt. Die Baukosten erhöhten sich infolge der Geldentwertung auf 9.000 Mark.
Am Sonntag, den 3. Oktober 1920 wurde das neu errichtete Denkmal feierlich enthüllt. Die ganze Gemeinde und viele Auswärtige nahmen an dieser Feier teil. Ein Festzug, wie ihn die Gemeinde bisher wohl nie gesehen hat, bewegte sich unter den Klängen einer Musikkapelle zum Denkmal: voran die Eltern der Gefallen, dann folgten: die Gemeindevertretung, der Kriegerverein Wrist mit ihrer Fahne, Gemeindemitglieder und Festteilnehmer und zum Schluß marschierte die Schule.
Nachdem der damalige Gemeindevorsteher Karl Feil mit kurzen Worten das Denkmal enthüllt hatte, hielt Pastor Paulsen, Bad Bramstedt, die Festrede. In rührenden Worten gedachte er der Toten des Weltkrieges und richtete an alle die Mahnung, nicht zu verzagen, sondern am Aufbau unseres armen und von aller Welt verachteten Vaterlandes mitzuwirken. Tierarzt Dr. Hein, Kellinghusen, brachte als zweiter Redner ein Hoch auf unsere engere Heimat aus. Seine Rede gipfelte in dem Spruch Schillers: „Ans Vaterland, ans teure schließ dich an!“.
Schöne, passende Lieder wurden von den Schülern und einem Chor junger Mädchen gesungen und zu Herzen gehende Worte in Gedichtform von Kindern deklamiert. U.a. „für uns!“ und „Den Gefallenen“.
Es war eine stille aber schöne Feier, und allen Anwesenden wird dieser Tag zeitlebens in Erinnerung bleiben.
Von der „Imkerei“ vor 100 Jahren.
Wie ich zu Beginn meiner Amtstätigkeit (1907) von alten Leuten unserer Gemeinde erfahren habe, betrieb man in unserem Dorfe in früheren Zeiten von Haus zu Haus „Imkerei“. Die Flora unserer Gemarkung lieferte den Bienen zu jeder Jahreszeit eine unerschöpfliche Bienenweide. Im Frühjahr boten die Weiden, die überall im Sumpfe wuchsen [185] und das Wiesental umsäumten, reichliche Nahrung. Viele Felder waren damals noch mit Buchweizen bestellt und weite Flächen mit Heide bewachsen. Großimker brachten ihre Bienenvölker im Frühjahr per Fuhrwerk zur Rapsblüte in die Marsch, um sie Ende Mai – bei Beginn der Schwarmzeit – nach beendeter „Tracht“ wieder heimzuholen. Nach der Schwarmzeit begann die Buchweizentracht, und im Herbst wurden die Völker, die sich nunmehr um das drei- bis vierfache vermehrt hatten, in die Weddelbrooker – Lutzhorner Heide, die besonders gut honigte, befördert. Die Imker mußten allerdings alljährlich damit rechnen, daß ihnen die schwersten Stöcke gestohlen wurden. Als Bienenwohnung benutzte man den selbstgeflochtenen Strohkorb, der gegen die Kälte des Winters Schutz gewährte. Um den Waben Halt zu geben, wurde der Korb „gespeilt“. Jedes Bienenvolk lieferte einen Vor- und mehrere Nachschwärme, so daß nach Zusammenschüttung von mehreren Nachschwärmen die Völker um mindestens das dreifache vermehrt wurden. Der Bienenstand, der sogenannte „Bienenhaagen“ befand sich meistens im Garten oder auf der Hauskoppel, hatte den Grundriß eines Rechtecks, war also nach allen Seiten geschlossen und schützte so gegen Wind und Wetter. Um den Honig zu ernten, mußten die Bienen getötet, „abgeschwefelt“ werden. Als Delikatesse galt der Beck- und Scheibenhonig. Die mit Honig gefüllten Waben stampfte man in einer großen Tonne und preßte sie in der Honigpresse aus. Aus den alsdann verbleibenden Überresten wurde mit Vorliebe „Meth“ gewonnen. Das Wachs wurde mit kochendem Wasser ausgepreßt, in Formen gegossen und für 1,20 Mark das Pfund verkauft. Für den Honig erzielte man einen Preis von 40 – 50 Pfennig das halbe Kilogramm. Wenn man bedenkt, daß ein tüchtiger Imker nicht selten 20 – 30 Zentner Honig erntete, so bedeutete der Erlös aus Honig immerhin eine bedeutende Einnahme.
Die heutigen Kästen mit beweglichen Waben, Honigschleuder usw. waren zu damaligen Zeiten noch völlig unbekannt.
Noch heute sieht man in der Heide und am Rand der Wälder von Imkern aufgeworfene Erdwälle, die man in früheren Zeiten als Bienenstock benützte.
Ums Jahr 1860 betrieben in unserem Dorfe Bienenzucht:
Anzahl der Bienenvölker im Herbst also
Der Bauer Mus, Heidekaten, ca. 25 Stück ca. 75 Völker
“ “ Koopmann in Föhrden “ 22 “ “ 66 “
“ Weber Steenbock “ “ “ 24 “ “ 72 “
“ Händler Kahn, Barl “ 50 “ “ 150 “
Rühmann, Soth, Köhnke, Blöcker
und andere “ 40 “ “ 150 „.
Im Jahre 1940 wurden in unserem Dorfe noch 17 Völker gezählt, Herb. Schnack 14, H. Rühmann 3 Völker.
[186] Moore vergehen, neue Moore entstehen (W. Mohr, 1943.)
Am Rande der Segeberger Heide (seit 1880 Forst) liegen bekanntlich viele kleine und größere Moore, die unsere Heimat mit Torf versorgen, den Wasserstand unserer Auen und Bäche regulieren und einen vorteilhaften Einfluß auf das Klima unseres Landes ausüben. In den letzten Jahren bezog die Gemeinde die Feurung für die Schule vom „Torfwerk Weide“ und vom Lentföhrdener Moor. Einst war die Torfgewinnung eine lohnende Nebenbeschäftigung der armen Torfbauern. Noch ums Jahr 1900 fuhren fast täglich mehrere Torfbauern aus Hartenholm durch unser Dorf, um ihre Ware in Kellinghusen abzusetzen.
Die Moore entstanden nach der Eiszeit im Laufe von rund 20.000 Jahren. Viele dieser Moore wachsen noch heute, und so entstanden mächtige Hochmoore.
Auch in unserer Gemarkung, am Wege nach Stellau in der sogenannten „Salekuhle“ entsteht ein neues, wenn auch kleines Moor. Der Tümpel ist bereits zum großen Teil mit Weiden, Reth, Binsen und anderen Wasserpflanzen zugewachsen. Von Jahr zu Jahr bewächst diese Kuhle weiter mit Moos und Wasserpest, und nur in der Mitte befindet sich noch eine kleine freie Wasserfläche. Noch brüten hier in jedem Frühjahr Enten und Wasserhühner. Doch wie lange noch? Die „Salekuhle“, die einst eine Krümmung der Au gewesen sein mag, ist in der Mitte noch ein bis zwei Meter tief, doch unergründlich. Wenn die Moorschicht in der Kuhle in jedem Jahre nur zwei Zentimeter zunimmt, wird hier nach 50 – 60 Jahren ein neues Moor entstanden sein. Welcher Bauer wird hier zum ersten Male Torf backen? Noch vor etwa 60 Jahren lag von „Wieten Moos“ an rechts und links der jetzigen Hagener Chaussee, ein bereits damals abgegrabenes „Moor“, daß sich aus vielen einzelnen Parzellen zusammensetzte. Durch Moordammkultur und Tieflockerung mittels Dampf-Pflug (1910) hat man diese Flächen kultiviert. Auch auf dem jetzigen „Schwatten Moor“ wurde noch ums Jahr 1880 Torf, besonders „Plaggentorf“ gestochen. Auch dieses Moor wurde durch Moordammkultur und anschließende Bemergelung urbar gemacht. Jetzt befindet sich hier eine der besten Jungviehweiden unserer Gemarkung.
Das Lentföhrdener Moor wurde laut Torfbuch des Vollhufners Fock (Schnack) von der Gemeinde Lentföhrden gekauft und parzellenweise an die Vollhufner der Gemeinde verteilt (1812).
[187] III. Volkskundliches
A. Sitte und Brauch, Glaube und Aberglaube, Zaubersprüche, Volkstrachten]
Vor 200 – 300 Jahren lebten die Bauern unseres Dorfes in jeder Beziehung einfach. Im Hausstande wurde zur Hauptsache nur das verbraucht, was man selbst erzeugte. Um sechs Uhr morgens wurde, nachdem man bereits zwei Stunden der Arbeit nachgegangen war, die erste Mahlzeit eingenommen. Am Tisch versammelten sich der Bauer mit seiner Familie und das Gesinde. Den ersten Platz am Tische nahm der Großknecht ein, dann folgten dem Range nach: Kleinknecht, Kuh- und Gänsehirte usw. Bei Tisch herrschte peinliche Ordnung. Nach einem vom Großknecht gesprochenen Tischgebet begann das Essen. Die gebratenen Buchweizenklöße oder Bratkartoffeln wurden direkt aus der Pfanne, die mitten auf dem Tische stand, gegessen. Außerdem bestand die Morgenkost noch aus einer kräftigen Milchsuppe. Alle aßen auch diese aus einer großen „Kumme“. Gegessen wurde mit Hornlöffeln, die jeder selbst zu reinigen hatte. Auch das Mittagessen war sehr einfach. Das Rauchfleisch oder der geräucherte Speck wurden auf dem Tisch oder einem Holzteller zerschnitten. Man aß wieder aus gemeinsamen Schüsseln. Die beliebteste Mahlzeit war „Klüten und Stipp“. Am Abend gab es dieselbe Mahlzeit wie am Morgen. Nur am Sonntag gab es etwas besonderes, nämlich meistens „Großen Hans“, den berühmten Mehlbeutel.
Zu Hochzeiten und Totenfeiern wurden die Verwandten und die ganze „Naverschupp“ eingeladen. Dann waren die Tische auf der großen Diele mit weißen, selbst angefertigten Linnentischtüchern belegt. Das Festessen bestand stets aus Wiensupp mit Korinthen und dem „Weizenstuten“. Zu Ehren des Tages wurde mit silbernen Löffeln, die sich alle Gäste mitbrachten, gegessen. An dem Leichenbegängnis nehmen alle Bauern des Dorfes und der Umgebung teil und nicht selten bestand das Gefolge aus 40 – 50 Wagen. Getränk: selbstgebrautes Braunbier.
Auch die Kleidung unserer Vorfahren war äußerst einfach. Die alltägliche Kleidung bestand bei den Männern aus einem Linnenkittel, die Frauen kleideten sich in selbstverfertigten beiderwandschen Kleidern. Ganz anders war die Festkleidung. Diese bestand aus schwarzen Halbschuhen mit silbernen Spangen, [188] dunkelblauen Strümpfen, kurzen hirschledernen Hosen mit silbernen Knöpfen, einer roten Weste aus Beiderwand, einem seidenen rotbunten Halstuch und einer bis zur Hüfte reichenden beiderwandschen dunklen Jacke mit silbernen Knöpfen, dem sogenannten „Kamisol“. Als Kopfbekleidung trugen die Männer am Alltag meistens eine Zipfelmütze, den sogenannten „Ackermann“, am Sonntag dagegen einen dreieckigen Filzhut, den „Dreehot“, der ums Jahr 1840 dem fußhohen „Zylinder“ Platz machen mußte. Bei Festlichkeiten rauchten die Männer eine mit Silberbeschlag verzierte Meerschaumpfeife. Der Tabak befand sich in einem gestickten Tabaksbeutel. In den Wirtschaften stand stets ein gefüllter Tabakskasten auf dem Tisch.
Die Kopfbedeckung der Frauen war eine kleine mit Blumen bestickte und mit Silber durchwebte „Bauernmütz“, die durch zwei breite seidene Bänder unter dem Kinn zusammengebunden wurde. Ferner trugen die Frauen schwarze beiderwandsche oder seidene Jacken und bunte Halstücher. Den ebenfalls schwarzen oder braunen beiderwandschen Rock zierten mehrere Samtstreifen; denn dem Range nach trug die Frau des Vollhufners vier, die Frau des Insten drei, das Großmädchen zwei und das Kleinmädchen einen Samtstreifen am Rocke. Die Halbschuhe waren, wie bei den Männern, mit silbernen Schnallen geziert.
Diese Trachten trugen die Bauern unserer Gemeinde ungefähr bis zum Jahre 1835. Der Bauer Timm Studt, geb. 1806, und Paul Rühmann, verheiratet 1825, trugen auf ihren Hochzeiten diese Trachten, und ihre Nachkommen zeigten mir dieselben noch im Jahre 1908. Die silbernen Knöpfe und Spangen hat man leider später zu Broschen und Schmuckstücken für die Töchter umarbeiten lassen.
[S. 229. Zwei Zeichnungen Bauenrhaus (Ansicht/Grundriß) Vollhufe Fock/Schnack]


[230] Flurgemeinschaften
Wie aus dem Hausbriefe der Familie Reimers aus dem Jahre 1785 und den Güterauszügen der Vollhufner Johann Fock und Marx Böy vom 17. April 1783 hervorgeht, wurden im Jahre 1781 die Flurgemeinschaften der Gemarkung Föhrden Barl unter den Bauern gleichmäßig verteilt, die Koppeln wurden umwallt und die Entwässerung wurde geregelt. Bei Fällen, in denen keine gerechte Ver- bzw. Aufteilung (Beekwiesch) vorgenommen werden konnte, erfolgte eine anderweitige Regelung. So finden wir die Vollhufe Kruse im: „Oster“ und „Brookwisch“ nicht vertreten, dafür fiel das „Hinkenholz“ und „Langer Hof“ an diesen Besitz.
Vor 1781 bestanden in unserer Gemarkung folgende Flurgemeinschaften:
Ohlen Barlt, Barlhoop, Lütjen Barlt, Wieten Moos, Dat Moor, Wiert und Osterfortkamp. Westerkamp, Hager Kamp, Kartenkamp, Hollm, Ruggenbusch, Hinkenholz, Immenbusch, In de Millers, Bredenwisch, Feldwisch, Im Rohr, Dohrhof, Steenkuhl, Depe Wisch, Herrenholz, Schmalwisch, Lieschwisch, Stapelkamp, Lütje Koppel, Brookwisch, Blockhorn, Oster. Ohl Föhrden, Kamp, Bentwisch, Langenstück, Steenkamp, Beekwisch, Schwarzes Moor. Die Bedeutung und der Sinn der Namen der einzelnen Flurgemeinschaften zu erklären, bereitet keinerlei Schwierigkeiten.
Ich lasse nunmehr eine Verteilung der Ländereien, wie sie im Jahre 1781 erfolgte, folgen. Wie aus dem damaligen Güterauszug der Vollhufe Marx Böy, jetzt Studt, zu ersehen ist, befindet sich bei dem Besitz viel Unland. Die Wiesen an der Bramau sind noch nicht ausgebaut und bestehen aus Sandhügeln, die von den Fluten der Au aufgeworfen waren – „Sandlieth“ – oder aus Sumpflöchern, die mit Weiden, Reth und Binsen bewachsen waren: „Im Rohr“, „Laakwisch“, das heißt die Wiese mit der Wasserlache, „Brookwisch“, das ist die Sumpfwiese, usw. Der Ausbau der Bramauwiesen und die Regulierung der Au (Schleusenbau) erfolgte in den Jahren 1888 – 1890. Die „Scheide“ im Bargholz und der Stapelkampsbach sind künstliche Entwässerungsgräben (1781).
Weite Gebiete der Gemarkung waren mit Wald, Busch oder Kratt bewachsen: „Baargholz“ – Menge Holz -, „Immen Busch“ – im Busch, „Ruggenbusch“ – rauher Krattbusch, „Herrenholz“ und „Hinkenholz“.
„Wieten Moos“ blieb wegen der Dorfschäferei gemeinsamer Besitz und diente als Schafweide. Das „Moor“ hielten die Bauern für wertlos, so daß die Auflösung dieser Flurgemeinschaft wegen der allzu hohen Schreib- und Vermessungskosten nicht durchgeführt wurde. Eigentümer wurde der dänische König.

[239][V. Alte Familien des Dorfes]Wie aus den ”Amtsrechnungen des Amtes Segeberg von 1537” hervorgeht, bestanden damals in ”Vorde” und ”Barle” acht Vollhufen mit folgenden Besitzern:
a) Fohrden: Hans Carstens (zur Zeit Steffens – Krohn), Hinrich Müggesfelth (Kröger), Marquard Leegemann (Runge – Lohse), Hennike Op dem Damm = Dammann (Feil),
b) Barl: Clawes Dethloffs (Reimers), Clawes Steckmest (Schnack), Eler Kruse (Studt), Hennike Kruse (Rühmann).
Laut ”Hausenerverzeichnis” der alten Kirchenbücher waren Besitzer:
a) Fohrden:
1) Hinrich Castens. gestorben 11.10.1692, getraut 1646 mit Cathrina Horens aus Wiemersdorf, Tochter des Hinrich Horns und der Anna Roellefincks aus Bramstedt, gestorben 19.5.1693. Acht Kinder. Der jüngste Sohn
Hans Carstens. geb. 1659, verheiratet mit Maria Rungen aus Brockstedt, Tochter des Jasper Runge und Maria Gloyen, geb. 1665, übernimmt den Besitz im Jahre 1687. Sechs Kinder (Bemerkung: Von den beiden Sohnen Hinrich, geb. 1688, und Jasper. geb. 1693. wird jedenfalls letzterer ums Jahr 1720 Nachfolger auf der Vollhufe geworden sein. Der jetzige Besitzer ist Wilhelm Krohn. der die einzige Tochter des früheren Besitzers Markus Steffens 1932 heiratete.)
2) Marx Lohmann. Kirchengeschworener, gestorben 1654 (100 Jahre alt), Hoferbe 1632 Hartin Lohmann getraut 1632 mit Elseke Fuhlendorf aus Schmalfeld, gestorben 12.2.1696. Vier Kinder. Hoferbe 1665 Marx Lohmann. der jüngste Sohn verheiratet 1665 mit Engel Lindemann aus Wiemersdorf. Zwei Kinder. Der jüngste Sohn ist
Hoferbe 1700. Hartin Lohmann. geb. 1670. Verheiratet 1700 mit Anna Tießen von Mönkloh, vier Kinder.
Durch Kauf 1714 an Claus Göttsche aus Kirchspiel Bramstedt, getraut mit Abel X. Kind Hans, geb. 1714. (Bemerkung: Der Besitz wurde 1897 durch Johannes Runge aus Fuhlendorf parzelliert. Besitzer des Stammhofes ist seit 1940 Johannes Kröger.)
3) Jürgen Horens.
Hoferbe 1629 Marx Horens. verheiratet mit Wybeke Krusen aus Barl. Sieben Kinder.[240]
Durch Einheiratung: nach 1642 Witwe Wybeke Horens, gestorben 1661. Seit 1647 mit Jacob Drewes aus dem Kirchspiel Bramstedt.
Hoferbe 1661 Jürgen Horens (zweitjüngster Sohn), geb. 1637, gestorben 28.5.1699, verheiratet mit Anna Rungen aus Menzen. Sechs Kinder.
Hoferbe 1699. Jürgen Horens (jüngster Sohn), geb. 1673, verheiratet 1699 mit Catharina Fölster vom Hasselbusch. Zwei Kinder, zweite Ehe 1703 mit Margaretha Tietgen aus Stellau. Ein Kind. Dritte Ehe 1713 mit Trinke Lindemanns aus Barl. Zwei Kinder. (Bemerkung: Von den fünf Kindern waren alle Mädchen, so daß anzunehmen ist, daß die jüngste Tochter erster Ehe Trinke, geb. 1703, mit einem Sohn des Hufners Castens verheiratet etwa 1725. Jetziger Besitzer ist Johannes Lohse, der im Jahre 1924 die Tochter des vorigen Besitzers Wilhelm Runge heiratete.)
4) Jasper Dammann, gestorben 1664, getraut 1635 mit Catharina Fischers aus dem Kirchspiel Bramstedt, gestorben 1649. Sieben Kinder. Zweite Ehe mit Cath. Hardebecken, gestorben 1702. Zwei Kinder. Die älteste Tochter erster Ehe, Anna Dammans, geb. 1636, gestorben 10.1.1701 heiratet 1664 Frantz Titken aus Wiemersdorf. Vier Kinder!
1701 Frantz Titken, geb. 1669, gestorben 1719, verheiratet 1701 mit Abel Rungen. Sechs Kinder.
1721 heiratet die Witwe Abel Titken – Hinrich Mohr aus Kirchspiel Bramstedt. Zwei Tochter. (Bemerkung: Der Besitzer des Stammhofes ist zur Zeit der Bürgermeister Albert Feil; Der Nachfolger des Hinrich Mohr ist wahrscheinlich der jüngste Sohn, Hans Titken, geb. 1716, gewesen.)
In der Zeitspanne von 1630 – 1720 lebten folgende Insten in Barl:
1) Casten Castens, Kuhhirte 3 Kinder
2) Marx Castens, Kuhhirte 4 Kinder
3) Casten Fölster, Inste, 1 Kind
4) Hinrich Kruse, Inste, 1 Kind
5) Christoffer Jorck, getraut mit Engelcke Fölster, 2 Kinder
6) Hans Brockstede, Inste, getraut 1653 mit Anna Krusen, 1 Kind
7) Hans Runge, Inste, 4 Kinder
8) Casten Horens, Schäfer getraut 1676 mit Anna Wischmanns, 1 Kind
9) Hartig Kruse, Inste, getraut mit Sophia Borchers, 1 Kind
10) Hartig Schröder, Inste, getraut 1680 mit Cath. Hollers, 1 Kind
11) Hartig Mugsfeld, 1 Kind, Inste
12) Casten Dammann, Schäfer zu Föhrden, geb. 1656, verheiratet mit Beke Ferstes, 2 Kinder
13) Hartig Braker, Schäfer zu Föhrden,
14) Röttker Lindemann, Inste, 3 Kinder
15) Henning Kruse, Inste, getraut 1700 mit Anna Wischmann, 1 Kind
16) Hans Horns, Kuhhirt und Inste, 3 Kinder [241]
17) Claus Lüders, Schmied 1 Kind 1705
18) Tim Boye, Inste, 1 Kind
19) Joachim Boye, Inste, 1 Kind 1705
20) Dierck Butenup, Inste, 1 Kind, 1706
21) Hans Carstens, Inste, 1 Kind, 1706
Außerdem waren als Soldaten
1) Avo Siemsen, Dragoner, einquartiert in Barl, 1 Kind, geb. 1692
2) Oger Jenssen, Dragoner, einquartiert in Föhrden, 1 Kind, geb. 1694.
Bei insgesamt 11 Besitzübergaben (von 1632 – 1740) geht nur eine Hufe durch Verkauf an einen Nichtblutsverwandten über, der jedoch einer alteingesessenen Familie entstammt. Die Föhrdener Hufenbevölkerung können wir in dieser Zeitspanne als seßhaft ansprechen.
b) Barl:
1) Hans Fölster. gestorben 1655, drei Kinder.
Hoferbe 1656: Hans Fölster. der älteste Sohn, verheiratet mit Catharina Gloyen aus Lockstedt, sechs Kinder, darunter fünf Söhne.
Durch Kauf 1671 an Jasper Todt in Großenaspe, gestorben 5.5.1691, getraut mit Martha Eggersche.
Hoferbe 1691 ältester Sohn Hinrich Todt. verheiratet 1691 mit Catharina Grotmaacken aus Hingstheide.
Durch Kauf 1693 an Hans Sibbert aus Kirchspiel Bramstedt, verheiratet mit Magdalena Ardes aus Fuhlendorf. Fünf Kinder.
Der jetzige Besitzer der Vollhufe ist Heinrich Reimers.
2) Jasper Castens:
Nachfolger: Hans Kruse. gestorben 1656, verheiratet mit Catharina Bylls aus Kirchspiel Bramstedt.
Drei Kinder. Witwe Catharina Kruses zweite Ehe 1658 mit Hartig Schroder, gestorben 1688.
Durch Kauf 1677 an Hans Horns in Hagen, geb. 1650, verheiratet 1677 mit Wibke Dammann aus Föhrden, Sechs Kinder.
Durch Kauf 1701 an Clauss Butenopp. verheiratet mit Margaretha Schrammen.
Durch Kauf 1708 an Claus Musfeld aus Fuhlendorf, verheiratet mit Ellsche Schmidt, Kellinghusen (Brügge). Zwei Kinder: Hans, geb. 1709, Anntje 1711. Jetziger Besitzer: Heinrich Schnack,
[242]
3) Hartigh Kruse:
Drei Kinder: Hennike, geb. 1630, Zyllike, geb. 1633, Catharina, geb. 1636.
Hoferbe 1650: Hennike Krusen. getraut 1650 mit Mettke Tyttken, fünf Kinder.
Durch Kauf an Max Böjen aus Bramstedt, sieben Kinder.
Hoferbe 1702 jüngster Sohn Timm Boie. geb. 1680, verheiratet 1704 mit Margaretha Fischers von Hagen, fünf Kinder.
(Bemerkung: Hoferbe war wohl der jüngste Sohn Max Böge. geb. 1711. Jetziger Besitzer: Hans Studt.)
4) Hennike (Hinrich) Kruse. gestorben 2.8.1653, getraut 1630 mit Wobbeke Tyesen von Mönkloh, vier Kinder.
Hoferbe 1657 Hennike Kruse. Jüngster Sohn, geb. 1633, getraut 1657 mit Mettke Hardebecken aus Wiemersdorf, Tochter des Tyttken Hardebecken und der Wybke Hardebecken, geb. 1637. Kinder: 1) Hinrich, geb. 1658, gestorben vor 1663, 2) Tittken, geb. 1660, 3) Henke, geb. 1663, 4) Wöbke, geb. 1666, Jürgen 1673.
Hoferbe 1685 Tittken Kruse, gestorben 13.11.1705 (Schlag), getraut 8.10.1685 mit Catharina Harders; ein Kind: Henke, geb. 1695.
(Bemerkung: Henke Kruse übernahm später den Hof. Jetziger Besitzer Hans Rühmann )
5) Casten Hardebeck. gestorben 1651, vier Kinder (Töchter)
Hoferbe 1651 Tochter Christine Harbeck, getraut 8.10.1651 mit Tyttken Hardebeck aus Armstedt, Sohn des Casten Hardebeck, gestorben 1659. Kind: Casten, geb. 1654. 1659 heiratet die Witwe Christine Hardebeck – Frantz Krusen aus Barl.
Hoferbe 1677 Tochter X. Hardebeck. gebaut 1677 mit Hans Böjen aus dem Kirchspiel Bramstedt. Kinder Hans, geb.?, Tim, geb. 1678.
Hoferbe 1711 ältester Sohn Hans Böje. getraut 1711 mit Maria Castens aus Föhrden. Tochter des Hans Castens und der Maria Runge, geb. 1690. Kind: Antje, geb. 1713.
(Bemerkung: Die Tochter Antje heiratete jedenfalls Böje. Jetziger Besitzer Heinrich Harbeck )
Die beiden Besitzungen ”Heidekaten”. werden in dem Kirchenbuch nicht erwähnt.
Insten: s. Föhrden. Bei insgesamt 17 Besitzübergaben (von 1650 – 1711) erfolgen sechs Fremdverkäufe an Nichtblutsverwandte, von denen fünf aus alteingesessenen Familien des Kirchspiels Bramstedt stammen und einer aus Kirchspiel Neumünster.
Die Barler Hufenbevölkerung hat in dieser Zeit häufiger gewechselt als die in Föhrden.
Ortsteil Barl: 4 Vollhufen, 1/4 Hufe.
[243]
a) Erbhof Rühmann (Vollhufe)
Es ist nachgewiesen, daß diese Vollhufe seit Jahrhunderten in dem Besitz der Familie Kruse gewesen ist und dann im Jahre 1827 durch ”Einheirat” in den Besitz der Familie Rühmann überging.
1537 Hennike Kruse, 1657 Hennike Kruse (Bruder der Wiebke K.), 1685 Tietjen Kruse, 1730 Henke Kruse, geb. 1695, 1760 Hinrich Kruse.
Am 2. November 1827 heiratet Paul Rühmann. geb. 1797 in Lockstedt bei Kellinghusen, Elsabe Kruse, geb. 15. August 1799 in Barl, Tochter des Vollhufners Hinrich Kruse und dessen Ehefrau Margaretha, geb. Möller. Paul Rühmann, von 1836 – 1845 Burvogt der Gemeinde, soll ein äußerst tüchtiger Bauer gewesen sein. Sein einziger Sohn Hans Rühmann. geb. 11.8.1830, gest. ,verheiratet mit Catharina Harms, war als hervorragender Viehzüchter bekannt, legte an der Au die erste Rieselwiese an und erbaute 1868 das noch heute so stattliche Wohnhaus, welches zu damaligen Zeiten allgemeine Bewunderung erregte, weil es bereits einen ”Kornboden” und einen ”Schornstein” hatte. Hans Rühmann nahm als Freiwilliger am Schleswig-Holsteinischen Freiheitskriege 1848/51 teil, Der jüngste Sohn Wilhelm Rühmann. geb. 2.8.1876, gestorben 1925, verheiratet mit Frieda, geb, Harms, aus Kellinghusen, übernimmt den Hof 1903. Das Hinkenholz wird an Klassen, Westerhorn, verkauft. W. Rühmann erbaut Viehstall und zwei Schweineställe, mästet im Jahre ca. 500 Schweine und gilt als äußerst tüchtiger Landwirt. W. Rühmann ist Weltkriegsteilnehmer und stirbt 1925 an einem Gehirnschlag. Die Witwe Frieda heiratet 1927 den Landwirt Karl Feil. Hans Rühmann. geb. 5.7.1903, verheiratet mit Helene, geb. Rohwedder, und Johannes Rühmann. geb. 5.7.1909, verheiratet mit Marga Hinz, übernehmen als ”Gebrüder” den väterlichen Besitz für 60.000 RM. Der Besitz wird 1940 umgeschuldet und in zwei Erbhöfe zerlegt.
Erbhof Hans Rühmann. (50 ha, seit 1940.)
Hans Rühmann, geb. 5. Juli 1903, verheiratet mit Helene, geb. Rohwedder aus Poßfeld – Wilster Marsch -, Kinder: Hans Wilhelm, geb. 22. Oktober 1930, Magdalene, geb. 4. November 1931, Paul Walter, geb. 28. Dezember 1937, Wiebke, geb. 25. November 1940, Reimer, geb. 15. Februar 1943.
[244] Erbhof Johannes Rühmann. (seit 1940.)
Johs. Rühmann, geb. 5. Juli 1909. Ehefrau Marga, geb. Hinz, aus Hingstheide. Kinder: Heinz, geb. 18. September 1939, Elfriede, geb. 19. Oktober 1940, Günther, geb. 12. Juli 1943.
Johs. Rühmann 1940 2. Infanterie nach Goslar einberufen, wurde im Osten verwundet (Schulterschuß) und im Jahre 1943 als bedingt tauglich entlassen, um als Bauer seine Pflicht zu erfüllen. Er ist Inhaber der Ostmedaille und des Verwundetenabzeichens.
b) Vollhufe Studt.
1537. Eler Kruse, 1600 Hartig Kruse, 1650 Hennike Kruse, durch Kauf an Max Böge. Bramstedt, 1702 Timm Böge, 1750 Max Böge (geb. 1711), 1781 wurden die Ländereien der Gemeinde aufgeteilt. Am 2. Februar 1822 überläßt die Witwe Catharina Böge, geb. Lohse, ihrem Sohn Max Böge (1801 -1860) die Vollhufe für 1.600 Reichstaler nebst Altenteil. Gelegentlich der Hochzeit trägt M. Böge noch die alte Föhrdener Bauerntracht. 1859 übernimmt der Pflegesohn Tim Studt. gest. 23.10.1888, verheiratet 1859 mit Catharina Maria, geb. Karstens, die Vollhufe in Große von 94 ha, 79 a, 79 qm. 1870 Anbau des Wohnflügels durch den Zimmermann Jürgen Fölster aus Föhrden Barl. 1873 stirbt die Witwe Böge, geb. Micheels, die ihr restliches Vermögen, darunter 30 Bolzen Linnen, acht Schafe, zwei Kühe usw. ihrem Pflegesohn Tim Studt verschenkt. Das Altenteil pachtet Hans Karstens. Die Witwe Rebecca Studt, gestorben 1911, übergibt am 25.4.1898 ihren beiden Söhnen Markus geb. 5.10.1862, gestorben 1921, verheiratet mit Helene, geb. Runge, aus Wrist, und Johannes Studt. geb. 25.4.1865, gestorben 28.4.1944. Verheiratet mit Ida, geb. Duggen, die Vollhufe. Diese wird nunmehr geteilt. Den Stammhof erhält Johannes Studt, und Markus Studt errichtet auf Wrister Kamp neue Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Im Jahre 1932 verkauft Johannes Studt, um sich finanziell zu erleichtern: Endeel, groß 4,7 ha an Gebrüder Schnack, Preis 4.400 RM; Brookwiese, 4,7 ha für 5.940 RM an Gebrüder Thies; die Bredewiese, 0,6 ha für 810 RM an Hermann Blöcker. Drei Söhne, fünf Töchter. 1936 übernimmt der älteste Sohn Hans Tim Studt. geb. 6.9.1898, verheiratet 1931 mit Anne, geb. Röschmann, den väterlichen Besitz, der nunmehr als Erbhof eingetragen wird.
[245] Erbhof Hans Studt.
Kinder: Johannes Christian, geb. 14. September 1932, Alfred Willi, geb. 26. November 1936, Inge, geb. 2.8.1938.
Erbhof Johannes Harbeck.
Markus Studt, der die Wohn- und Wirtschaftsgebäude im Jahre 1898 errichten ließ, war kränklich, so daß seine Wirtschaft dauernd zurückging, verkaufte im Jahre 1910 seine halbe Hufe für 65.000 RM an Wienbergen in Danenhof, der ihn parzellierte. Die Stammstelle erwarb im Jahre 1911 Claus Harbeck, der von seinem Besitze Ländereien angliederte und den Besitz alsdann im Jahre 1919 seinem Sohn Johannes Harbeck, geb. 1887, übergab. Preis: 22.500 RM und 1/2 Altenteil. Johs. Harbeck l. Ehe mit Maria, geb. Seider, gestorben 1926. Drei Kinder. 2. Ehe 1933 mit Herline, geb. Albertsen. 1924 erbaute Johannes Harbeck einen Schweinestall und im Jahre 1937 ein Wohnhaus, das er später als Altenteilerwohnung selbst zu beziehen gedenkt. Im Jahre 1919 kaufte er von Heinrich Kock das ”alte Moor”, groß 4 ‚/4 ha für 15.000 RM. Johannes Harbeck nahm am Weltkriege teil. Eisernes Kreuz II. Klasse. Seit 1921 Vorsitzender der Spar- und Darlehnskasse, seit Mai 1937 Mitglied der Partei. Im Jahre 1934 wurde der Besitz Erbhof. Kinder: Frida, geb. 14.10.1910, Ernst, 3.8.1915, Anne, geb. 5.2.1920. Frida heiratet 1938 Siemsen, Bauer in Wulfsmoor. 1936 Bau der Altenteilerkate, die bis auf weiteres vermietet wird.
[246] c) Vollhufe Schnack.
Besitzer: 1537 Clawes Steckmest. 1656 Hans Kruse, 1677 durch Kauf an Horns, Hagen, 1701 durch Kauf an Clauss Butenopp, 1708 durch Kauf an Clauss Muxfeld, Fuhlendorf.
Nach dem Hausbriefe des Hufners Reimers aus dem Jahre 1753 wohnte um diese Zeit die Familie Peter Harder auf der Vollhufe, 95 ha groß. In einem Güterauszug aus dem Jahre 1783 tritt Johann Fock als Besitzer auf. Hoferbe ist Jakob Fock. der in einem Testament als Beistand der Altenteilerin Witwe Böge aus dem Jahre 1822 genannt wird.
Der jüngste Sohn Jakob verzieht nach Weddelbrook, wo noch heute dessen Nachkommen als geachtete Bauern anzutreffen sind. Die Schwester Catharina heiratet den Vollhufner Jürgen Harbeck (jetzt Speck) und Christine den Vollhufner Jürgen Runge in Mönkloh. Der jüngste Sohn Johann Fock. geb. 1814 (im Russenwinter), gestorben 1908, verheiratet mit Ida, geb. Schlüter, aus Wulfsmoor, übernimmt den väterlichen Besitz. 1870 Neubau des Wohnflügels, 1879 Neubau der baufälligen Kate. Die älteste Tochter Christine, geb. 28.5.1854, gestorben 1939, verheiratet mit Peter Schnack, geb. 23.12.1847 in Lohbarbeck, gestorben 1923, ist Hoferbe. Die jüngste Tochter Anna, geb. 22.3.1858, heiratet Markus Runge aus Fuhlendorf, später Besitzer der Gastwirtschaft ”Zum Landhaus”. (Er ist der Vater meiner Frau.) So gelangt die Vollhufe Fock in den Besitz der Familie Schnack. Peter Schnack war Kriegsteilnehmer 1870/71 und nahm an den Schlachten von Gravelotte und Orleans teil. Sein Vater, Vollhufner in Lohbarbeck, wird in der Fehrschen Novelle ”Ehler Schof’ erwähnt. Peter Schnack übernahm 1881 die Vollhufe für 20.000 RM nebst Altenteil. Er war ein sehr tüchtiger Bauer und ein eifriger Jäger. Im Jahre 1898 ließ er das massive Viehhaus, 1884 den Schweinestall erbauen.
Im Jahre 1903 überließ er die Hälfte seines Besitzes seinem Sohn Johannes Schnack und 1908 übernahm Heinrich Schnack. geb. 27.3.1882, verheiratet mit Anne, geb. Jargstorf, geb. 7.8.1886 in Quarnstedt, für 20.000 M den väterlichen Besitz. 1909 Pferdestall, 1916 den Schuppen und 1924 den Schweinestall erbaut, 1911 Hager Kamp, groß 3 ha von M. Studt für 3.000 M gekauft. Die Halbhufe wird 1934 Erbhof. 1938 werden ca. 18 ha an den ältesten Sohn Hans Schnack. geb. 20.3.1908, verheiratet mit Magdalena, geb. Meier, abgetreten und so ein neuer Erbhof geschaffen. 1933 brennen Wohn- und Wirtschaftsgebäude des Bauern [247] Heinrich Schnack nieder und werden wieder aufgebaut. Versicherung zahlt 11.800 M. Der Hoferbe Otto Schnack. geb. 18.12.1913, Parteigenosse und Kriegsteilnehmer 1939/40 stirbt am 31. März als Unteroffizier in Verden an der Aller den Reitertod. Er fand in der Heimat unter starker Teilnahme der Partei, der Feuerwehr, der Wehrmacht und der ganzen Bevölkerung seine letzte Ruhestätte. Töchter: Ida, geb. 23.5.1909, verheiratet mit Albert Feil, Föhrden Barl, Erna, 9.3.1915, verheiratet mit dem Hauptmann der Fl. Hans Hasselmann.
Erbhof Heinrich Schnack. Seit 1934.
Wegen einer schweren Magenoperation übergibt Heinrich Schnack den Besitz an seinen Sohn Hans (1943), wodurch der volle Besitz wieder hergestellt wird. Hans Schnack ist seit Oktober 1936 Geschäftsführer der Spar- und Darlehnskasse. Aus der Ehe gingen folgende Kinder hervor: Irma, geb, 9. März 1934, Kurt, geb. 28. Februar 1940, Otto, geb. 25. Oktober 1943.
Erbhof Hans Schnack. Seit 1938.
[248] Halbhufe Johannes Schnack.
Peter Schnack trat im Jahre 1903 die Hälfte seiner Ländereien, ca. 47 ha, und die Hälfte des Inventars: drei Pferde, acht Kühe, 20 Stück Jungvieh und etliche Schweine an seinen Sohn Johannes Schnack, geb. 5.1.1877, verheiratet mit seiner Cousine Dora, geb. Wulf, ab, der die Wirtschaftsgebäude bauen ließ. Johannes Schnack war ein tüchtiger Bauer, er baute einen großen Schweinestall und errichtete einen vorbildlichen Mühlenbetrieb. Als Kriegsteilnehmer starb er nach einer Blinddarmoperation im Kriegslazarett zu Steney 31.7.1918. Im Jahre 1920 heiratete die Witwe Schnack den Bauern Gustav Blunk, geb. 10.4.1889, der den Hof bis zum Jahre 1937 für die minderjährigen Söhne vorbildlich verwaltet und den Besitz durch Kauf der Weide ”Eendeel” (J. Studt) bedeutend verbessert.
Der älteste Sohn Willi Schnack, geb. 7.3.1907, verheiratet mit Miele, geb. Fülscher, siedelt 1937 nach Schmalfeld über, wo er für 34.000 RM den Besitz des Bauern Lührs übernimmt.
Der jüngste Sohn Herbert, geb. 1.4.1912, verheiratet mit Minna, geb. Fölster, und Peter übernehmen als ”Gebrüder Schnack” den väterlichen Hof.
Viehbestand 1937: 10 Pferde, 18 Kühe, 65 Jungtiere, diverse Schweine, 25 Bienenvölker.
Erbhof Gustav Blunk. Groß 17 ha. Einheitswert 15.000 RM.
Gustav Blunk übernimmt als Ausgleich 5 ha des Schnackschen Besitzes und gründet, nachdem er bereits im Laufe der Jahre verschiedene Ländereien erworben hat (1922: Rieselwiese % ha von Butenschön in Hagen, 1926: Weide ”Bargholz”, 8,5 ha von E. Runge 18.000 RM – 1929 Weide im Quarnstedter Brook, 2,5 ha, 4.000 RM) und nach dem Bau der Wirtschaftsgebäude (1924) im Jahre 1937 das Wohnhaus errichtete, seinen Erbhof. G. Blunk ist seit 1935 Ortsgruppenleiter der N.S.D.A.P. und Gründer der Freiwilligen Feuerwehr.
[249] d) Vollhufe Reimers.
Besitzer: 1537 Clawes Dethloffs, gestorben 1655 Hans Fölster, seit 1656 dessen Sohn Hans Fölster, 1671 durch Kauf an Jasper Todt aus Großenaspe, 1691 Hinrich Todt, 1693 durch Kauf an Hans Sibbert, Kirchspiel Bramstedt.
Bis zum Jahre 1753 befindet sich die Vollhufe im Besitze von Tim Fischer. Dessen Tochter aus erster Ehe – es liegt meines Erachtens Einheirat vor – heiratet Hinrich Reimers. Der Vater übergibt dem jungen Paare – die Tochter heißt Catharina – laut Hausbrief die Vollhufe für 1.863 Reichstaler. ”Wegen einer Kuh, eines Ehrenkleides, eines Kessels, Grapens und einer Tonn’ Bier” wird die Kaufsumme um 63 Reichstaler gekürzt. Tim Fischer nimmt zwei Kühe, eine Starke, sechs Schafe und ein Schwein mit aufs Altenteil. Folgende Ländereien gehören zum Altenteil: ”ein Kohlgarten, was vormals zum Altenteil gehörte, mit dem Birnbaum im Blick beim Haus, ferner an Wiesenwachs die ”Moorwiese” halb und zwar der Teil, so an Peter Harders ”Brookwiese” belegen, das ”Feldwieschteil” zwischen ”Kamp” und Harty Carstens in Quarnstedt Anteil befindlich und das ”Sand-Teil” an Peter Harders Anteil. An Kornland:
zwei Stück auf Westerkamp an Marx Böge,
ein Stück an Ohlenberg an Marx Böge,
ein Stück bei kleinen Berg an Marx Böge,
ein Stück bei Fierthkamp bei Henning Kruse,
ein Stück bei Hager – Kamp bei Peter Harder,
ein Stück vorm Holz bei Henning Kruse,
ein Stück beim Holm bei Henning Kruse,
zwei Stück im Osterkamp bei Marx Böge,
ein Stück an dem Osterkamp oder Fierth, bei Henning Kruse belegen.
Der Vollhufner hat das Land des Abschiedsnehmers gleich seinem Land zur rechten Zeit zu schälen, pflügen, besäen, mähen und die Ernte einzufahren. Der Bauer hat das Altenteilerbrot in seinem Ofen zu backen und als Feurung zwölf Fuder Torf, drei Fuder Busch und das nötige Streu zu liefern. Die Altenteilerkate ist in gutem Zustande zu erhalten. Auch muß der Vollhufner den Altenteiler, so oft er es wünscht, zur Kirche, zu Markt, zum Arzt und sein Korn zur Mühle bringen. Für den Fall, daß Krieg, den Gott abwende, erfolgen möchte, soll der Abschiedgeber verbunden sein, des Alten Güter nebst den seinigen in Sicherheit zu bringen.”
Aus der zweiten Ehe stammen noch drei unmündige Kinder. Das Abschied ist beim Tode des Vaters an die Kinder weiter zu entrichten, bis das letzte Kind das 16. Lebensjahr erreicht hat.
[250] Laut Hausbrief übergibt Heinrich Reimers seinem Sohn Klaus Reimers am 31. März 1785 seine Vollhufe für 2.400 Mark nordlübsch, wovon 1.200 Mark beim Antritt bar bezahlt werden sollen. Der Rest wird mit 3 1/2 % verzinst. Das Altenteil ist im allgemeinen dasselbe wie beim Vorgänger. Bei Namhaftmachung wurden uns Namen anderer Vollhufer, die damals lebten, genannt:
Marx Böge, Johann Fock aus Barl und Hinrich Schümann aus Quarnstedt.
Im Hausbrief interessiert uns ferner: ”Es überträgt und tritt ab usw., sowie solches alles in dem Jahre 1781 eingekoppelt, und theils durch Loos, und beeidigter Bonitierungs-Männer auseinandergesetzt, jetzt den Ort und Stelle begraben (Gräben gezogen) und bemerkt worden mit allen dem Überlasser bisher daran zuständig gewordenen Pflichten und Gerechtsamen usw”.
Im Jahre 1781 ist somit die erste Aufteilung der Flurgemeinschaften erfolgt.
Claus Reimers übergibt am 18.10.1831 (laut Hausbrief) seinem Sohn Hinrich Reimers den Hof für 2.400 Thaler, und 1.400 RT. Schuldforderungen des Hufners Runge, Rensing. Wenn auch das Altenteil dasselbe bleibt, so erweckt die Genauigkeit desselben doch unsere Heiterkeit. Es heißt nämlich unter anderem: ”Ferner hat sich der Abschiedsmann die Hälfte der Birnen vor der Küchentür des Hauses ausbedungen” – ferner ”sowie auch der Hufenbesitzer verpflichtet ist, wenn er selbst Ferkel hat, dem Abschiedsmann unentgeltlich eines zu geben”. Der Vater muß die Charaktereigenschaften haargenau gekannt haben. Hinrich Reimers stirbt am 20.12.1861. Claus Reimers geb. 11.12.1841, verheiratet mit Catharina Viehmann, übernimmt den väterlichen Hof für 4.230 RT, wovon die Mutter 1.600 RT und die Schwester 2.400 RT erhalten. Außerdem ist für die Mutter ein Altenteil vorgesehen. Aus der ersten Ehe gehen zwei Kinder hervor: Wiebke Anna Margr. und Claus Hinrich Reimers. Im Jahre 1878 wird das Haus durch Blitzschlag eingeäschert, so daß nunmehr moderne Wohn- und Wirtschaftsgebäude errichtet werden können.
Zweite Ehe 1879 mit Anna Dorothea, geb. Langmaak. Vier Kinder: Johs., Emma, Heinrich, geb. 26.4.1885, und Hans. Claus Reimers stirbt 8.7.1B91. Die Witwe heiratet 1893 den Bauern Joachim Kelting aus Großendorf, dem laut Setzungsvertrag die Vollhufe bis 1.5.1916 zur Bewirtschaftung überlassen wird. Die Vollhufe soll für 23.000 M an Hans und, wenn dieser vorher sterben sollte, an Heinrich Reimers fallen. Da die Schulden 11.840 M betragen, erhält jeder der Geschwister alsdann als Erbabfindung 2.442,22 Mark. [251] Jochim Kelting galt als sehr tüchtiger Bauer, der Ödländereien urbar machte oder aufforstete und den Viehbestand im Laufe der Jahre verdoppelte, so daß der Bau eines Schweinestalles und Viehhauses notwendig wird. Als langjähriger Gemeindevorsteher genoß er allseitiges Vertrauen, und wenn er die Feder auch nicht besonders führen konnte, wurde sein Rat doch gern eingeholt. Nach Beendigung des Weltkrieges siedelte Kelting, nachdem er den Besitz an Heinrich Reimers (Hans Reimers fiel im Weltkrieg) abgetreten hatte, nach Wrist über. Der Sohn Hermann Kelting wird Erbhofbauer in Hingstheide (Beeken). Heinrich Reimers, verheiratet mit Martha, geb. Steinweh, gelangte im Jahre 1912 in den Besitz einer Landstelle in Hingstheide, die er 1919 verkauft, um sein natürliches Erbe in Föhrden Barl zu übernehmen. Er ist Weltkriegsteilnehmer und Inhaber des Eisernen Kreuzes 2. Klasse. Kinder: Helmut und Elfriede. Viehbestand 1933; 7 Pferde, 20 Kühe, 50 Stück Jungvieh, 60 Schweine, 100 Stück Geflügel,
Erbhof Hahn – Schwartzkopff.
Hinrich Hahn. geb. 1840 in Weddelbrook, der in seiner Jugend beim Bauern die Kühe und Gänse hütete, wird später Ferkelhändler und Großimker. 1876 kaufte er die jetzige Hauskoppel von dem Vollhufner Reimers und errichtet darauf eine Kate. Hinrich Hahn stirbt 1918.
Heinrich Hahn. geb. 8.6.1874, gestorben 1925, übernimmt 1904 den väterlichen Besitz, kauft 1909 Ödländereien ”Im Moor” zusammen, erwirbt 1918 eine Wieseweide im ”Herrenholz” und erbaut 1912 das jetzige Wohn- und Wirtschaftsgebäude. Hahn war als Ferkelhändler auf sämtlichen Märkten in der Provinz bekannt. Die Ehe war kinderlos.
Die Witwe Emma, geb. Dunker, heiratet im Jahre 1926 Hugo Schwartzkopff. geb. 5.3.1891 in Friedrichsruh, der einer Försterfamilie entstammt.
[252] e) Viertelhufe Harbeck.
Besitzer: Carsten Hardebeck. gestorben 1654, 1651 Tochter Christine, verheiratet mit Tyttken Hardebeck aus Armstedt, 2. Ehe mit Frantz Kruse aus Barl, 1677 Tochter X. Hardebeck mit Hans Böjen aus Bramstedt, 1711 Hoferbe Hans Böje. verheiratet mit Maria Carsten, Föhrden.
Noch im Jahre 1800 ist die Familie Böy Besitzer der Viertelhufe. Max Böy ist 1837, 1846, 1857 Schulvorsteher unserer Gemeinde. Sein Sohn Hinrich Böy verkauft, da sein einziger Sohn den Lehrerberuf gewählt hat, den väterlichen Besitz im Jahre 1860 an Johann Harms. der sich seine Ersparnisse als Goldgräber in Australien erworben hat. Hinrich Böy lebt noch bis 1877 als Altenteiler in der Kate. Harms verkauft 1888 seinen Besitz an Claus Harbeck. 1855 – 1933. Die Familie Harbeck stammt aus dem Dorfe Hardebeck (1500). Eine Linie dieser Familie verzog später nach Meezen und Tappendorf, wovon die Harbecks unserer Gemeinde abstammen. Claus Harbeck war ein äußerst tüchtiger, fleißiger und sparsamer Bauer, und so war es ihm möglich, durch dauernden Landzukauf seinen Besitz zu vergrößern. So war es ihm möglich, jedem seiner beiden Söhne Johannes und Heinrich im Jahre 1919 eine Bauernstelle zu übergeben. Seine Tochter Anna heiratet Markus Köhnke aus Hagen.
Heinrich Harbeck. geb. 17.5.1889, verheiratet mit Elise, geb. Martens, erbaut 1933 das moderne Wohnhaus und verbessert durch Kauf der ”Burvogtskoppel” seinen Besitz. H. Harbeck besitzt das Vertrauen der Gemeinde und ist bereits viele Jahre Gemeindevertreter sowie Mitglied des Aufsichtsrates der Spar- und Darlehnskasse sowie der Meierei-Genossenschaft Wrist. Kinder: Claus, 31.10.1925, Christine Maria, 9.6.1923, Hans D., 17.12.1933.
[2531 Erbhof Schuldt. (Heidekate.)
Diese Siedlung in der Heide mag – geschätzt nach dem Alter der beim Hause stehenden Eichen – ums Jahr 1700 entstanden sein. Da die Siedlung kaum die Familie ernähren konnte, beherbergte der Heidebauer mit Vorliebe Vagabunden und Pferdediebe, die ihr in Dänemark geraubtes Diebesgut über die Lutzhorner Heide in Sicherheit brachten. Schließlich wurde das Haus von der Polizei und den Bauern umstellt und die Diebesbande mit Hehlern gefesselt nach Pinneberg abgeführt (1840). Der Weber Blöcker schlug einen dieser Banditen, der ihn mit dem Dolch niederstechen wollte, mit einer Heugabel nieder. Stick verkaufte 1840 den Besitz an Muhs dessen Tochter 1868 den Omnibuskutscher Hans Kröger heiratete. Im Jahre 1900 übernimmt der Sohn Johannes Kröger den väterlichen Besitz. 1907 geht der Hof durch Kauf (39.000 M) an Heinrich Kock aus Beidenfleth über. Dieser erwirbt im Jahre 1910 von der Gemeinde die 3,5 ha große ”Burvogtskoppel”. 1919 wird der Besitz parzelliert, die Stammstelle erwirbt der Gärtner Dudda aus Ulzburg.
Als dieser 1926 in Konkurs gerät, kauft Hinrich Schuldt. geb. 12.10.1895, verheiratet mit Elsabe, geb. Lohmann, den Hof, groß 20 ha, für 29.500 RM. Schuldt entstammt einer alten Bauernfamilie aus der Umgegend von Elmshorn. Der Großvater, geb. 1825, war Goldgräber und gelangte als solcher in den Besitz eines bedeutenden Vermögens. Er kaufte einen Bauernhof in Sparrieshoop, wo H. Schuldt geboren ist. Schuldt ist ein fleißiger, tüchtiger Bauer und kommt gut vorwärts. Er ist Kriegsteilnehmer 1914/18 und Inhaber des Eisernen Kreuzes II. Klasse. Kinder: Erwin, geb. 19.8.1927, Herbert, 11.2.1930.
Erbhof Seider (Heidekate II.)
Auch diese Siedlung wird ums Jahr 1700 gegründet sein. Im Jahre 1822 wird die Katenstelle (Besitzer Schreiber) an Micheel verkauft. Dessen Tochter heiratet 1848 Heinrich Schnoor. 1888 an Schwiegersohn Heinrich Mohr Durch Kauf 1891 an Röth der Brandstiftung begeht. Mohr muß den Besitz wieder übernehmen und veräußert ihn 1899 an Hinrich Seider. geb. 3.5.1859 in Bönningstedt, für 10.000 M. Durch unermüdlichen Fleiß hat Seider seinen Besitz verbessert und vergrößert. Nachdem von M. Studt im Jahre 1911 ”Barlhoop” erworben ist, werden auf diesem Grundstück neuzeitliche Gebäude errichtet. [254] Am 21.7.1919 übernimmt der älteste Sohn Friedrich Seider, geb. 18.10.1893, den väterlichen Hof, den er von Jahr zu Jahr vergrößert. Seider ist Kriegsteilnehmer 1914/18. Zwei Kinder: Grete, geb. 18.1.1922. Willi, geb. 10.3.1923.
Erbhof: Meier – Fischer – Fölster. (8 ha)Die Familie Fischer lebte ums Jahre 1754 auf der Vollhufe Reimers. Der älteste Sohn verzieht ums Jahr 1720 ( Fritz Fischer) nach Hasenkrug, dessen Sohn Fritz Fischer stirbt in Hitzhusen (geb. 1770). Sohn: Timm Fischer. 1802 – 1893 Dachdecker in Hingstheide. Sohn Anton, 1835 – 1911, Dachdecker – Föhrden Barl, dient in der dänischen Armee, Kriegsteilnehmer 1870/71. 1872 Schäferkate erworben. Zwei Söhne: Heinrich, geb. 26.6.1877, verheiratet mit Minna, geb. Müller, fällt im Weltkrieg. Hermann, geb. 1890, ereilt dasselbe Schicksal. Heinrich Fischer übernimmt 1912 den väterlichen Besitz. Verkauf der alten Schäferkate 1911 an H. Hahn – zum Abbruch – Erwerb des „Fierth“ von M. Studt 1911, groß 3 ha, für 6.000 M. Errichtung von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden. Rentenstelle. Witwe Fischer heiratet 1920 den Zimmermann August Meier aus Elmshorn. Sohn Willi Fischer wird Lehrer, Tochter Anne Fischer, geb. 19.2.1913, heiratet Fritz Fölster, übernimmt 1937 den Besitz. Kinder: Ilse Dorothea, geb. 4. März 1936. Lilli, geb. 4. Dezember 1937.
Familienhäuser in Barl:
1)Witwe Markus Studt, erbaut 1911
2)Wilhelm Mohr, erbaut 1924, als Wohnhaus umgebaut 1938.
3)Wilhelm Blunck, erbaut 1926, erbaut durch Gustav Blunck.
4)Friedrich Rühmann, erbaut 1901, ehemals Altenteilerhaus Vollhufe Rühmann
5)Heinrich Zornig, erbaut 1901, ehemals Schulhaus bis 1857, abgebrochen 1936 (Reimers)
6)Wilhelm Strohbeen, erbaut 1857, Schulhaus von 1857 – 1911.
7)Schulhaus, erbaut 1911.
8)Hermann Blöcker, erbaut 1878. Gastwirtschaft. Karsten Blöcker (Weber), geb. 1832, Johannes Blöcker, geb. 18. August 1863. Herrmann Blöcker, geb. 25.1.1892 (Bauunternehmer)

 [257] Ortsteil: Föhrden. Einst 4 Vollhufen.
[257] Ortsteil: Föhrden. Einst 4 Vollhufen.
a) Vollhufe Karstens, Steffens, Krohn.
1537 Hans Karstens, Hinrich Karstens, gestorben 1692, Hans Karstens, geb. 1659, Jasper Karsten, geb. 1693, Jürgen Karstens 1769 – 1809. Witwe 2. Ehe mit Micheel: (Heidekate) im Jahre 1811 kauft Micheel, der sich darauf in Breitenberg ankauft, die Vollhufe an Hinrich Steffens aus Wiemersdorf für 2.000 Reichstaler. Hinrich Steffens, von 1848 – 1849 Burvogt, stirbt 1850. Witwe Steffens heiratet Stave und verzieht nach Borstel. Diese Ehe bleibt kinderlos. Die Föhrdener Vollhufe wird während der Minderjährigkeit der Kinder erster Ehe an Jürgen Köhnke aus Weddelbrook (1853 – 1863) verpachtet. Im Jahre 1863 erhalten: Hinrich Steffens die Vollhufe in Föhrden, Hans Steffens die in Borstel und Max Steffens die Vollhufe in Wiemersdorf. Hinrich Steffens ist lange Jahre Gemeindevorsteher und Amtsvorsteher des Bezirkes Weddelbrook und als solches äußerst beliebt und bekannt. 1905 übernimmt der älteste Sohn Markus Steffens, verheiratet mit Anna, geb. Thun, den Besitz und H. Steffens geht aufs Altenteil (Bau der Kate).
Im Jahre 1932 heiratet die einzige Tochter Emma Steffens, geb. 1906, Wilhelm Krohn aus Aspern, denen im Jahre 1937 die Vollhufe (seit 1933 Erbhof) übergeben wird. Kinder: Annelise Martha, geb. 9. Oktober 1933, Max Herbert, geb. 18. April 1936, Günter Adolf, geb. 7. Juni 1937.
Der Erbhof Heinrich Rühmann ist ein Abbau der Vollhufe Steffens im Jahre 1903. Johannes Rühmann, geb. 25.12.1864, (Sohn des Vollhufners Hans Rühmann aus Barl) heiratet Marie, geb. Steffens, und errichtet Wohn- und Wirtschaftsgebäude. 1912 Bau des Schweinestalles. Der älteste Sohn Paul verzieht nach Borgstedt. Heinrich Rühmann, verheiratet mit Olga, geb. Fedder aus Wrist, übernimmt 1932 den väterlichen Besitz, Vater geht aufs Altenteil. 1934 Besitz niedergebrannt und im gleichen Baustil wieder aufgebaut. Brandentschädigung 18.000 RM. Der Einheitswert des Besitzes beträgt 15.500 RM. Kinder: Helma, geb. 12.5.1933, Erna, 5.3.1939.
[258] Erbhof: Johannes Karstens. Abbau Steffens.
s. Familie Karstens S. 257.
Jürgen Karstens 1769 – 1809, Sohn: Hans Karstens, 1797 – 1867, Tagelöhner, Sohn: Hans Karstens 1849 – 1937 erlernt Weberhandwerk in Weddelbrook bei Kunrath und wird, da dieser Beruf nicht mehr lohnend ist, Tagelöhner in Föhrden Barl und pachtete später das Abschied der Studtschen Vollhufe. 1896 Kauf der damals 5 ha großen Landstelle für 4.700 M. Durch dauernden Landzukauf: 1898 Rieselwiese, groß 67 ar, 1901 Leeswisch 5,75 ha von Steffens, 1910 Oster und Lentföhrdener Moor von Studt 5 ha -, 1910 Herrenholz, groß 3 ha von Knüppel, Krücken. 1901 Bau des Vieh-, 1913 Bau des Schweinestalles. Hoferbe 1920 Johannes Karstens, geb. 1886, verheiratet mit Alma, geb. Dwenger. Weltkriegsteilnehmer 1914/18, schwer verwundet (Kunstbein), Inhaber Eisernen Kreuzes II. Klasse. Er ist, wie seine Vorfahren, äußerst fleißig und gilt als vorbildlicher und strebsamer Bauer. Lange Jahre ist er Vorstandsmitglied der Spar- und Darlehnskasse und Mitglied des Gemeinderates (Parteigenosse). Kinder: Hans, geb. 26.9.1920, Hertha, 7.2.1922, Walter, 18.11.1924, Marianne, 26.6.1927.
b) Vollhufe Johannes Runge – Erbhof Kröger.
1537 Hinrich Muggesfelth, 1600 Max Lohmas, gestorben 1654. „Er war Kirchengeschworener und ist ein frommer, redlicher und gottesfürchtiger Mann.“ Sohn Hartigs Lohmann, verheiratet mit Elsabe Fuhlendorf, übernimmt 1633 die Vollhufe, 1665 Sohn: Max Lohmann, verheiratet mit Engel Lindemann aus Wiemersdorf. 1700 Sohn Hartigs Lohmann, verheiratet mit Anna Thiessen aus Mönkloh. 1714 durch Kauf an Claus Göttsche. Hoferbe wahrscheinlich Hans Göttsche. Wie lange die Familie Göttsche auf der Vollhufe lebte, habe ich leider nicht feststellen können, da die Propstei aus mir nicht bekannten Gründen die Einsicht in die Kirchenbücher ablehnte. 1826 durch Kauf aus Konkurs für 1.000 Reichstaler an Klaus Koopmann aus Hollenbrook. Hoferbe Jakob Koopmann verkauft den Besitz wegen Überschuldung an Johannes Runge aus Fuhlendorf, der ihn 1892 parzelliert. 1897 brennen die leerstehenden Gebäude, die vom Nachtwächter des Dorfes bewohnt wurden, nieder.
[259] Restbesitz, groß 6 ha, mit neu errichteten Gebäuden ist nicht lebensfähig und wechselt mehrfach Besitzer. 1906 Konkurs, durch Kauf 1907 an Johannes Kröger für 12.000 M. Familie Kröger stammt aus Bimöhlen, wo bereits 1756 die Vorfahren als Vollhufner erwähnt werden. Johannes Kröger, geb. 14.3.1872, verheiratet mit Magdalene, geb. Matthiessen, war der ehemalige Besitzer der Heidekate (s. Erbhof Schuldt). Johannes Kröger, Vater von zwölf Kindern, hat durch unermüdlichen Fleiß seinen Besitz vergrößert und verbessert. Seit 1933 Erbhof. Kinder: Frida, geb. 13.1.1903, Anne, 19.4.1904, Emma, 29.4.1905, Minna, 18.5.1906, Martha, 3.8.1907, Hans, 22.10.1908 – verzogen nach Seedorf – Julius, 5.5.1910 – Polizei -, Johannes, 13.7.1911, Hinrich, 21.9.1913, Else, 3.6.1914, Ernst 25.7.1915 – Polizei -, Wilhelm, 11.1.1917, Meierist – Inhaber Eisernes Kreuz I. Klasse.
Erbhof Martin Kelting ist ein Abbau der Vollhufe Johannes Runge. Die Gebäude wurden 1896 errichtet und waren als Gärtnerei gedacht. Die Familie Kelting stammt aus Kremperheide. Hinrich Kelting, geb. 28. Mai 1871, verheiratet mit Agnes, geb. Witt, erwarb den Besitz im Jahre 1900 für 20.000 M (23,5 ha). Martin Kelting, verheiratet mit Berta, geb. Egge (gestorben 1933) übernimmt 1931 den väterlichen Besitz. Zweite Ehe Cäcilie, geb. Kölcke (1940), Sohn: Hermann, geb. 3.2.1932, Tochter Hilda, geb. 2.10.1940.
Katenstelle Johannes Behnke ist ebenfalls ein Abbau der Vollhufe J. Runge und war ursprünglich als Schmiede eingerichtet (1897). Der Gastwirt Markus Runge verkauft im Jahre 1919 den Besitz an den Wegewärter Johannes Behnke, geb. 12.1.1887, verheiratet mit Martha, geb. Bestmann. 1830 Heinrich Behnke, Arbeiter in Hitzhusen. Sohn: Heinrich Behnke, geb. 4.12.1862, Arbeiter auf Gut Weddelbrook. Johs. Behnke ist Weltkriegsteilnehmer 1914/18. Inhaber des Eisernen Kreuzes II. Klasse. Seine drei Söhne: Heinrich (Oberfeldwebel), Willi (Unteroffizier), Walter (Wachtmeister und Inhaber des Eisernen Kreuzes II. Klasse) nehmen an den Kriegen 1939/40 teil, desgleichen seine beiden Schwiegersöhne. Töchter: Anne, geb. 9.3.1919, Käthe, 8.4.1921, Hertha, 23.12.1923.
[260] c) Vollhufe Marcus Runge – Erbhof Runge – Lohse.
1537 Marquart Legemann, 1600 Max Harms und Ehefrau, geb. Kruse. Zweite Ehe Jacob Drewes. 1661 Jürgen Harms, verheiratet mit Anna, geb. Runge, 1699 Jürgen Harms, geb. 1673, verheiratet mit Catharina Fölster aus Hasselbusch, Tochter Anna heiratet Hans Karstens (Balkeninschrift „Hans Karstens, Anna Karstens 1747, 16. Mai), Hoferbe: Johann Karstens. Sohn verzieht nach Weddelbrook (um 1785), die Tochter Wiebke Karstens, verheiratet mit Soth, gestorben 1856, aus Lockstedt, übernimmt 1810 den Besitz. Zwei Töchter, verheiratet mit Burmeister aus Kellinghusen und Jürgen Ohrt, Hagen. 1858 durch Kauf an Markus Runge, geb. 27.6.1824 in Rensing. 18.000 M. 1898 wird der Besitz geteilt: Wilhelm Runge, geb. 28.8.1870, verheiratet mit Anna, geb. Rühmann, erhält den Stammhof. Er ist ein tüchtiger und einsichtiger Bauer. Von 1920 – 1936 Gemeindevorsteher. Zwei Töchter: Helene und Martha. Helene, geb. 19.7.1900, verheiratet mit Johannes Lohse aus Wrist, geb. …., übernimmt im Jahre ….. den väterliche Besitz. Vier Töchter: Anna, geb. 16.10.1925, Erna, geb. 15.10.1926, Helga, geb. 24.1.1928 und Gerda, geb. ….. .
Erbhof Bernhard Feil ist ein Abbau der Vollhufe Markus Runge. 1897 Besitzer: Heinrich Runge, verheiratet mit Berta, geb. Dwenger aus Weddelbrook. 1919 Übergabe der Halbhufe an den einzigen Sohn Ernst Runge, verheiratet mit Grete, geb. Breide, der sie 1927 parzelliert. Erlös ca. 130.000 RM. Runge erwirbt später im einsamen „Tütichmoor“ den Besitz „Schönweide“.
Den Föhrdener Stammhof mit ca. 30 ha Restländereien kauft 1927 Bernhard Feil, geb. 6.5.1902, verheiratet mit Anna, geb. Rühmann, – für 56.000 M. 1928 verkauft Feil 11 ha seiner Ländereien an den Siedler Karl Plötzky.
Nach erfolgter Umschuldung wird der Besitz 1936 Erbhof. B. Feil war von 1933 – 1935 Stützpunktleiter der Ortsgruppe Föhrden Barl. Drei Kinder: Albertine, geb. 14.8.1928, Willi Gustav, geb. 16.1.1930, Reinhard, geb. 5.8.1934.
Erbhof Plötzky – Tonder, Abbau von Erbhöfen W. Runge – B. Feil.
1928 kauft Plötzky von B. Feil 10,9 ha und von W. Runge 6 ha Ländereien und errichtet darauf Wohn- und Wirtschaftsgebäude. 1938 durch Kauf an H. Tonder. Kinder: Margaret, 30.5.1930; Jakob, geb. 11.7.1931; Hinrich Tonder, geb. 14.2.1934; Dietrich, geb. 29.10.1935;
[261] d) Vollhufe Krohn – Erbhof Albert Feil.
Besitzer: 1537 Hennike op dem Damm, Jasper Dammann, gestorben 1664, älteste Tochter Anna Dammans heiratet 1664 (1636 – 1701) Franz Tietken aus Wiemersdorf, 1701 Sohn Frantz Titken (1669 – 1719), verheiratet mit Abel Rungen, zweite Ehe der Witwe. 1721 mit Hinrich Mohr aus Kirchspiel Bramstedt. Als Besitzer der Vollhufe wird um das Jahr 1850 Joachim Krohn genannt, der von 1850 – 1859 Burvogt der Gemeinde war und außerdem ein Buttergeschäft betrieb. Er kaufte die Butter von den Bauern der Umgegend und fuhr damit auf seinem mächtigen Planwagen nach Hamburg, um seine Ware dort auf dem Wochenmarkt abzusetzen. Was er als Burvogt leistete, lesen wir unter: „Führende Männer unserer Gemeinde in den letzten 100 Jahren“.
1859 verkauft Krohn den über 100 ha großen Besitz an Müller, Hamburg, der sehr vermögend war und das für damalige Zeiten herrschaftliche Vorhaus mit einem mächtigen Balkon erbauen ließ. 1869 geht die Vollhufe an Schwieger über. Er war nebenbei Holz- und Viehhändler und ließ die wuchtigen Wirtschaftsgebäude errichten. Um das Holz seiner Wälder und das der Umgegend besser verwerten zu können, erbaute er eine größere Sägerei. Als seine Spekulation fehlschlug, veräußerte er den herrlichen Besitz 1872 an den Juden Kohnemann, dem nachgesagt wird, daß er alle Leute betrogen haben soll. Dieser Jude betrachtete den Hof als Handelsware und parzellierte ihn. Den Stammhof erwirbt Schwieger, der ihn jedoch noch im selben Jahre gegen die Kochsche Vollhufe in Schmalfeld eintauscht. Der Schwiegersche Besitz geht an Knaak und dann an W. Haak über. Dieser gedenkt in den mächtigen Wirtschaftsgebäuden eine fabrikmäßige Großtischlerei zu errichten. Als sein Unternehmen fehlschlug, wird der Besitz im Jahre 1888 an Plath verkauft, der ihn dann 1901 an Karl Feil veräußert. Karl Feil, geb. 1878, verheiratet mit Albertine, geb. Horn, läßt die Wirtschaftsgebäude gründlich überholen, das Vorderhaus mit Ziegel decken und einen Vieh- und Schweinestall erbauen. 1930 Übergabe des Besitzes an jüngsten Sohn Albert Feil, geb. 1904, verheiratet mit Ida, geb. Schnack, – mit 15 ha Land, da 1927 Ländereien an Plötzky verkauft wurden, 7,5 ha an den ältesten Sohn Bernhard abgetreten sind, und der Vater die Weide „Schwarzes Moor“ selbst bewirtschaftet. Albert Feil ist Mitglied der N.S.D.A.P. (1930) und von 1934 – 19.. Bürgermeister der Gemeinde. Aus der Ehe gingen folgende Kinder hervor: Rosa, geb. 27. April 1931, Crista, geb. 5. September 1934, Hermann, geb. 2. Juni 1936, Erika, geb. 19. September 1939, Jürgen, geb. 7. September 1942, Helga, geb. 27. Juni 1944.
[262] Der landwirtschaftliche Besitz Thies entstand als Abbau der Vollhufe Feil. Die Tagelöhnerkate wurde für den landwirtschaftlichen Betrieb umgebaut und mit 6 ha Land „Am Stapelkampsbeck“ im Jahre 1872 an Claus Thies (1842 – 1893), verheiratet mit Anna Chatarina, geb. Storjohann aus Bokel, verkauft. Die Familie Thies entstammt einem alten angesehenen Bauerngeschlecht aus Mönkloh, das bereits ums Jahr 1600 in den Kirchenbüchern Kaltenkirchens genannt wird. Claus Thies wurde das Leben durch den Juden Cohnemann sehr schwer gemacht, so daß er 1893 freiwillig aus dem Leben schied. Die Mutter und die herangewachsenen Kinder sind äußerst fleißig und sparsam, so daß es ihnen gelingt, die finanziellen Schwierigkeiten zu überwinden, die Wirtschaftsgebäude zu vergrößern und den Besitz durch Landzukauf („Herrenholz“ 6 ha von H. Runge, „Lüddkoppel“ 2 ha von M. Studt) lebensfähig zu gestalten. 1912 übernehmen die drei Söhne: Hinrich, geb. 23.2.1871, gestorben 1938, Wilhelm, geb. 28.11.1882, und Hermann, geb. 23.2.1886, gestorben 1939, verheiratet mit Alma, geb. Röstermund, den Besitz. Wilhelm siedelt 1913 nach Wiemersdorf über, durch weiteren Landzukauf (1919 Auwiese von H. Kock, 1926 „Beekwiese“ von E. Runge, 1932 „Brookwiesch“ von Johs. Studt) wird der Bauernhof immer mehr verbessert.
Aus der Ehe des Hermann Thies, der nach dem Tode seines Bruders alleiniger Besitzer wird, gehen drei Söhne und eine Tochter hervor: Claus, geb. 22.8.1920, Elli, geb. 24.11.1922 – Ernst, geb. 6.12.1923, Heinz, geb. 22.10.1930. Größe des Besitzes 1932: 30 ha. Einheitswert: 25.600 M. Viehbestand 1937: 3 Pferde, 25 Kühe, 20 Jungtiere, 8 Schweine und 100 Stück Geflügel. H. Thies gestorben 19.. an Krebs. Claus findet, nachdem er bereits einmal verwundet war, bei der Offensive im Sommer 1942, den Heldentod i.O.
Erbhof Kock – Johannsen entstand im Jahre 1872 als Abbau der Vollhufe Feil. Adolf Kock (1850 – 1923) aus Schmalfeld, verheiratet mit Magdalena, geb. Steenbock aus Föhrden Barl, erwerben damals die umgebaute Scheune der Vollhufe mit ca. 20 ha Land. Stuben und Flur hatten keine Fußböden, Inventar war nicht vorhanden, das Land in Unordnung, die Schulden sehr hoch! Erst nach schweren Jahren anstrengender Arbeit kam Kock etwas vorwärts, so daß er 1903 ein Viehhaus anbauen und im Jahre 1907 von H. Runge 4 ha Land zukaufen konnte. Vier Söhne und zwei Töchter. Wilhelm Kock, geb. 1880, gefallen im Weltkrieg am 1916 vor Verdun, verheiratet mit Anna, Koopmann, übernahm 1909 den Besitz. [263] Drei Söhne: Hans, geb. 1910 – Heinrich, geb. 1912 – Ernst, geb. 1915 – und eine Tochter Meta. Die drei Söhne machen als Unteroffizier bzw. Wachtmeister im Artillerieregiment 20 im Krieg 1939/40 mit. Die Witwe Anna heiratet 1919 August Johannsen aus Schardebüll bei Leck.
Ein Sohn: Artur, geb. 26.8.1920, findet im März 1943 bei den schweren Kämpfen i.O. den Heldentod (Obergefreiter). Der Besitz wird nach Entschuldung im Jahre 1937 Erbhof.
Katenstellen:
1) Gastwirtschaft Peter Steenbock.
Peter Siegfried Steenbock, verheiratet mit Wiebke, geb. Lütje aus Hardebeck, von Beruf Weber, stirbt 24.8.1884. Schleswig-Holsteinischer Freiheitskämpfer 1848/51. In der Schlacht bei Idstedt wird sein Helm durchschossen, er selbst wird verwundet. Sohn Peter Steenbock, geb. 29.3.1859, gestorben: 12.1.1936, verheiratet mit Maria, geb. Ramm aus Fuhlendorf, von Beruf Zigarrenmacher übernimmt 1881 den Besitz. 1880 brennt das Haus infolge Fahrlässigkeit nieder und wird nach demselben Grundriß wieder aufgebaut. Drei Söhne: Otto, Hugo, Hans. Vier Töchter: Elfrieda, Alma, Minna, Martha.
Landerwerb: 1896 Holzgrundstück von J. Runge 252 M, 1898 Rieselwiese von A. Kock 300 M.
2) Katenstelle Fölster.
Die Kate der Witwe Markus Fölster ist die letzte Räucherkate der Gemeinde. Beißender Rauch zieht durch die große Tür, und unter dem Boden der großen Diele hangen Speckseiten, Schinken und Würste der Bauern. Die altdeutsche Küche mit dem mit Sott geschwärzten Schwiebogen ist noch voll und ganz erhalten. Auf dem deutschen Herd steht der eiserne Dreifuß, und von dem Schwiebogen hängt an einer verstellbaren eisernen Kette der mächtige Kessel. An den Wänden befinden sich Borde, auf denen alte Teller und Töpfe Platz finden. Die Küche ist mit [264] Rotsteinen ausgelegt. Die Stube ziert ein alter Beilegeofen, der von der Küche aus geheizt wird. Die vordere Eisenplatte des Ofens trägt die Jahreszahl 1742, darüber erblickt man eine Waage, das Sinnbild für „Recht und Ehre“. Die Seitenplatten sind mit zwei biblischen Bildern „Salomo als gerechter Richter“ geschmückt. An der Innenwand sind die sogenannten „Kupbetten“ mit Schiebetüren eingebaut. Die alte Kate wird von etwa 250 – 300 Jahre alten Eichen umgeben.
Bis 1848 wohnte der Butterhändler Kröger in der Kate, der sie in diesem Jahre an den Zimmermeister Jürgen Fölster, geb. 15.3.1823, verkauft (1,5 ha). Zwei Söhne, sechs Töchter. Markus Fölster, geb. 27.8.1863, gestorben 9.7.1925, verheiratet mit Dora, geb. Fölster, von Beruf ebenfalls Zimmermann, übernimmt 1897 den Besitz. 1901 „Kamp“ 2 ha von Steffens, 1909 „Rieselwiese“ von Genossenschaft. Sieben Söhne, drei Töchter. Sohn Willi fällt 1918 im Weltkrieg. Sämtliche Söhne:
Rudolf, Julius (Inspektor beim Finanzamt) und Willi nehmen am Weltkrieg teil und sind Inhaber des Eisernen Kreuzes II. Klasse.
Nach dem Tod des Vaters gelingt es dem jüngsten Sohn Fritz, geb. 23.9.1909, verheiratet mit Anne, geb. Fischer, durch unermüdlichen Fleiß den stark verschuldeten väterlichen Besitz zu erhalten. Nach Umschuldung 1937 wird sie als „Nährstelle“ erklärt. Fritz Fölster übernimmt nunmehr die Katenstelle und bewirtschaftet sie mit dem von seinem Schwager Willi Fischer übernommenen Besitz. Die Mutter bleibt als Altenteilerin in der Kate wohnen. Gesamtinventar 1937: 3 Pferde, 10 Kühe, 7 Jungtiere, 10 Schweine.
Katenstelle Rudolf Fölster ist ein Abbau der Katenstelle Markus Fölster und entstand 1913 (Rentenstelle). 1919 Erwerb der 0,5 ha großen Wiese „Herrenholz“. Rudolf Fölster, geb. 30.1.1888 in Quarnstedt als Sohn des Zimmermanns Markus Fölster (s. oben) nahm am Weltkriege 1914/18 teil, Inhaber des Eisernen Kreuzes II. Klasse. Sechs Kinder: Max, geb. 22.3.1910, Hans Heinrich, 12.4.1918, Ernst, 22.4.1920, Anne Frida, 24.11.1921, Hermann, 14.7.1925, Walter, 6.8.1926.
Katenstelle Plambeck. – bis 1857 Schulhaus.
Bis 1890 Schuster Stühmer. Karl Plambeck, geb. 6.4.1864 (Winsen), verheiratet mit Anna, geb. Stühmer, übernimmt 1890 den Besitz. Übergabe 1934 an Sohn Erhard Plambeck, geb. 3.8.1894, verheiratet mit Emmy, geb. Groth. Landerwerb: 1896 – 2 ha von J. Runge. 1921 Parzelle Lentföhrdener Moor. 1932 „Lüdd Koppel“ und „Steenkuhl“ von Gebrüder Schnack. Karl Plambeck gestorben 10.4.1943.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
[265] ErgänzungsblätterDer Unteroffizier Kurt Mohr, Sohn des Lehrers Mohr, der mit Ernst Harbeck gemeinsam (Artillerieregiment 7/20 Itzehoe) den Polenfeldzug erlebte, berichtet: (1939)
„Wegen der gespannten politischen Lage war unser Truppenteil schon tagelang marschbereit. Endlich -, am 21.8.1939 erfolgte der Abmarsch nach Osten, wo wir auf den „Truppenübungsplatz Wandern“, östlich von Frankfurt a/O., hart an der polnischen Grenze gelegen, nach mehrtägigem Marsche landeten.
Um den Feind zu täuschen, zogen wir täglich bei anbrechender Dunkelheit an der Grenze nach Süden, um bei Tagesgrauen wieder in unsere Quartiere zurückzukehren. Schließlich bezogen wir Ende August endlich unsere bereits ausgebaute Stellung. Am 31.8. erhielten wir dann den Befehl, am 1.9. morgens 4.45 Uhr das Feuer auf die polnischen Bunker zu eröffnen. Jedes Maschinengewehrnest, jeder Bunker und sämtliche Gefechtsstellungen des Feindes waren erkundet und in die Karte eingezeichnet. In stockfinsterer Nacht, bei strömendem Gewitterregen bezogen wir unsere Geschützstellung. Pioniere und die Infanterie gingen ebenfalls still und geräuschlos vor und lagen bald vor den Stacheldrahtverhauen. Alles wartete nun mit großer Spannung, das Auge auf die Zeiger der Uhr gerichtet, auf den Augenblick des Feuerüberfalls.
Jetzt ist es soweit! 57.58.59.60 – und auf die Sekunde donnerten sämtliche Rohre los. Ich werde diesen Augenblick nie vergessen! Nach kurzer, aber furchtbarer Artillerievorbereitung ging die Infanterie, gedeckt durch unser vorverlegtes Sperrfeuer, durch die Stacheldrahtverhaue über die polnische Grenze. Stellungswechsel! Die Stadt Konitz liegt unter schwerem Artilleriefeuer und steht bald in hellen Flammen. Die Infanterie hat einen kurzen, schweren Kampf mit polnischen Ulanen zu bestehen. Überall wird der Feind geworfen. Am Wegrande sehen wir bei unserem weiteren Vorrücken die ersten Toten der Polen.
Da der Widerstand des Feindes wieder größer wird, müssen wir recht oft unsere Stellung wechseln, um der tapferen Infanterie den Weg zu bahnen. Immer wieder wird der Feind unter furchtbaren Verlusten geworfen.
Die ersten befreiten Volksdeutschen kommen uns bereits entgegen und drücken uns dankbar die Hände, doch sind sie eingeschüchtert und ängstlich; denn sie bangen um ihre Angehörigen, die in die polnische Armee eingezogen oder von den Polen verschleppt wurden.
[266] Die Gegend im sogenannten „Korridor“ ist zu einem Drittel von Deutschen und zu zwei Dritteln von Polen besiedelt, doch die Polen sind restlos geflüchtet. Die Volksdeutschen haben Schweres erduldet. Sobald unter der polnischen Herrschaft ein deutscher Besitzer starb, mußte dessen Besitz an einen Polen abgetreten werden. Die Besitzungen sind durchschnittlich 40 – 150 ha groß. Die in der Mehrzahl stattlichen landwirtschaftlichen Gebäude stammen aus der Zeit vor der polnischen Herrschaft. Die Volksdeutschen hatten sich während der letzten Tage der Schreckensherrschaft in den ausgedehnten ungepflegten Wäldern versteckt gehalten. Sie kehren nun mit ihren wenigen Habseligkeiten, die sie auf einem Bauwagen verstaut haben, in ihre Heimat zurück. Hinter dem Wagen laufen zwei bis drei Kühe und auf dem Wagen erblickt man: Hausrat, Säcke mit Lebensmitteln, Betten, Töpfe, Teller, Kisten, usw. und oben auf diesem Durcheinander sitzen sechs bis zehn Familienangehörige. Auf den Weiden laufen herrenlose Viehherden einher, oft 20 – 30 Stück, die tagelang nicht gemolken sind, vor Schmerzen brüllen und kaum noch auf den Beinen stehen können. Schweine, Ziegen und Schafe liegen verhungert oder verdurstet in den Ställen, Hühner laufen herrenlos auf den Höfen umher – ein Bild des Grauens. Die allermeisten deutschen Besitzungen sind von den Polen kurz vor ihrer Flucht angezündet, um den deutschen Truppen die Brandstiftung anzudichten. Etwa 25 – 30 Kilometer drangen wir am ersten Tage in Feindland vor. Wenige Stunden ruhten wir dann, in unsere Mäntel eingehüllt, auf unseren Fahrzeugen.
Am nächsten Morgen geht’s in aller Frühe auf sandigen Straßen weiter gen Norden: Richtung „Jücheler Heide“. Sämtliche Brücken und Flußübergänge sind vom Feinde gesprengt. Am Abend erreichen wir, nur auf geringen feindlichen Widerstand stoßend, Jüchel.
Am 3. September passieren wir die Brahe, in deren Sumpf- und Waldgelände am Vortage eine Panzerabteilung schwere Kämpfe gegen eine gewaltige Übermacht zu bestehen hatte. Mit gezogenem Schwert und gefällter Lanze waren die Polen auf die deutschen Panzer losgestürmt; denn man hatte ihnen eingeredet, diese seinen aus Pappe. Die Greueltaten der Feinde, die diese an Volksdeutschen und in Gefangenschaft geratenen Kameraden begangen haben (Abschneiden der Geschlechtsteile, Ohren, der Nase und Zunge und dergleichen), lassen sich kaum beschreiben. Im raschen Vorgehen geht’s durch die Jüchler Heide, der ostpreußischen Grenze entgegen, um den zurückflutenden polnischen Truppen den Weg restlos zu verlegen. Am Wege sehen wir immer wieder Flüchtlingszüge von Volksdeutschen, die von den Polen von Haus und Hof vertrieben waren [267] und nunmehr ihrer Heimat wieder zustreben. Ich denke an meine Heimat und an Euch, Ihr Lieben daheim, und wünsche, daß Euch diese Schrecken erspart bleiben.
Immer noch leistet der Feind, meistens sind es versprengte polnische Truppen, Widerstand, der aber von unserer Infanterie schnell gebrochen wird. Viele Kriegsgefangene, erbeutete Geschütze und Maschinengewehre, sowie Fahrzeuge aller Art werden eingebracht. Die Jücheler Heide, die von so vielen polnischen Greueltaten erzählen könnte, ist restlos in unserem Besitz.
Wir werden nunmehr von einer ostpreußischen Landwehrdivision, der der Führer anerkennend in seiner Reichstagsrede gedachte, abgelöst. In der Gegend von Grupa, einem polnischen Truppenübungsplatz bei Graudenz, wird unser Truppenteil noch einmal eingesetzt. Nach kurzem aber hartem Kampfe räumt der Feind auch hier das Feld, und nun geht es über die Weichsel, wo ich meinen alten Kameraden Walter Behnke noch kurz begrüßen konnte, quer durch Ostpreußen. Bei Lyck, im Ostzipfel dieser Provinz, bezogen wir für wenige Tage Quartier. Der erste Teil des Polenfeldzuges ist somit für mich beendet!
Am 9. September sind die Ruhetage vorbei, der zweite Teil des Polenfeldzuges beginnt! Wir marschieren gegen die Festung Lonza a/N. Auf unserem Marsche kommen wir durch Gebiete mit rein polnischer Bevölkerung, die auf einer recht niedrigen Kulturstufe stehen. Die allermeisten Dörfer mit ihren niedrigen Holz- und Lehmhütten sind von den Polen niedergebrannt. Die schlechten Wegeverhältnisse zeugen von der sprichwörtlich gewordenen „polnischen Wirtschaft“. Welch ein Gegensatz zur blühenden Provinz Ostpreußen und insbesondere zu meiner lieben Heimat! Ich habe nunmehr während meiner sechsjährigen militärischen Dienstzeit ganz Großdeutschland kennengelernt, doch das müßt Ihr mir glauben: Es gibt in der ganzen weiten Welt nur ein Schleswig-Holstein!
Da wir die Festung Lonza mit unseren 10,5 cm-Geschützen nicht anfahren können, setzen wir unseren Marsch fort und überschreiten am 10. September auf einer in aller Eile von den Pionieren gebauten Pontonbrücke den Narew. Nun stoßen wir über Zambrow in schnellem Vormarsch auf schlechten Wegen 150 km in Feindesland vor bis Siemiotycze. In dunkler Nacht fährt der Fahrer meines Lastwagens gegen einen Baum, so daß wir mit einem zweiten Fahrzeug in der Waldeinsamkeit zurückbleiben mußten, um das demolierte Fahrzeug abzuschleppen.
[268] Nach einer 3 – 4-stündigen vergeblichen Arbeit, unser LKW wieder fahrbereit zu machen, macht uns die Nachhut in Stärke eines Infanteriehalbzuges auf die Gefahr, abgeschnitten zu werden, aufmerksam; denn links von uns steht die 18. polnische Division und rechts werden wir von zwei Kavalleriebrigaden flankiert. Schon pfeifen uns von allen Seiten feindliche Kugeln um die Köpfe! Schnell wird mit Hilfe der Infanterie das allerwichtigste umgeladen, um darauf in schneller Fahrt dem Feinde zu entkommen. Vollständig erschöpft gelangen wir nach mehrstündiger mühevoller Fahrt bei unserer Batterie an und erstatten Bericht.
Am Morgen des 11. September besetzen wir die Eisenbahnbrücke, die südwärts bei Siemiotycze über den Bug führt. Da erhalten wir den Funkspruch, daß die 18. polnische Division versuche, nach Südosten durchzubrechen und unsere ehemalige Vormarschstraße bereits überschritten sei. Wir standen somit im Rücken der Feinde und waren vollständig abgeschnitten.
Wir fahren den selben Weg wieder zurück, bekommen bereits am Abend Feindberührung und am 12. September beginnt ein heißes ungleiches Ringen mit dem Gegner, der dank der geschickten Feuerleitung unserer Artillerie zurückgeworfen wird. Unsere Rohre speien Tod und Verderben, doch Welle auf Welle stürmt aufs neue auf die Infanterie, der man ein Heldenlied singen könnte, vor. Unser Hauptmann sitzt als Beobachter in einer alten Windmühle, von wo aus er das Feuer mit der größten Genauigkeit zu leiten vermag. Auch die polnische Artillerie erzielt Treffer in unserer Feuer- und Protzenstellung, doch nachdem der polnische Beobachter aus seinem Baum innerhalb unserer Stellung heruntergeholt ist, wird die feindliche Artillerie bald zum Schweigen gebracht. Durch eine Kriegslist versuchen die Polen unsere Infanterie zu täuschen, indem sie sich mit erhobenen Händen bis auf 400 m unseren Linien nähern, um alsdann wieder die Waffen zu ergreifen. Darauf gibt’s kein Erbarmen mehr – zu Bergen türmen sich die Leichen der anstürmenden Feinde. Auch ein Angriff des polnischen Divisionsstabes – etwa 100 Offiziere – bricht im Maschinengewehrfeuer der Infanterie zusammen.
Schon geht die Munition auf die Neige, keine zwei Stunden hätten wir uns noch halten können! Da hören wir in der Ferne das „Hurra!“ der zu uns durchgestoßenen Infanterie. Ein polnischer Parlamentär teilte dann mit, daß die Reste der 18. polnischen Division zur Waffenstreckung bereit seien. Über 10.000 Gefangene und hunderte von Fahrzeugen, beladen mit Maschinengewehren, Munition und Verpflegung, bespannte Batterien, Kavallerie hoch zu Roß usw. traten den Weg in die Gefangenschaft an.
[269] Die Schlacht bei Andrzyew wird für immer ein Ruhmesblatt unserer Artillerieabteilung und des Infanterieregimentes 76 bleiben. Sieben Gefallene meiner Batterie liegen gemeinsam in einem Grabe, so wie sie der Kampf gemeinsam hinwegraffte, auf dem Ehrenfriedhof in Andrzyew begraben.
Auf unserem weiteren Vormarsch kommen wir durch Gebiete, die von Weißrussen bewohnt sind. Diese sind äußerst freundlich und zuvorkommend, und so tauschen wir gegen Zigaretten alles ein, was uns fehlt: Eier, Butter, Gänse, Enten und Hühner. Die Bewohner leben auf einer niedrigen Kulturstufe, Geld ist ihnen unbekannt. (Tausch).
Am 17. September gelangen wir vor Brest – Litowsk an, kommen aber nicht mehr zum Einsatz; denn auf der Zitadelle weht bereits die deutsche Kriegsflagge. Viele Volksdeutsche, die unglaubliche Drangsalierungen erduldet hatten, wurden von uns befreit. Ungeheuer ist die von uns gemachte Beute, die meines Erachtens noch Monate für die Besatzung ausgereicht hätte u.a. 40.000 Zentner Hafer. Von der Schwere der Kämpfe zeugt, daß allein in der Zitadelle 500 Tote Pferde verscharrt werden mußten.
Unaufhörlich fliegen schwer beladene dreimotorige Flugzeuge über uns hinweg, um die ungeheure Kriegsbeute in Sicherheit zu bringen. Siehe unten.
Nachdem das Gebiet östlich des Bugs an die Russen übergeben ist, treten wir den Rückmarsch an, beziehen auf acht Tage Quartiere in Löwenstein i/B. und besichtigen von dort aus das Tannenbergdenkmal. Darauf geht’s per Achse durch Ostpreußen und den Korridor. In Konitz, wo wir vor 14 Tagen noch schwer gekämpft hatten, werden wir alsdann verladen, um in unsere Garnison zurückzufahren. Auf dem Bahnhof in Itzehoe wird uns ein begeisterter Empfang bereitet. Auch meine Eltern und Johannes Harbeck haben sich eingefunden, um Ernst und mich zu begrüßen.
Nachtrag: Wir machten dem Flugplatz in Brest-L. einen Besuch. Welch unvorstellbare Wirkung hatten die Fliegerbomben gehabt! Dutzende von polnischen Flugzeugen standen teils nur leicht beschädigt auf dem Rollfeld, das große „Trichter“ aufwies. Die Flugzeughallen sind vollständig vernichtet. Die Polen hatten im letzten Augenblick die Ölfässer zerschlagen und die unterirdischen Benzinbehälter unbrauchbar gemacht. Wir wateten buchstäblich in Öl; aber trotzdem konnten noch bedeutende Vorräte gerettet werden. Der Bergungsdienst wurde in vorbildlicher Arbeit durch den schnell vorrückenden A.D. erledigt.
gez. Kurt Mohr.
[270]Abschrift! (Bericht an den Bürgermeister).
Nachtwache 26. – 27. Oktober 1940. Blöcker – Mehr.
09.30 Lebhaftes Flakfeuer Richtung Hamburg. Johannes Harbeck Licht im Viehstall, nicht verdunkelt!
10.15 Feindliche Flieger überm Ort, von Nordwest – Richtung Südost.
12.15 Lebhaftes Flakfeuer Richtung Hamburg.
01.15 Schwaches Flakfeuer in südwestlicher Richtung.
01.30 Flieger überm Ort von Süd nach Nord!
03.00 Scheinwerfertätigkeit und Flakfeuer Richtung Hamburg
05.00 – 06.00 Scheinwerfertätigkeit und Flakfeuer von Südosten bis Südwesten.
05.30 Mangelhaft verdunkelt im Stall von Hans Rühmann, nicht verdunkelt hintere Hofseite Herbert Schnack und Hans Schnack.
05.45 Schweinstall nicht verdunkelt bei Thies und Lohse.
Föhrden Barl, 27.10.1940 – 06.00 Uhr morgens.
gez. Hermann Blöcker. Herbert Mehr.
Bemerkung: Die sechs Besitzer, die nicht oder mangelhaft verdunkelt hatten, wurden je mit einer Ordnungsstrafe von 10 RM – für Gemeindekasse – bedacht.
Hier folgt im Ausdruck des Original eine 3-Seite Tabelle zur Bevölkerungsbewegung 1870 / 1943
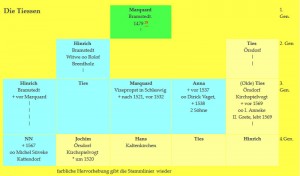
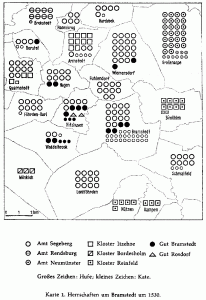
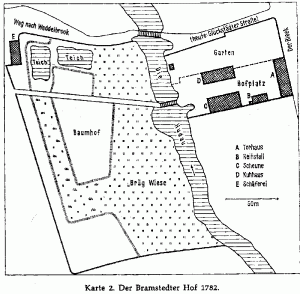


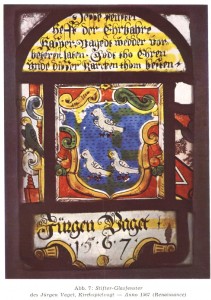

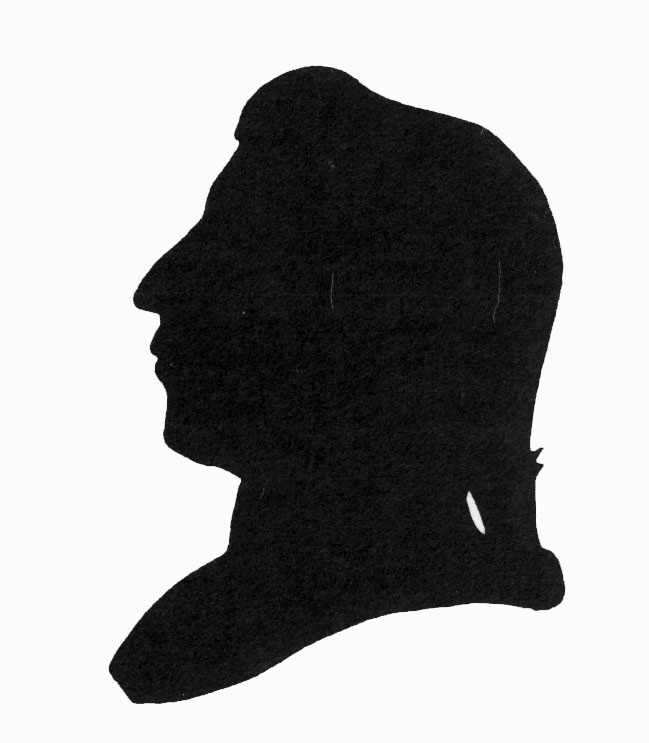
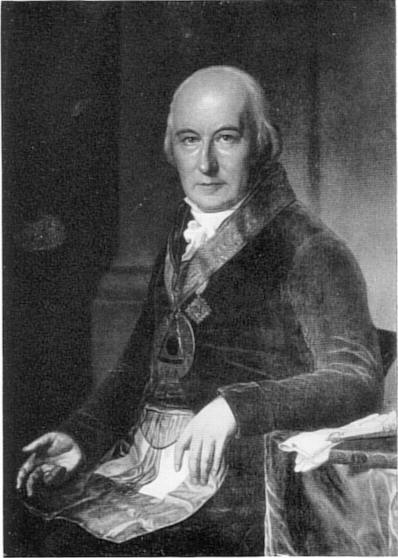
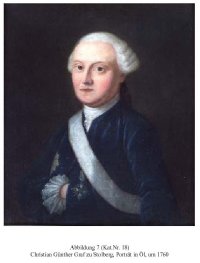

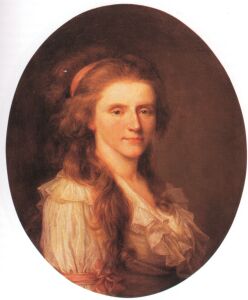



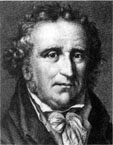

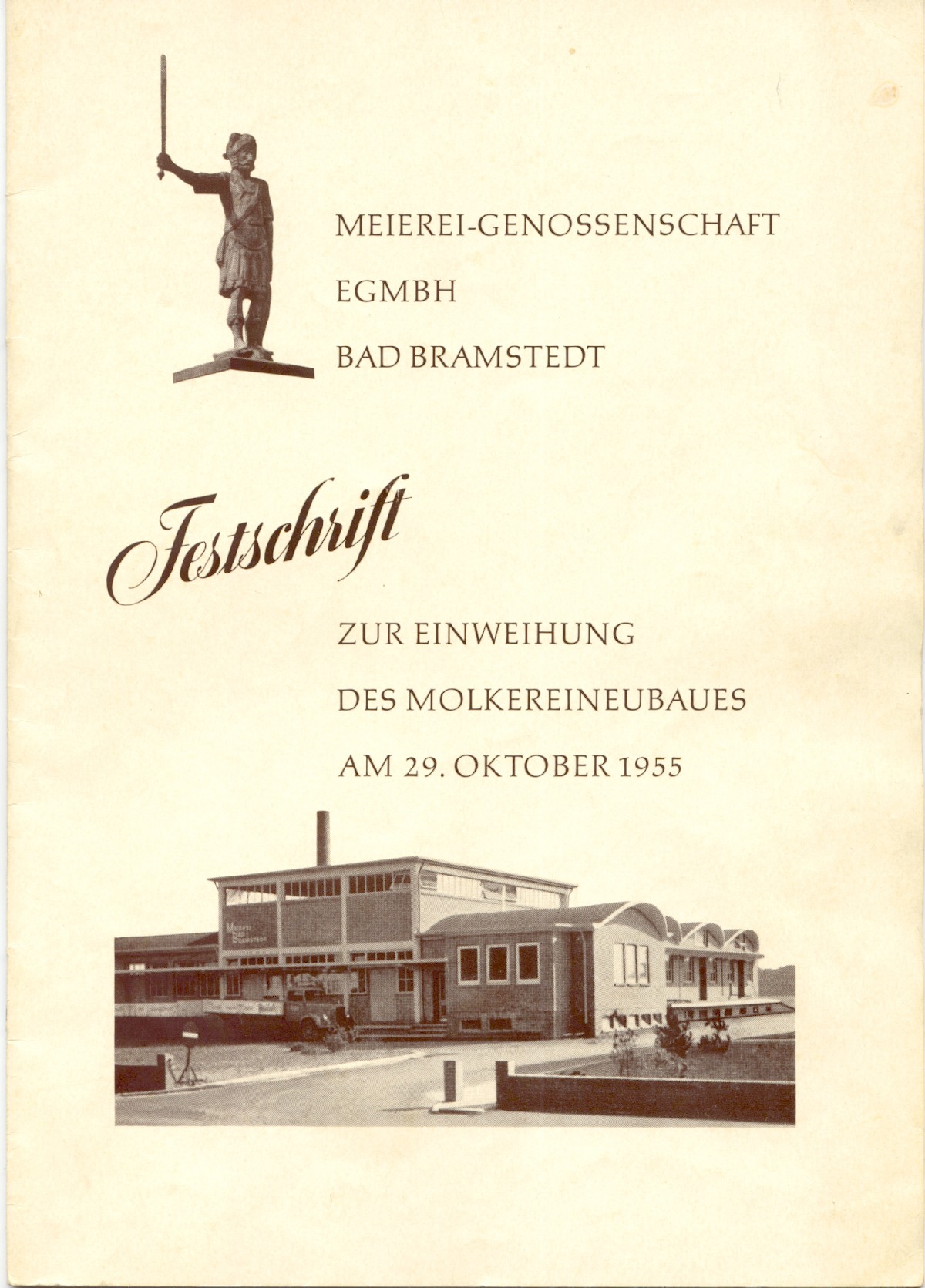
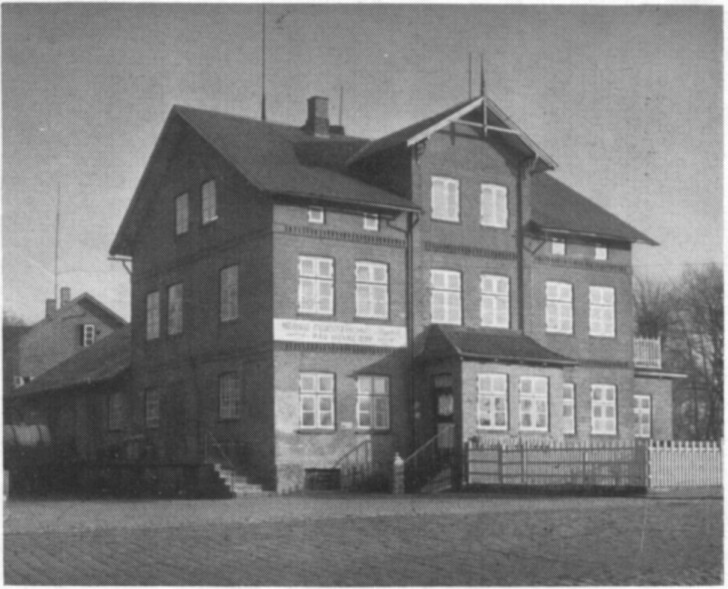
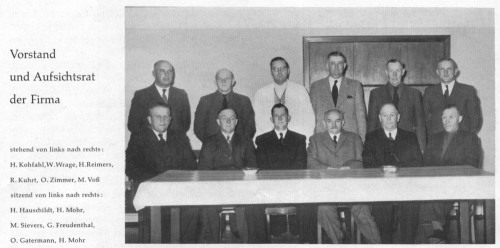
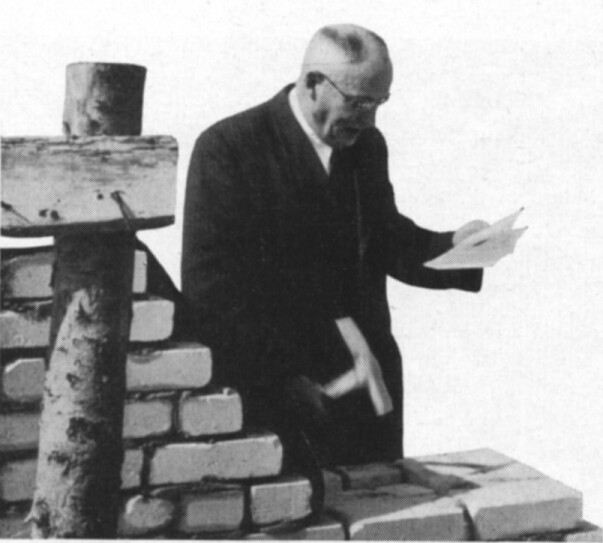 Ansprache des 1. Vorsitzenden des Vorstandes
Ansprache des 1. Vorsitzenden des Vorstandes
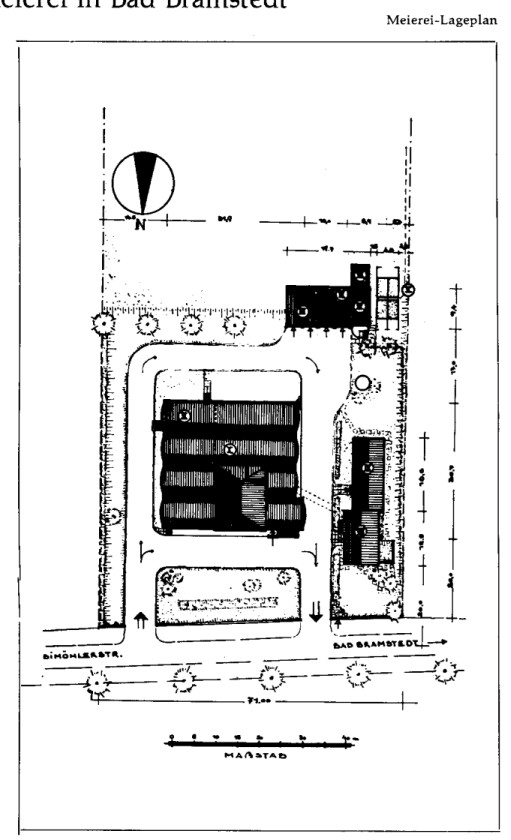
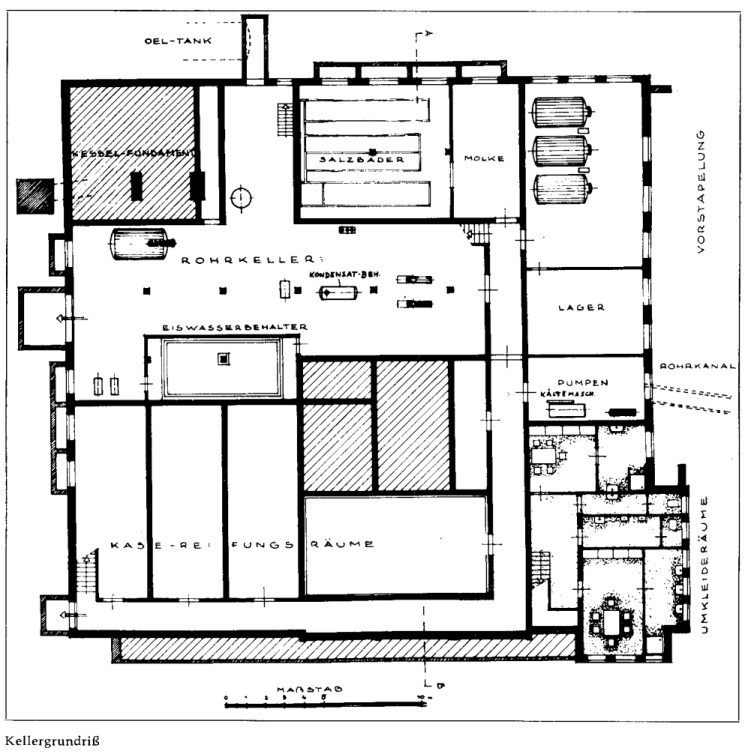
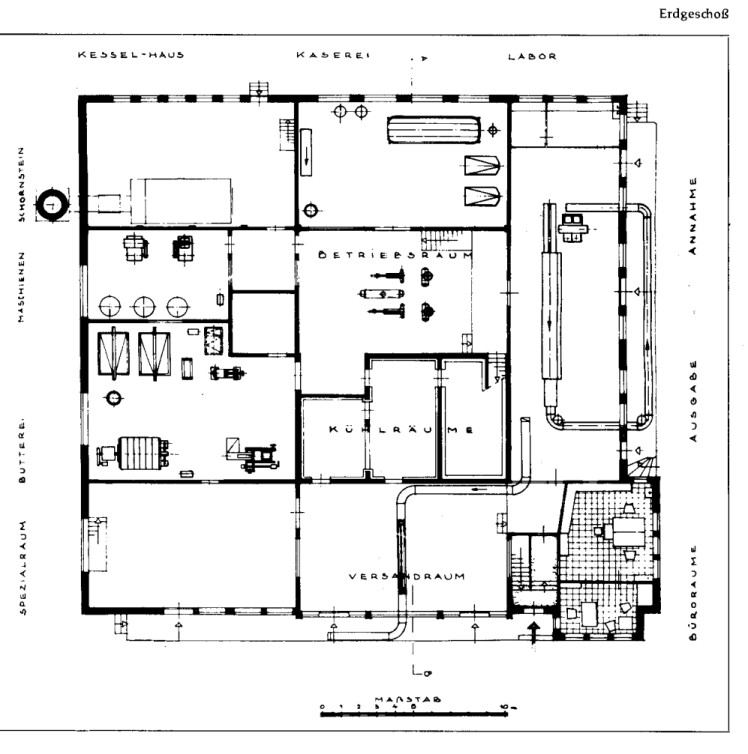
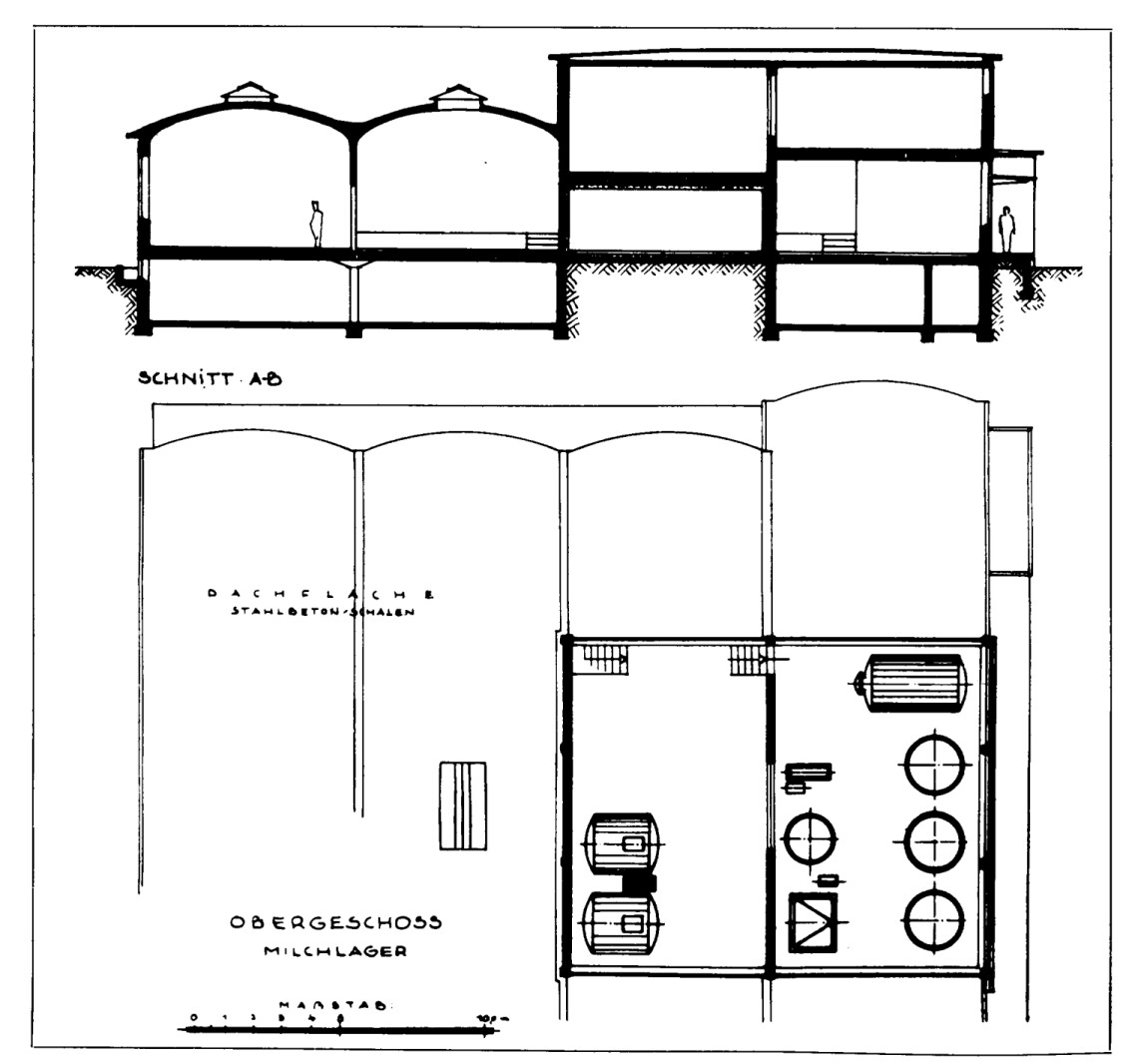 lerräumen, befindet sich die Trinkmilch%shy;lagerung. Dieser Teil ist in der Ansicht (s. Abb.) als Aufbau ersichtlich. Die ganze Grundfläche der Erdgeschoßräume ist unterkellert, mit Ausnahme der Kühlräume und 2/3 des Kesselhauses. Unter der Annahme sind der Raum für die Vorstapelung, ein Lagerraum und ein Pumpenraum angeordnet. Von hier aus geht ein Betonrohrkanal zum Wohngebäude, welcher Kalt= und Warmwasserleitungen, Rohre der Warmwasserheizung und Stromkabel hinüberführt. Unter dem Betriebsraum, dem Maschinenraum und der Hälfte der Butterei befindet sich der Rohr= und Montagekeller, in welchem außer Rohrleitungen, Pumpen, elektrischen Schaltanlagen usw. auch die
lerräumen, befindet sich die Trinkmilch%shy;lagerung. Dieser Teil ist in der Ansicht (s. Abb.) als Aufbau ersichtlich. Die ganze Grundfläche der Erdgeschoßräume ist unterkellert, mit Ausnahme der Kühlräume und 2/3 des Kesselhauses. Unter der Annahme sind der Raum für die Vorstapelung, ein Lagerraum und ein Pumpenraum angeordnet. Von hier aus geht ein Betonrohrkanal zum Wohngebäude, welcher Kalt= und Warmwasserleitungen, Rohre der Warmwasserheizung und Stromkabel hinüberführt. Unter dem Betriebsraum, dem Maschinenraum und der Hälfte der Butterei befindet sich der Rohr= und Montagekeller, in welchem außer Rohrleitungen, Pumpen, elektrischen Schaltanlagen usw. auch die

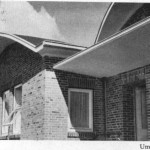
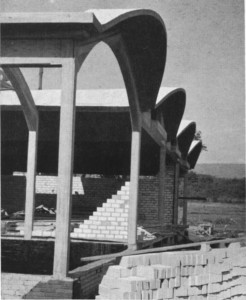 BAUKONSTRUKTION
BAUKONSTRUKTION
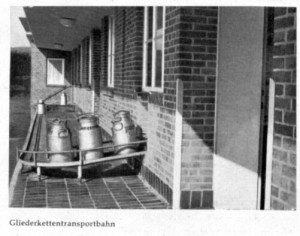
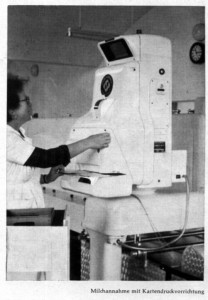
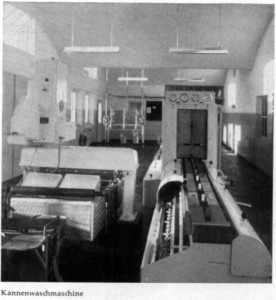 bahnige, kontinuierlich arbeitende Maschine mit Düsenrad der Firma Holstein & Kappert, Dortmund, die entsprechend den Kieler Richtlinien mit mehreren Behandlungsstufen ausgestattet ist. Die Kanne durchwandert nacheinander
bahnige, kontinuierlich arbeitende Maschine mit Düsenrad der Firma Holstein & Kappert, Dortmund, die entsprechend den Kieler Richtlinien mit mehreren Behandlungsstufen ausgestattet ist. Die Kanne durchwandert nacheinander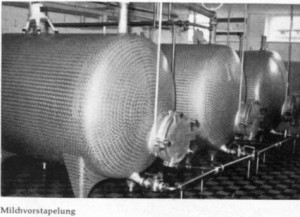
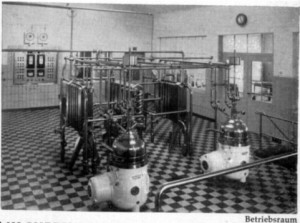
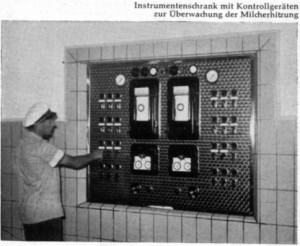
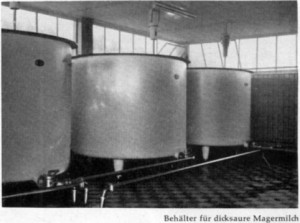 LAGERUNG DER TRINKMILCH,
LAGERUNG DER TRINKMILCH,
 D A M P F V E R SO R G U N G
D A M P F V E R SO R G U N G