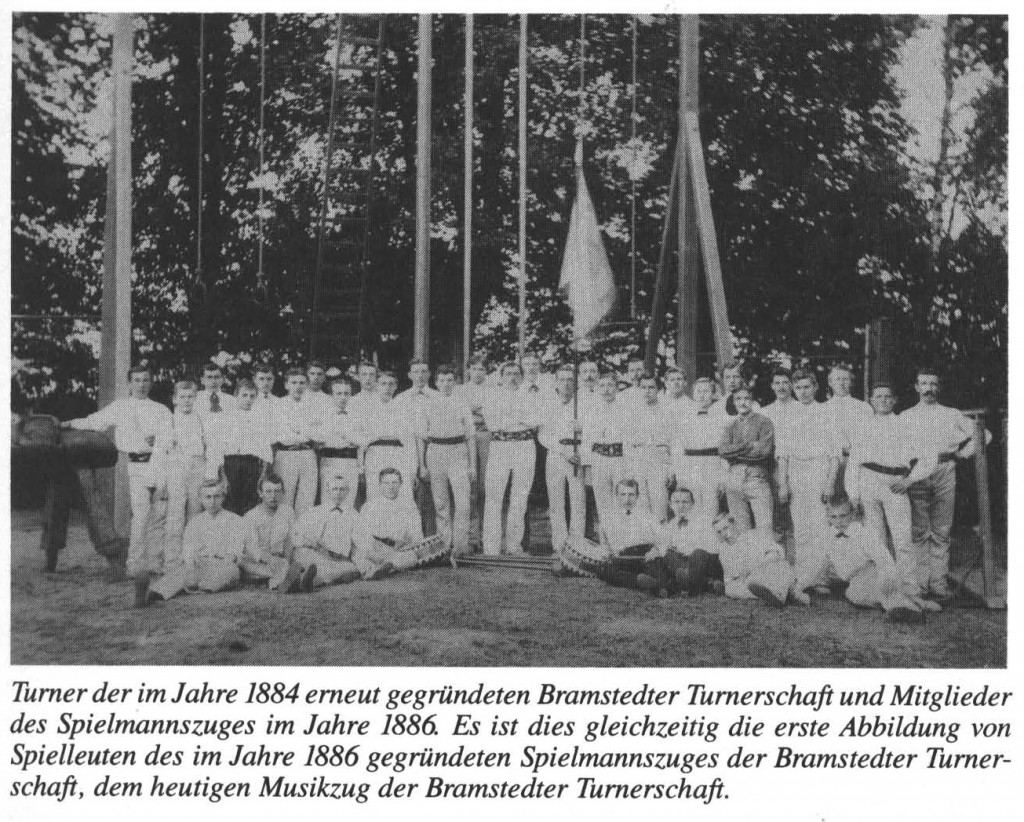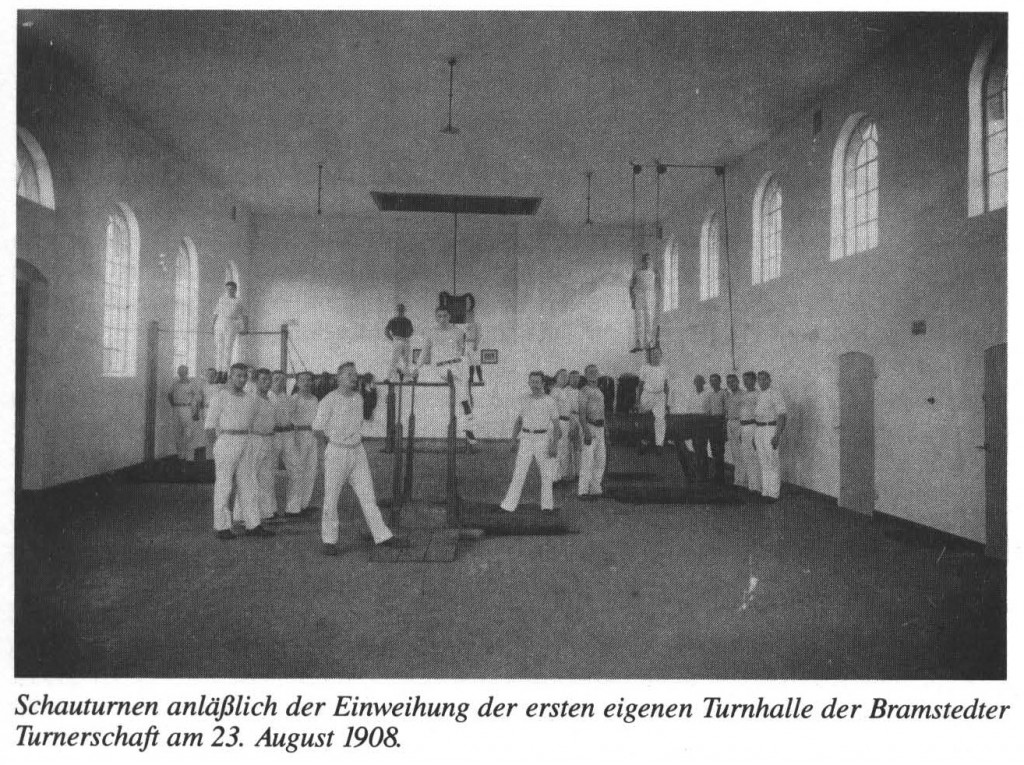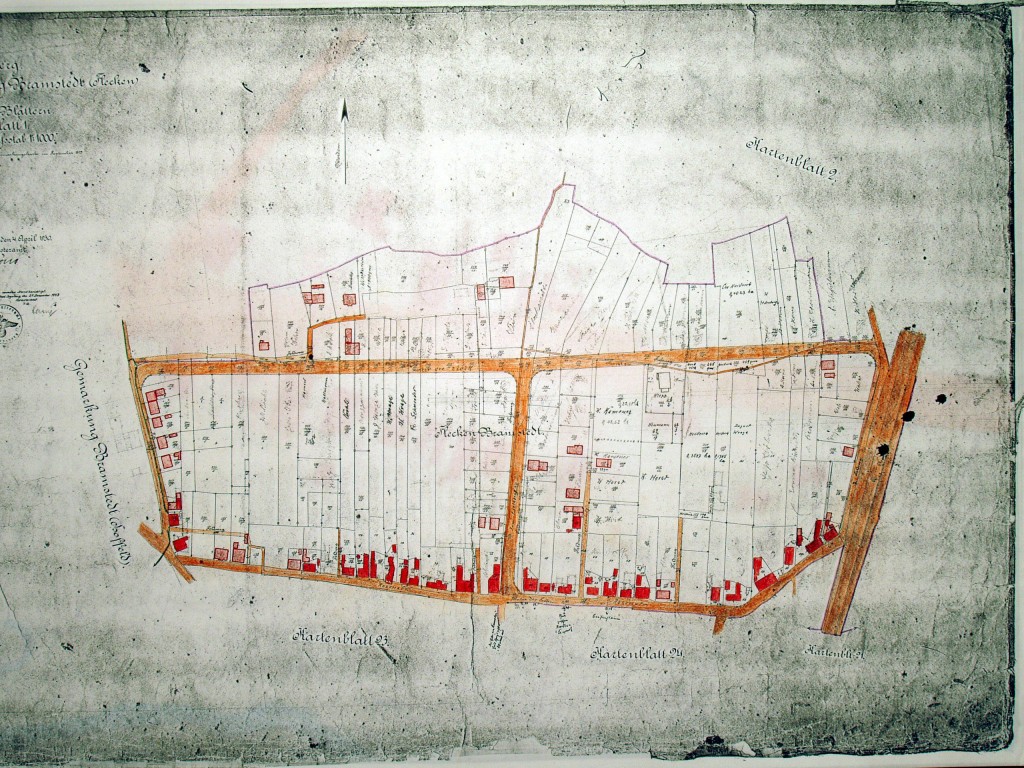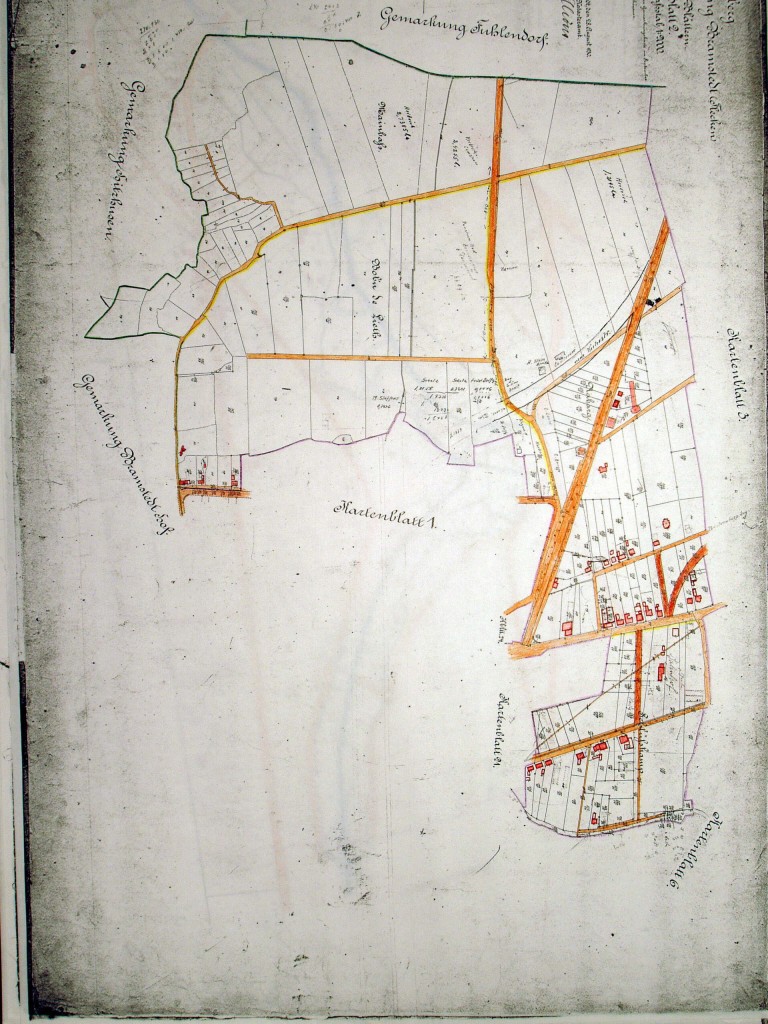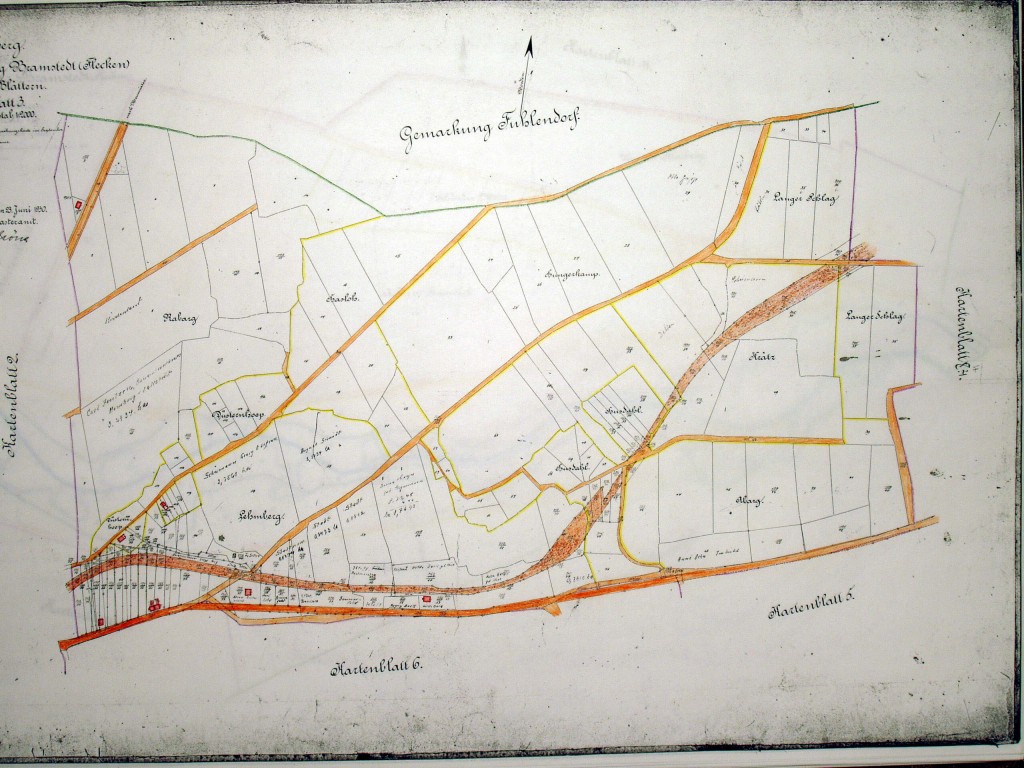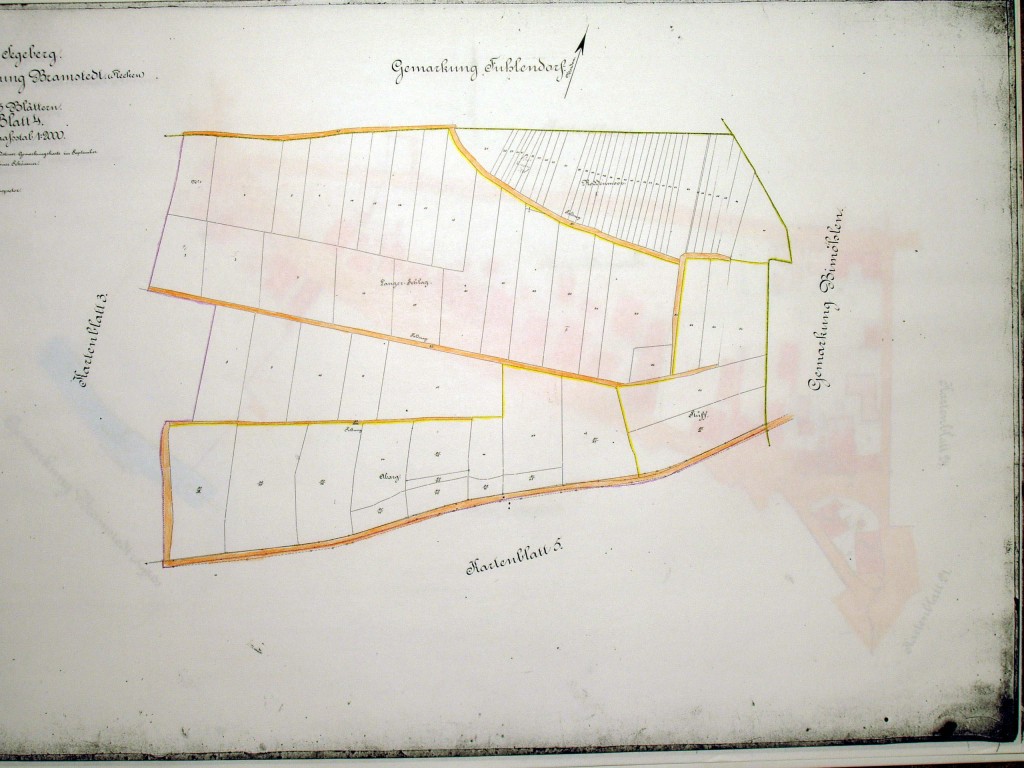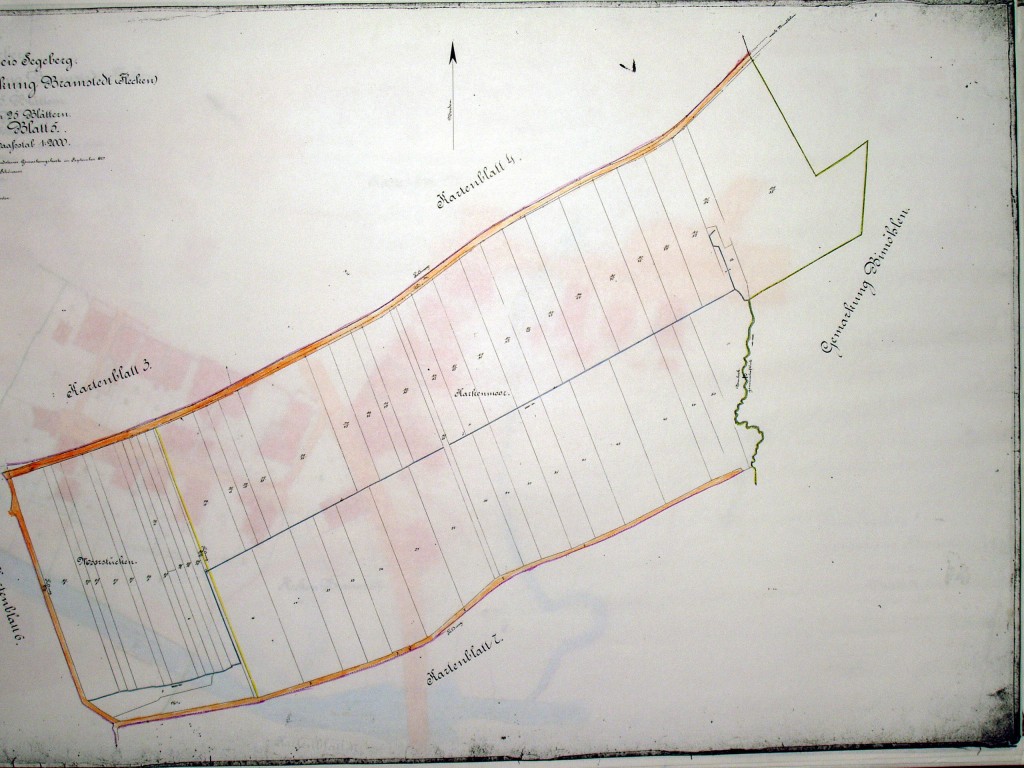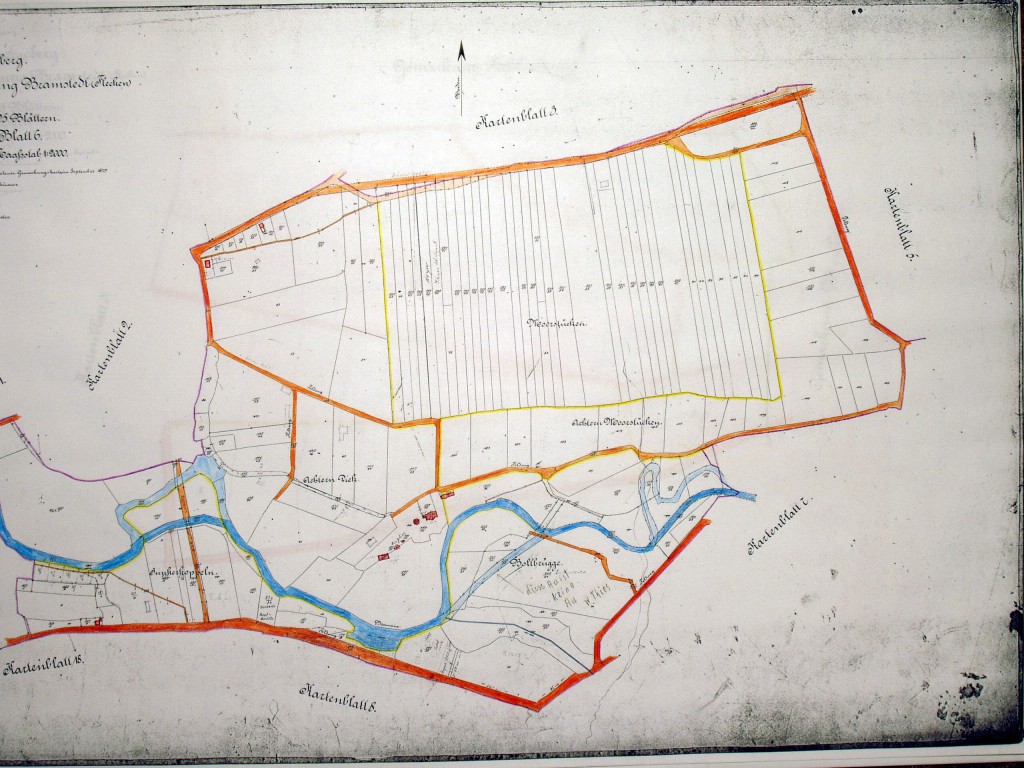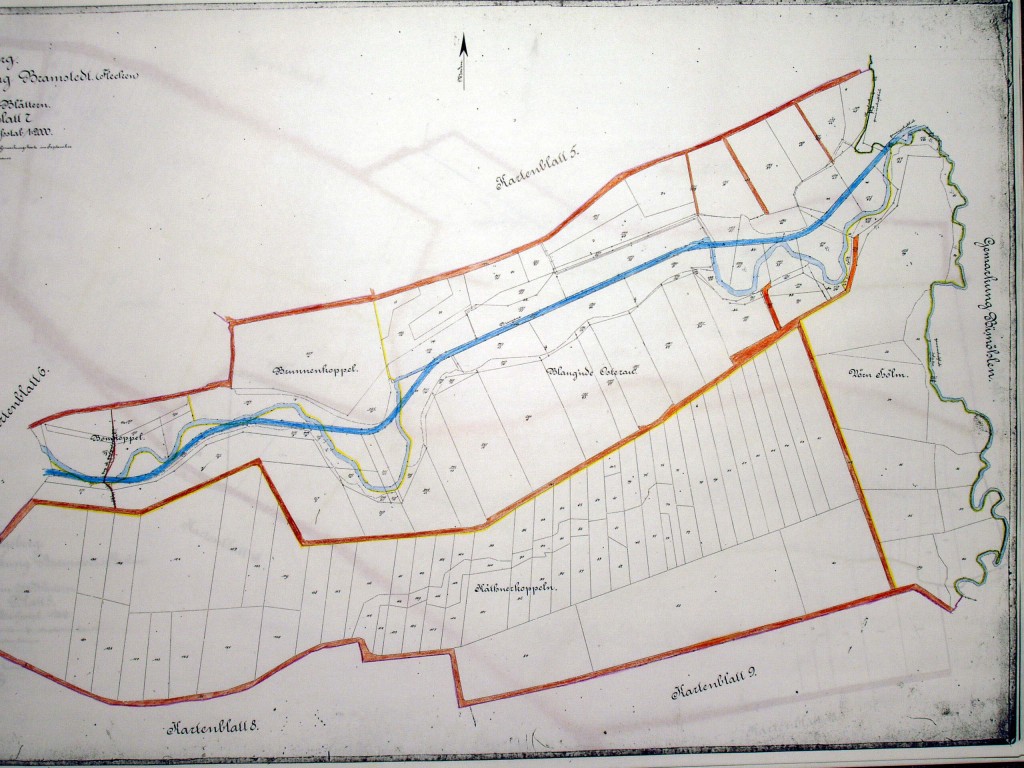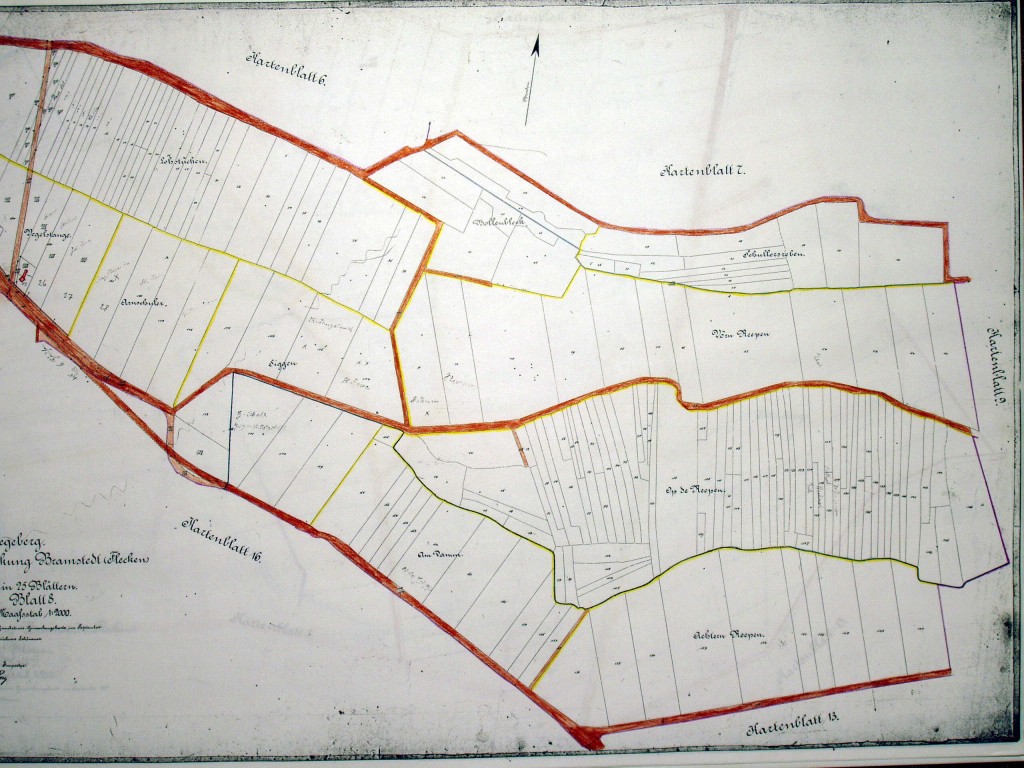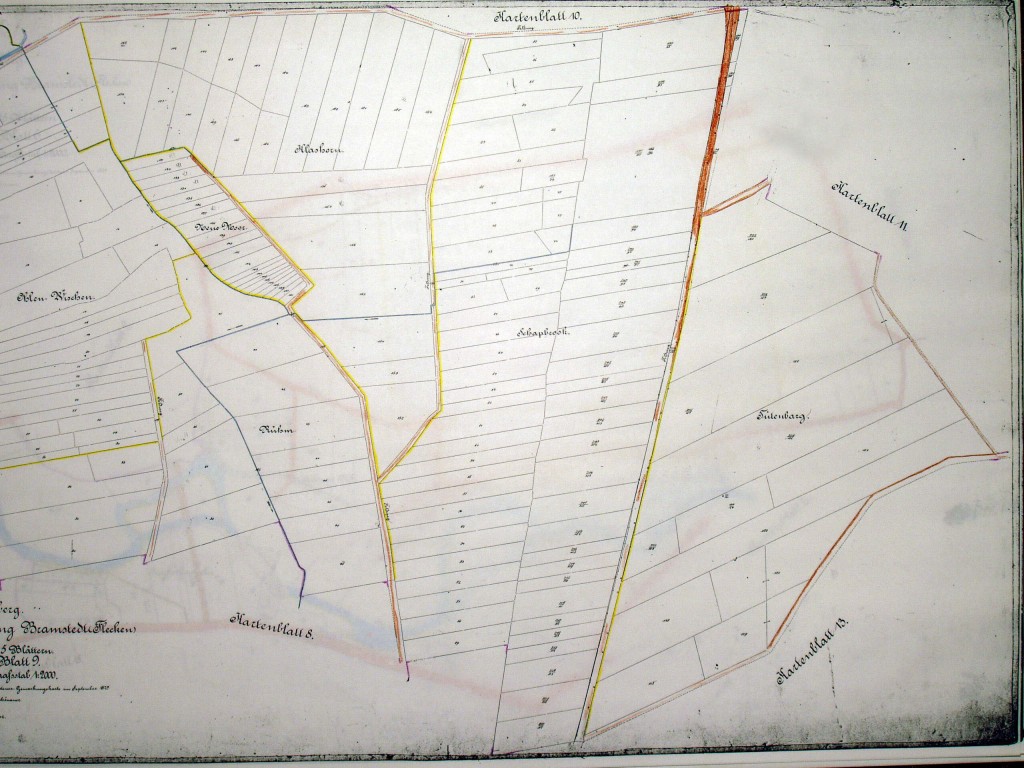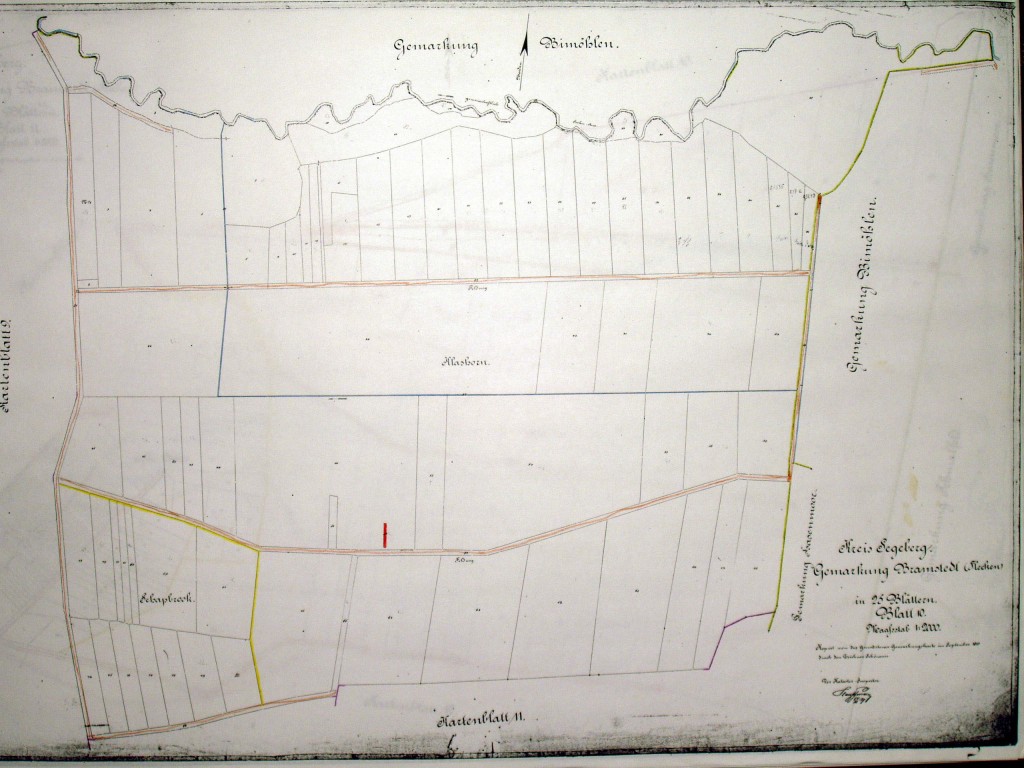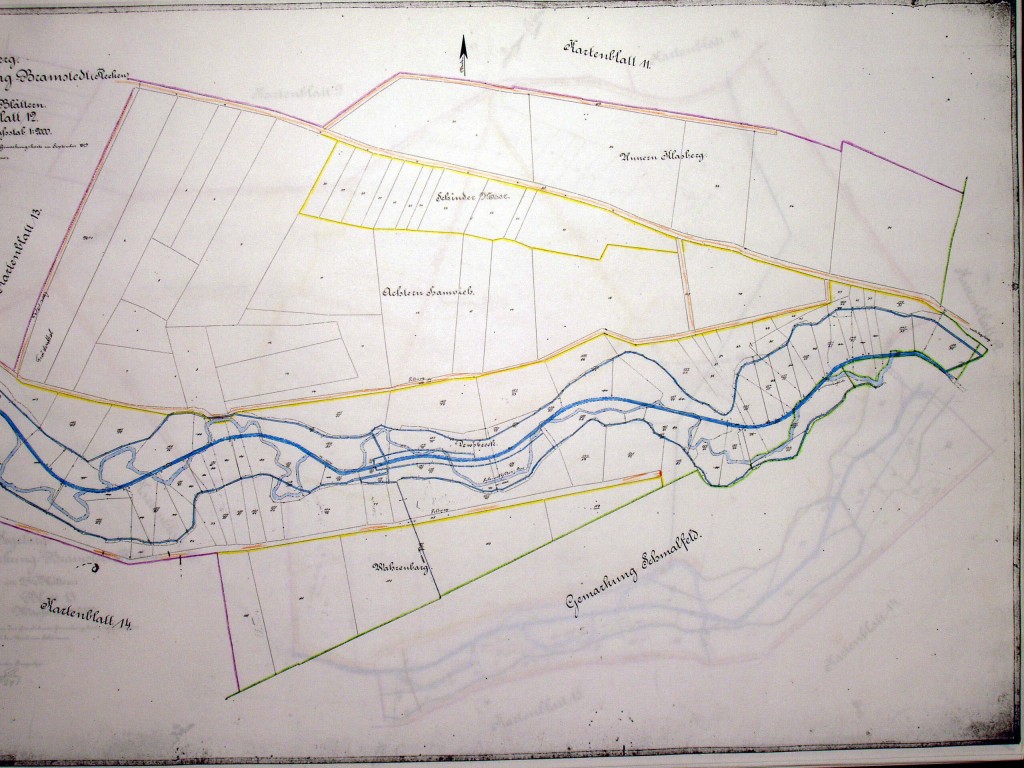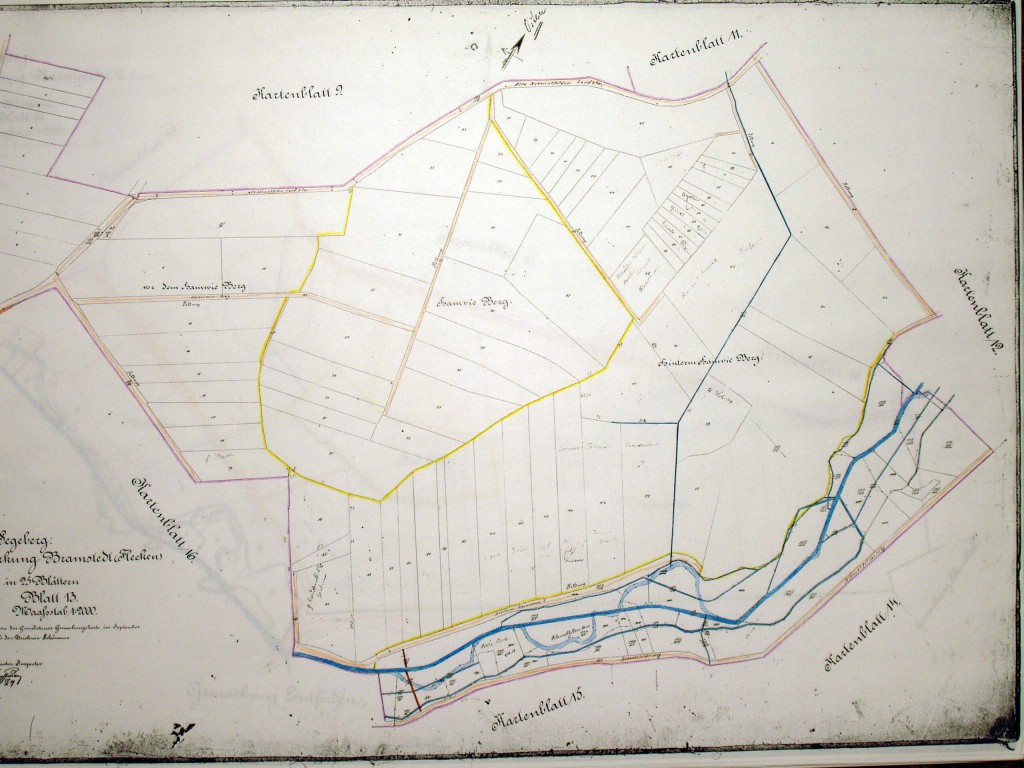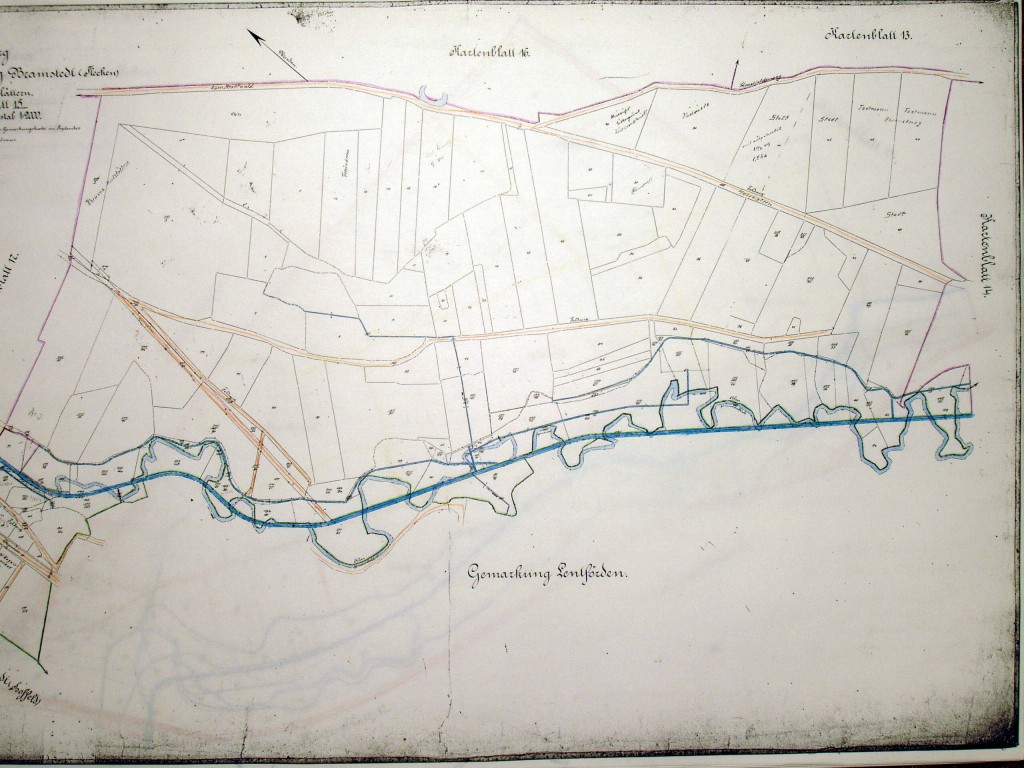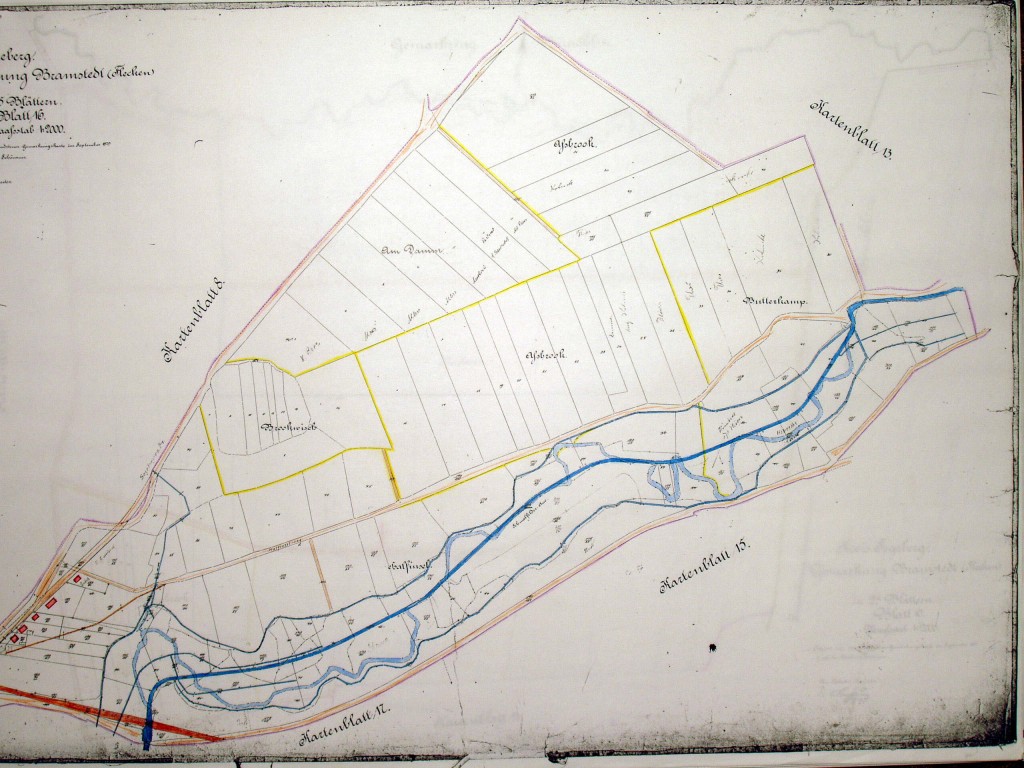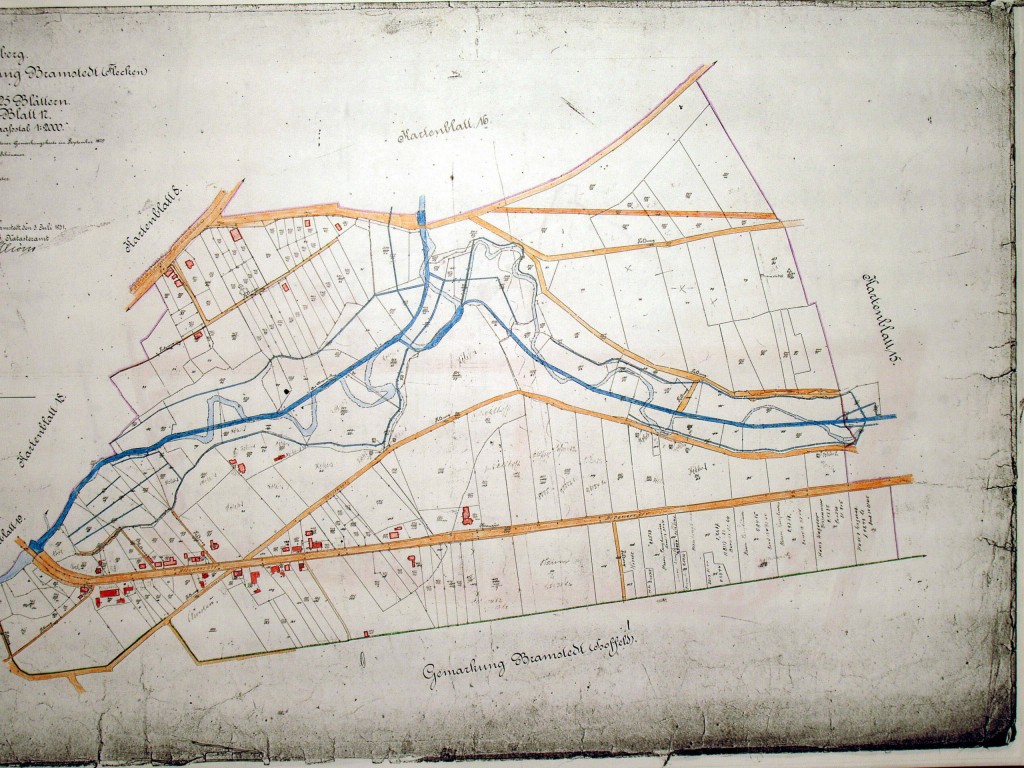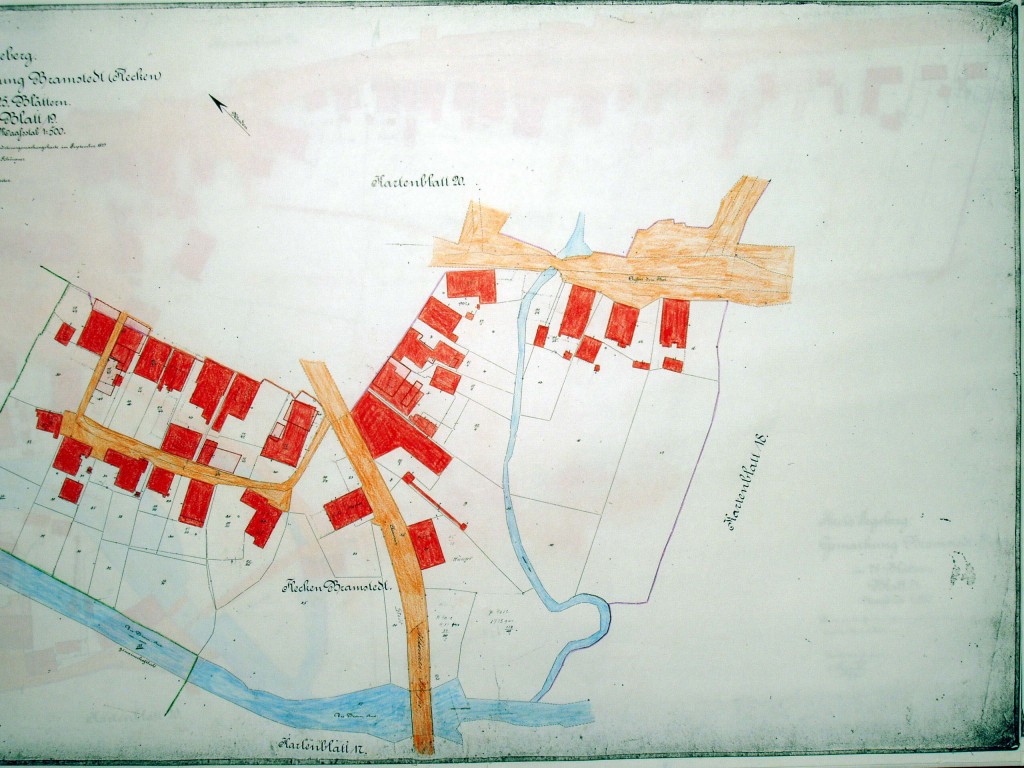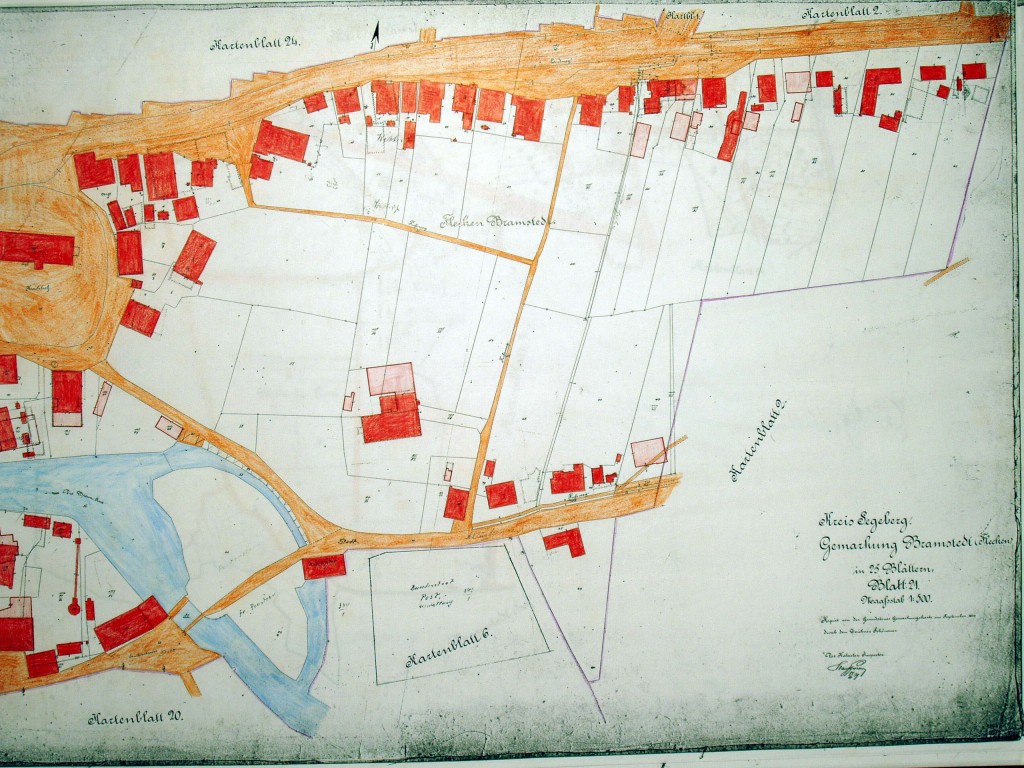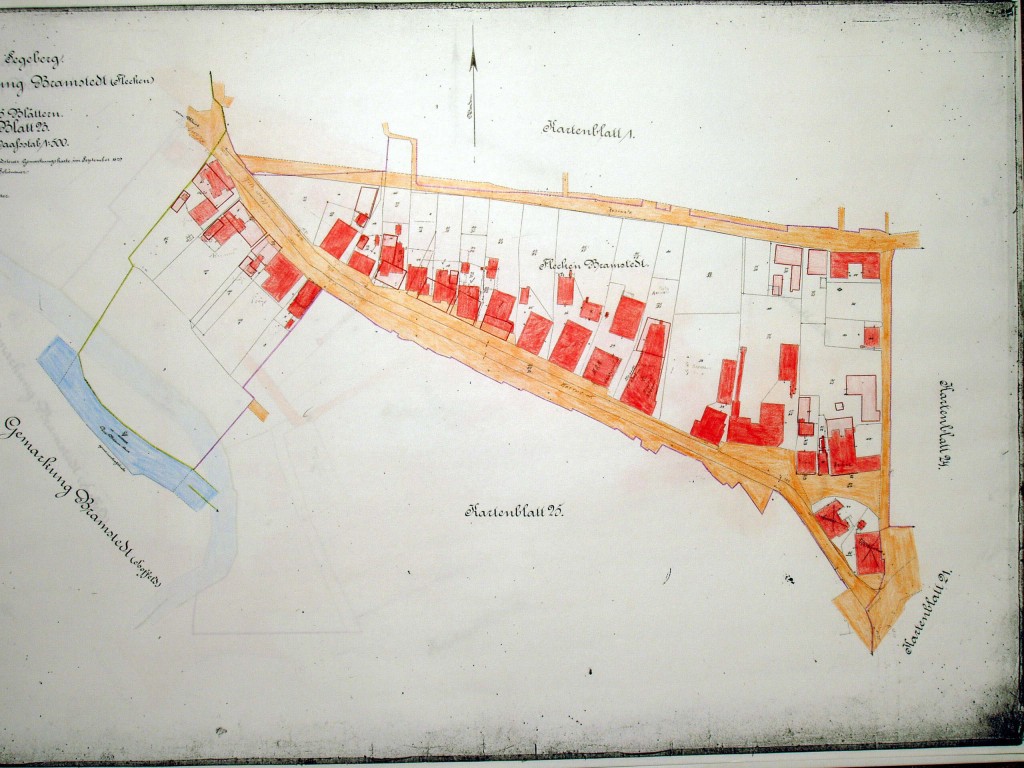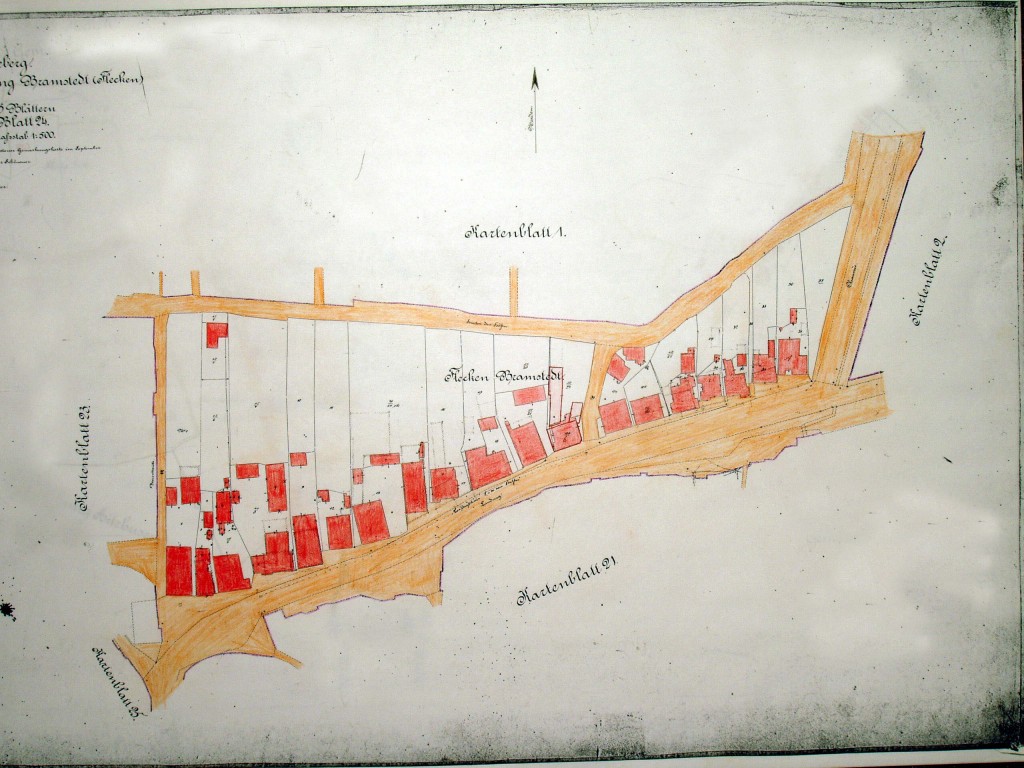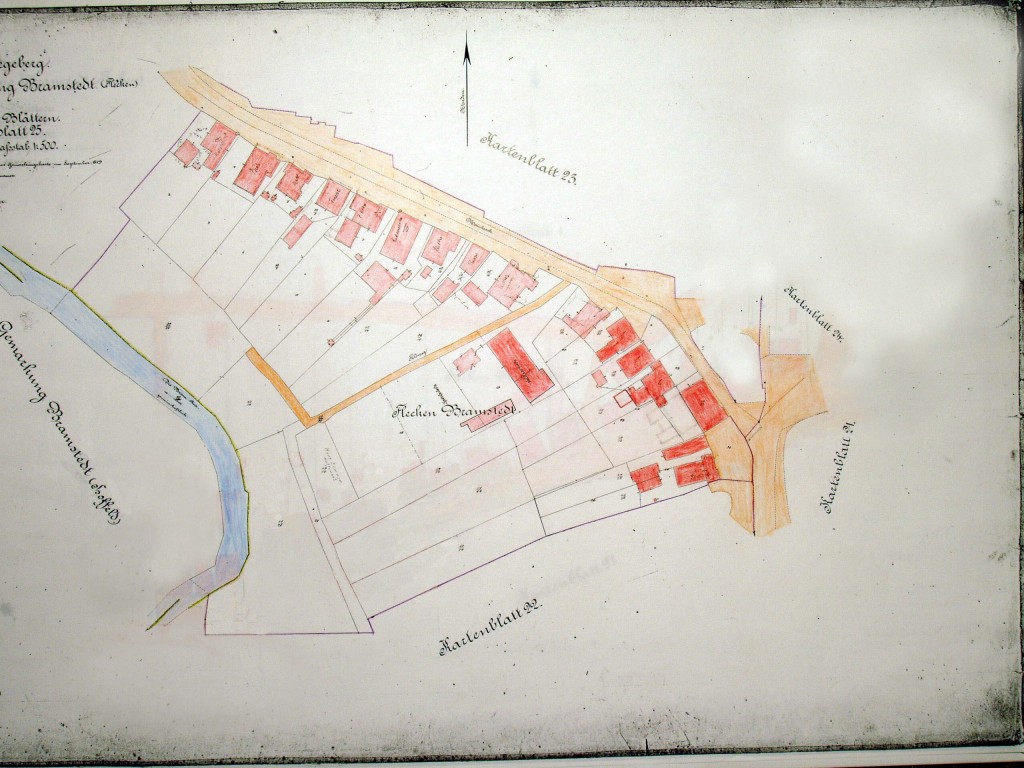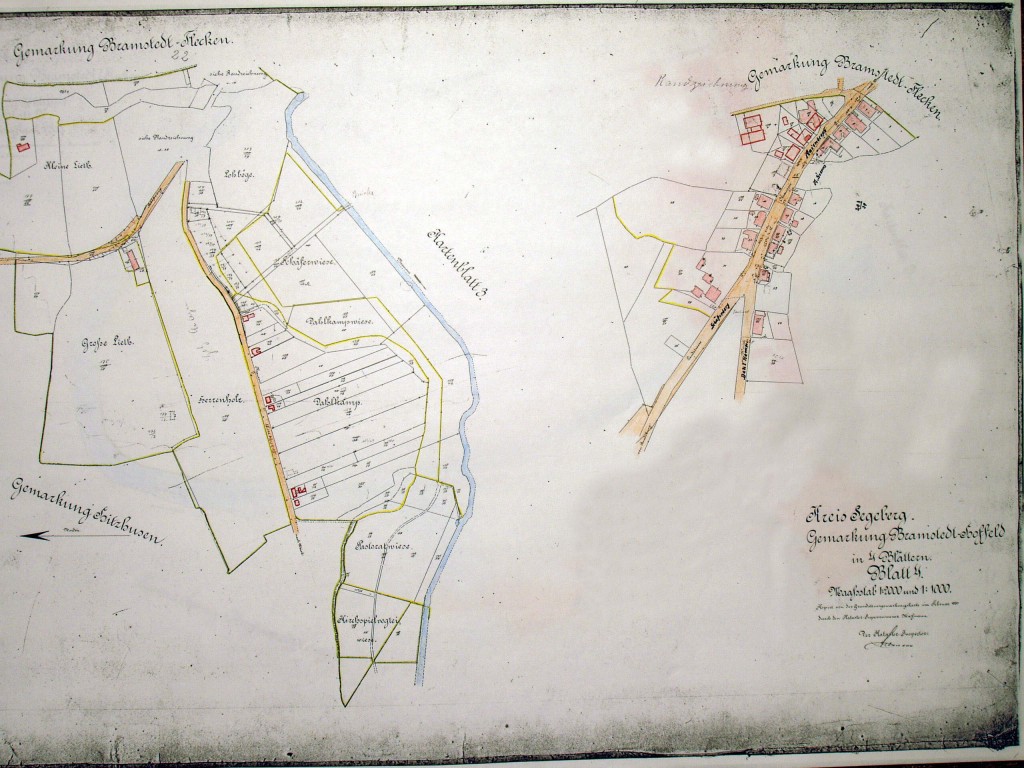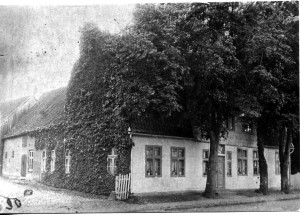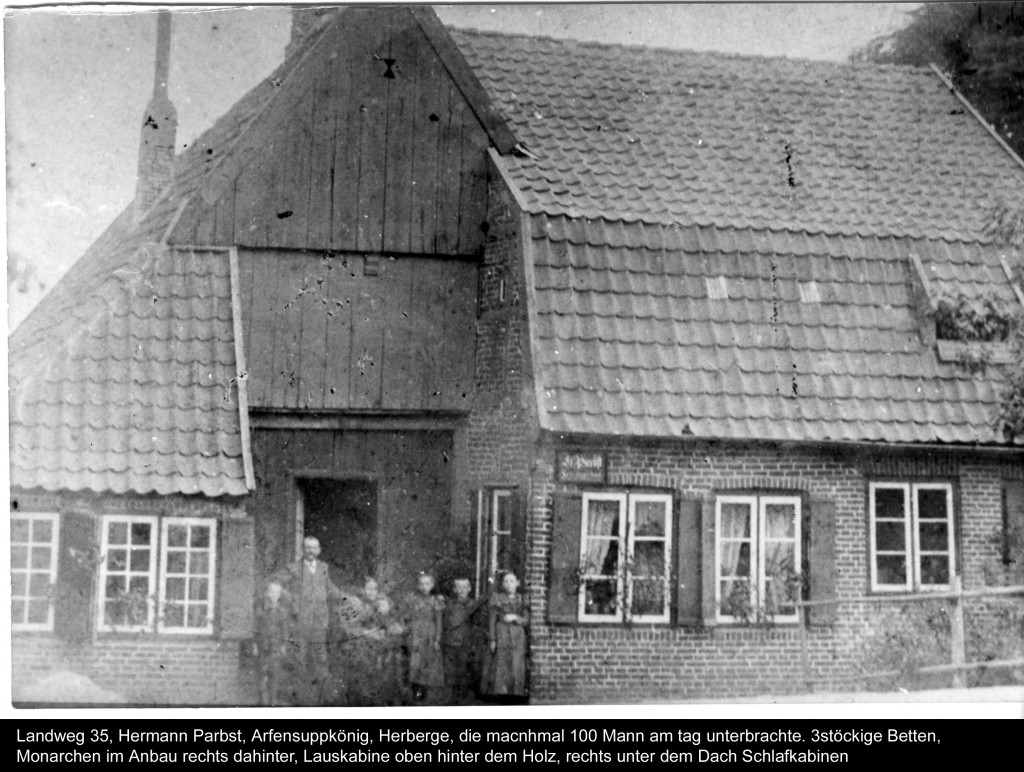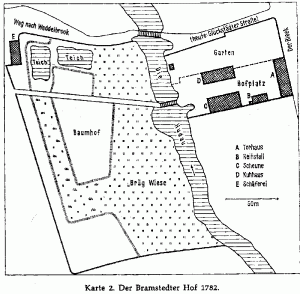Kirchenstuhl „Hinrich Kruse Anna 1629“ in Hohenaspe
Im Zuge meiner Forschungen zu Wiebeke Kruse, deren Bruder einmal Vogt/Verwalter auf dem Gut Drage war und von dem bis heute ein Kirchstuhl in der dortigen Kirche existiert, stieß ich auf Pastor Hansens Chronik. Leider half sie mir nicht viel zu meinem Thema., da Hansen zwar Baltzer von Ahlefeldt nennt, den damaligen Gutsbesitzer, aber keinen Vogt.
Gleichwohl habe ich die Chronik nun aus der Frakturschrift transkribiert und stelle sie anderen Interessenten zur Verfügung./ März 2016
Chronik
des
Kirchspiels Hohenaspe
mit
Drage, Ottenbüttel,
Aspe, Friedrichsruhe und Christinenthal.
von
H. Hansen, Pastor
Hohenaspe.
(Alle Rechte Vorbehalten,)
Hohenaspe 1895.
Selbstverlag des Verfassers
Buchdruckerei von H. H. Bölke, Bordesholm.
| Inhaltverzeichnis |
|
| Einleitung |
1 |
| I. Drage und Aspe |
1 |
| II. Die ältesten Herren von Drage. |
2 |
| III. Die ältesten Herren von Aspe und der älteste Kirchort der Gemeinde Hohenaspe |
4 |
| IV. Drage und Hohenaspe unter den Familien Ahlefeldt und Rantzau |
8 |
| V. Der Edelhof in Ottenbiitiel und seine Beziehungen zu Drage und Hohenaspe |
18 |
| VI. Die Pastoren zu Hohenaspe vor dem Jahre 1757 |
19 |
| VII. Der Grafenmord und seine nächsten Folgen |
23 |
| VIII. Drage und Friedrichsruhe |
29 |
| IX. Christinenthal, das alte Weddelsdorf |
33 |
| X. Die markgräfliche Hofhaltung |
33 |
| XI. Der 20. Oktober 1743 |
43 |
| XII. Das neue Kircheninventar und der Neubau des Pastorats zu Hohenaspe |
47 |
| XIII. Die Sprache bei Hofe |
49 |
| XI V. Die Hofloge und die Hofstühle in der Hohenasper Kirche |
50 |
| XV. Die Grenzen der Drager Jurisdiktion |
51 |
| XVI. Die Erbbegräbnisrechte des Klostersyndikus und des Mehlbecker Gutsbesitzers in Hohenaspe |
52 |
| XVII. Das Verhältnis des Guts Mehlbeck zu Drage |
53 |
| XVIII. Die Kaaksburg und ihre Bedeutung in alter und in neuer Zeit |
56 |
| XIX. Die markgräflichen Herrschaften im Pastorat zu Hohenaspe |
57 |
| XX. Tod und Begräbnis des Markgrafen Friedrich Ernst |
60 |
| XXI. Die markgräfliche Witwe allein ans Friedrichsruhe |
61 |
| XXI!. Die markgräfliche Witwe allein im Pastorat zu Hohenaspe |
62 |
| XXIII. Tod und Begräbnis der markgräflichen Witwe |
63 |
| XXIV. Die Oelbilder der markgräflichen Herrschaften in der Kirche zu Hohenaspe |
63 |
| XXV. Die Parcelierung des Guts Drage |
64 |
| XXVI. Der Verbleib der Hofkirchenstühle |
66 |
| XXVII. Die bisherigen Besitzer der Hofparcele oder des „Stammhofs Drage“ |
68 |
|
|
| XXVIII. Die bisherigen Besitzer der beiden an beiden anderen Haupthöfe seit der Parcelierung |
70 |
| XXIX. Die Pastoren in Hohenaspe von der markgräflichen Zeit bis in die Gegenwart |
72 |
| XXX. Die bisherigen Organisten des Kirchspiels Hohenaspe |
74 |
| XXXI. Die selbständigen Lehrer der Unterklasse in Hohenaspe |
77 |
| XXXII. Die Lehrkräfte der Schulen zu Kaaks, Ottenbüttel und und Looft von Anfang bis setzt . |
78 |
| XXXIII. Die Patrone von Aspe und Hohenaspe |
82 |
| XXXIV. Die Burg bei Lovethe und das alte Looft |
86 |
| XXXV. Der Erbgesessene zu Ridders |
87 |
| XXXVI. Die Legate der Kirche zum Besten Armen und zu kirchlichen Zwecken |
87 |
| XXXVII. Die Gutsinspectoren seit der Parcelierung des Guts Drage |
91 |
| XXX VIII. Die Förster bezw. Holzvögte, Hegereuter und Oberförster aus Drage seit der Parcelierung . . |
94 |
| XXXIX. Die Neujahrsfeier 1800 |
96 |
| XXXX. Die Kleinode des Jahres 1817 |
98 |
| XXXXI. Die Arbeiten der Gesundheitskommission zur Abwehr der Cholera 1881 und 1882 |
100 |
| XXXXII. Entsetzliche Thaten im Jahre 1848 |
101 |
| XXXXIII. Die Hohenasper Kirchenglocke und das Jahr 1848 |
103 |
| XXXXIV. Der Glockenumguß und die Kirchenuhr |
104 |
| XXXXV. Die Herzogliche Zeit 1863—1864 |
107 |
| XXXXVI. Die Gedenktafeln in der Kirche zu Hohenaspe |
107 |
| XXXXVII. Das Kaisermannöver 1881 |
108 |
| XXXXVIII. Der Bau der neuen Orgel und die Renovierung des Orgelchors |
109 |
| XXXXIX. Die Erweiterung des Kirchhofs, die Kirchhofsregulierung und die neuen Kirchhofsregister |
111 |
| L. Die Ablösung der Reallasten |
111 |
| LI. Der 12. Februar und der weitere Verlauf des Jahres 1894 |
112 |
| LII. Chausseebau und Eiscnbahnprojekte |
113 |
| LIII. Kirchliche Zahlen |
114 |
| LIV. Das Kirchensiegel |
116 |
| LV. Die Kirchenvisitationen in den Jahren 1893 und 1894 |
117 |
| LVI. Der neueste Kirchenschmuck |
117 |
| LVII. Die gegenwärtige Kirchenvertretung der Kirchengemeinde Hohenaspe |
118 |
| Ergänzungen, Berichtigungen und Anhänge . . |
118 |
| Schluß |
133 |
Wer eine Chronik schreiben will, muß über alle Kapitel, die sie enthalten soll, genügend unterrichtet sein. Hat, der hier wagt, mit einer solchen von Drage, Hohenaspe und Friedrichsruhe in die Oeffentlichkeit zu treten, und allen Freunden der Heimatskunde nah und fern, namentlich aber den Bewohnern feiner neuen Heimat, einen Dienst zu erweisen, in kaum zwei Jahren schon das ganze reichhaltige Material bewältigt, so daß er einen klaren Einblick in die gar interessante Vorzeit aller Stätten, welche schweigend jetzt die Drager Aue durchzieht, zu bieten vermag? Lieben Freunde, kommt und leset und urteilt hernach. Unfehlbarkeit beansprucht der Verfasser für seine Arbeit nimmermehr; er wünscht nichts weiter, als daß ihm Gerechtigkeit widerfahre, als daß man alles prüfe und das Gute behalte und anerkenne, er habe seine Muße nicht übel angewandt. Auf das unsichere Gebiet, von dem die sogenannten „Negenbargen“ des Kirchspiels Hohenaspe an der Landstraße nach Lockstedt zeugen, wie auch die anderen acht hier und da zerstreuten Spuren des Heidentums der grauen Vorzeit, hat er sich nicht gewagt. Mögen Archäologen die uralten Heidengräber aufdecken und an ihre Funde ihre Vermutungen und Behauptungen und Hypothesen reihen. Seine Chronik beginnt erst auf historischem Grund und Boden, in den bereits die edle Saat des Christentums gefallen.
I. Drage und Aspe.
Die Namen Drage und Aspe erklären sich nicht schwer. Das dänische, beziehungsweise norwegische, Wort „Drage“ bedeutet entweder „Ziehen, Schleppen“ oder „Drache“.
Gewiß ist anzunehmen, daß der, welcher historisch nachweisbar zuerst diesen Namen führte und seinem Besitztum diesen Namen beilegte, den Wikingern entstammte, welche bekanntlich ihren Namen von den „Biker“ oder Meeresbuchten ihrer nordischen Heimat hatten, vom Schluß des neunten bis in den Anfang des elften Jahrhunderts durch ihre kühnen Nie er- und Heerfahrten halb Europa in Aufregung und Schrecken versetzten und auf ihren „Drachenschiffen“ nachweislich auch die Elbe und Stör hinaussegelten und sich in den Besitz der wertvollen Uferlande dieser Ströme setzten; vielleicht auch, daß derselbe als dauerndes Andenken einen Drachen in seinem Wappen führte. „Herr vom Drachen“, — nun, welcher Name lag dem Wikingersohn näher als dieser? Ein Unsinn dagegen, sich „Herr von Ziehen“, „Herr von Schleppen“, beziehungsweise „Herr vom Schlepper, Schleppschiff“ zu nennen. Welchen Adel trug wohl ein Schlepper alter Zeit? Der Schlepper, das Schleppschiff, die holländische „Treckschuit“, konnte nur Knechten den Namen bieten. Schlichte Schleppschiffer sind es gewesen, welche in der Treenegegend später ihren Hütten in der Nähe der größeren Stapelorte den Namen „Drage“ gaben; das ist unzweifelhaft, wie die Berechtigung gewiß, das Gut dort an der Drager Aue als einst in grauer Vorzeit erwünschte Beute nordischer Drachenschiffe anzusehen.
Aspe aber heißt, wie jede gute Botanik lehrt, die „Zitterpappel“ mit ihren rundlichen, eingezackten, an langen Stielen stehenden Blättern, die bei dem leisesten Windhauch in zitternde Bewegung geraten, die schnell und gerade in die Höhe wachsende und schon in 30 Jahren ausgewachsene, sehr leicht absterbende Pappelart, auch Espe genannt und durch das Sprichwort: „Er zittert wie Espenlaub,“ allgemein bekannt. Noch heute hat der „Stammhof Drage“ eine lange Reihe solcher Aspen oder Espen, und hat zweifelsohne die älteste auf dem jetzt zum Teil zum Pastorat gehörigen „Burgfierth“ an der Kaaksburger Landstraße neben der Drager Aue belegen gewesene Burg „Aspe“ neben Aspen gestanden, und nach ihrem Abbruch das Hofland an der Höhe, auf welcher jetzt die Kirche liegt, mit seinen „Buren“-Wohnungen, daran noch das Grundstück „Burendahl“ neben den Grundstücken „Burgfierth“ und „Hofloth“ erinnert, den Namen „Aspe“ beziehungsweise „Hohen-
Aspe“ allein behalten oder allein weiter geführt. Die ähnlich benannten Orte Großen-Aspe, Krog-Aspe, Timm-Aspe werden sämtlich gegen diese Ableitung schwerlich protestieren, weil auch sie ja allzumal in Pappelgegend liegen.
Der Name Drage hat durch alle Zeiten bis aus den heutigen Tag sich unverändert erhalten, während schon vor dem Jahre 1347 „Aspe“ zum Unterschied von den vorhin genannten Ortschaften, jedenfalls von Großen-Aspe, die Vorsatzsilben „Hohen“ bekam und nur im Volksmund noch heute den alten Namen führt. Wann der Bindestrich außer Gebrauch gekommen, ist mit Sicherheit nicht nachzuweisen. Die Kirchenregister haben ihn noch bis hinein in die neuere Zeit.
II. Die ältesten Herren von Drage.
Ob der erste historisch nachweisbare Besitzer des nördlich von der „Burg“ am Ufer der Stör, dem späteren Itzehoe, belegenen Gebiets der 1148 unter einer Urkunde Heinrich’s des Löwen*) erwähnte Ethlerus (Ethler, Edler, Edeling, Edelmann), Ritter von Drage, thatsächlich „Drage“ an der Drager Aue zuerst sich angeeignet habe, wir wissen es nicht. Sicher hat er aber seinem Besitz zuerst den Namen „Drage“ gegeben, und ist auch die Familie von Drage lange genug im Besitz ihrer Herrschaft geblieben, um dem Namen „Drage“ für alle Zeiten Dauer zu verschaffen.
Erst 1306 ist nachweislich eine andere Familie, die von Krummendiek, Herrin des Guts geworden. Es folgen einander Heinrich Wittekop, die Ritter Hartwig und Nicolaus (1336) **), Iven (1362), Hartwig II (1400), Schack (1424),
*) Vgl. Westphalens monumenta inedita II p. 20.
**) Nach von Schröders Topographie schenkte dieser, welcher der 1338 als Propst, d. h. Verbitter, des Klosters zu Itzehoe erwähnte Nicolaus zu sein scheint, weil er ja bekennt, er habe „von seinem edlen Herrn, dem Grafen Gerhard, die höhere und niedere Gerichtsbarkeit erhalten“ (judicium majus et minus recepisse). der Kirche zu Großen-Aspe eine Wassermühle in Bulle oder Bole. Die Angabe ist falsch. Die betr. lateinische Urkunde über „Nicolay de Crummendyke donatum in usum ecclesiae Aspae Anno 1336″, kopiert aus Noodt’s „Beiträgen zur Erläuterung der Civil-, Kirchen- und Gelehrtenhistorie“ (Hamburg 1752 Seite 90) liegt im Kirchenarchive zu Hohenaspe. Es handelt sich auch nicht um eine Mühle im ehemaligen Kirchdorf Bulum oder Bole bei
Hartwig III (+ in Prag) und Detlef von Krummendiek. Leider ist eine Tafel mit den Namen der 8 ersten Kirchenpatrone und dem Krummendiekschen Wappen, welcher der als Schriftsteller auf dem Gebiet der vaterländischen kirchlichen Altertümer rühmlichst bekannte Nic. Friedr. Gens (geb. 12. März 1710 in Neuenkirchen in Norderdithmarschen, vom 14. September 1737 bis zu seinem Tode, den 25. März 1785, Pastor in Krummendiek) noch gekannt *), aus der Hohenasper Kirche verschwunden.
Um 1500 ist der Besitz an die von Sehestede übergegangen. Dem ersten dieser Familie, Henneke, Amtmann in Kiel, folgt 1562 Wulf zu Sarlhusen. Sein Sohn Gabriel verkauft an seinen Bruder Henneke auf Perdöl um 1580.
Mögen diese beiden letztgenannten Familien hohe Bedeutung und noch so große Berühmtheit gehabt haben, die der Herren von Drage haben sie jedenfalls nicht ausgelöscht, und auch ihre Besitzuachfolger sind ungleich hervorragender gewesen als sie.
III. Die Ältesten Herren von Aspe und der älteste Kirchort der Gemeinde Hohenaspe.
Daraus, daß Herren von Aspe erst im 16. Jahrhundert erwähnt sich finden, daß historisch nachweisbar erst Michael von Krummendiek (1531—1546) als Erbgesessener zu Aspe bezeichnet ist und diesem in ununterbrochener Folge zuerst sein Bruder Hartwig, dann dessen Sohn Schack von Beckhof, darauf 1580 dessen Sohn Heinrich und endlich 1598 dessen Töchter Meta von Pogwisch und Margaretha von Ahlefeldt als Erbgesessene zu Aspe sich angeschlossen, und 1602 und 1606 die letzteren das Gut für bezw. 1300 und 2120 Thaler an Baltzer von Ahlefeldt verkauft, **) geht unverkennbar hervor, eiumal, daß das Gut Aspe mit seiner Burg viel späteren Ursprungs als Drage
Borsfleth, sondern um eine solch« in Rolloh (in Rulo), einem Gehöft bei Hohenaspe, an dem noch heute eine Aue vorüberfließt. Vgl. auch die Kopie im Klosterarchiv zu Itzehoe, in welcher deutlich statt „in Bulo“ „in Rulo“ steht. Die Urkunde besagt auch nicht, daß Nicolaus die Mühle verschenkte. Siehe unten „Pfarrer Johannes“.
*) Siehe Archiv für Staats- und Kirchengeschichte Bd. I V. S. 389 f., und unten.
**) Siehe Schröder‘s Topographie.
gewesen, und sodann, daß die Besitzer desselben eine Seitenlinie derselben Familie von Krummendiek gebildet, die, wie oben erwähnt worden, nachweislich seit 1306 Besitzerin von Drage war, und diese Linie ausgemündet in die Familien von Pogwisch und von Ahlefeldt; und wiederum aus dem letztgenannten Ergebnis erklärt sich, daß das Gut und die Burg Aspe seit Anfang des 17. Jahrhunderts verschwunden sind.
Wo aber werden wir dann den ältesten Kirchort der Gemeinde Hohenaspe zu suchen haben, wenn nicht auf der Höhe des nach dem Gute und der Burg Aspe genannten Aspe oder Hohen-Aspe?
Er lag auf der Höhe, welche schon früher als das Gut und die Burg, und zwar aus gleichem Grunde, den Namen Aspe und später Hohen-Aspe führte.
Schon 1217 wird die älteste, 1616 abgebrannte Kirche in Hohenwestedt erwähnt *) Diese aber wurde, wie auch die Kapelle auf einem Hügel bei Glüsing im Kirchspiel Hohenwestedt, von welcher noch Ueberbleibsel vorhanden sind, und wo angeblich der Pfarrer von Hohenaspe jeden vierten Sonntag Gottesdienst zu halten hatte, offenbar von Hohen-Aspe aus gegründet, weil einer Reihe von Dörfern des Kirchspiels Hohenwestedt, namentlich aber Glüsing (welches 1390 einem Marquard von Glüsing gehörte) und Hohenwestedt, die erst vor etlichen Jahren abgelöste Verpflichtung oblag, eine bedeutende Menge Korn an die Kirche und das Pastorat zu Hohenaspe alljährlich zu liefern. Der Kirchort Aspe oder Hohen-Aspe muß somit schon vor 1217 vorhanden gewesen sein und auf seiner Höhe sein Gotteshaus gehabt haben, und nicht berechtigt ist die Annahme, es sei Hohen-Aspe erst kurze Zeit vorhanden gewesen, als das Verzeichnis der Kirchen Holsteins vom Jahre 1347 erwähnte, es habe Hohen-Aspe eine Kirche mit einem Pfarrer und drei Vikaren und gehöre zur Hamburger Propstei.
War aber nicht schon erheblich früher als 1217 die Höhe von Aspe der Kirchort? Stammt aber nicht, wie einige angenommen, die Kirche auf der Höhe von Aspe schon aus *)
*) Siehe Schröder’s Topographie.
Ansgarius Zeit (865) oder jedenfalls noch aus dem neunten Jahrhundert? *) Was ist an der alten Sage, sie sei etwa 850 Jahre alt und von einem Pater, dessen Bildnis noch 1840 in derselben gewesen,**) gegründet?
Wenn auch die Hohenasper Kirche, gleichwie die der ältesten Zeit entstammende benachbarte Kirche zu Heiligenstedten,***) nach dem Bilde auf ihrem Taufbecken zu den Marienkirchen zählt, so ist das doch sehr unwahrscheinlich, da erstlich historisch nachweisbar nicht 5, sondern nur 4 größere massive Taufkirchen, nämlich sicher Meldorf für Dithmarschen, Schenefeld für Holstein, Hamburg für Stormarn und so gut wie unzweifelhaft Heiligenstedten für den Marschdistrikt an beiden Seiten der Stör, aus Ansgarscher Zeit hervorgegangen sind, #) da ferner die Hohenasper Kirche für eine Distriktstaufkirche viel zu klein war, und endlich die Vermutung, es sei die Sage begründet, daß das älteste Gotteshaus der Gemeinde Hohenaspe beim Dorfe Ottenebotle, ##) dem späteren Ottenbüttel, gelegen habe und erst nach 1148 auf die Höhe von Aspe verlegt sei, sich schwerlich wird widerlegen lassen, weil sehr wohl möglich, daß die ältesten Herren von Drage deren kirchliches Interesse freilich unbekannt, und die ältesten Herren von Ottenebotle ###) (die Herrn von Aspe sind ja nicht in Betracht zu ziehen *#) sich über einen gemeinsamen Kirchort auf der Grenze ihrer Gebiete, mit anderen Worten auf der gleich weit von Drage und von Ottenebotle entfernten Höhe Aspes geeinigt haben, und nachweislich mindestens einer der ältesten Edelleute von Ottenebotle *##) kirchliches Interesse offenbarte, indem er u. a. 1230 in Stellau, dem alten Stilnowe, an der Stör und Bramau, vereint mit 4 dortigen Bewohnern, auf einer Höhe eine Kirche erbauen ließ.
*) Siehe Dr. Rich. Haupts Bau- und Kunstdenkmäler.
**) Es ist nicht mehr vorhanden.
***) Sie war als Kapelle oder Taufkirche jedenfalls schon 834 vorhanden.
#)Siehe Michelsens Schlesw.-Holst. Kirchengesch. I. 113.
##) Siehe unten,
###) Siehe unten.
*#) Stehe oben.
*##) Siehe unten.
Wir werden in einem von Ottenebotle besonders handelnden späteren Kapitel, nachdem wir zuvor die Geschichte Drages und Aspes bezw. Hohen-Aspes weiter verfolgt, darauf zurückzukommen haben und geben hier nur entschieden der Ansicht Raum: Es kann bei Ottenebotle, dem späteren Ottenbüttel, dessen Name unverkennbar auf einen Otto und vielleicht auf einen der sächsischen Kaiser dieses Namens (von allen dreien, Otto I. (936 – 973), Otto II. (973 – 983) und Otto III. (983 – 1002), heißt es ja, daß sie Heereszüge durch Holstein nach Dänemark unternahmen, von Otto I. aber zumal ist ja bekannt, daß er um 965 dem König Harald das Christentum aufzwang) hinweist, sehr wohl ein bereits aus vorvicelin’scher Zeit hervorgegangenes Gotteshaus (eine Kapelle) gestanden haben; dies Kirchlein, welches, wie weitaus die meisten Kirchen aus der noch mittellosen ältesten christlichen Zeit, nur ein räumlich sehr beschränkter, notdürftig ausgestatteter, schmuckloser Holzbau gewesen sein kann,*) wird wahrscheinlich den heidnischen Wendenscharen, welche 1066 bis 1106 im Hamburger Sprengel nordwärts der Elbe, in Holstein, Stormarn und Dithmarschen als Herren des Landes das Christentum fast völlig zerstörten,**) zum Opfer gefallen, und allmählich spurlos verschwunden sein, und wird die steinerne Kirche auf der Höhe Aspes, von wo aus vor 1217 die Kirche zu Hohenwestedt und die Kapelle zu Glüsing gegründet, dieselbe, die 1347 im Verzeichnis der Kirchen Holsteins erwähnt, und die im Jahre 1376 mit „einigen jährlichen Einkünften aus einer Hufe Ottenbüttels“ beschenkt worden,***) in Vicelinscher Zeit (Vicelinus starb 1154 als Bischof in Oldenburg) erbaut und erst die Zweitälteste Kirche der Gemeinde Hohenaspe fein. Diese aber ist ursprünglich nur etwa halb so groß wie jetzt gewesen, was deutlich an dem Mauerwerk zu Westen, welches entschieden ein bedeutend älteres Gepräge hat, namentlich an den uralten untersten Fenstern zur Linken und Rechten des kleinen nördlichen Eingangs, trotzdem fast durchweg Felsen verwandt worden, und die Fenster der östlichen Hälfte ja mit der Zeit
*) Siehe Michelsens Schlesw.-Holst. Kirchengesch. I. 218 f.
**) Siehe Michelsens a. a. W. I. 176 ff. u. 193 f.
„*) Siehe unten und Schröders Topographie.
modernisiert sein können, wie auch an der wohl erst späteren teilweisen Wölbung der Kirche und manchen anderen Spuren erkennbar sein dürfte. *)
IV. Drage und Hohen-Aspe unter den Familien Ahlefeldt und Rantzau.
Von außerordentlicher Bedeutung für Drage und Hohen-Aspe ist unstreitig der Uebergang der Herrschaft auf die Familien Ahlefeldt und Rantzau gewesen.
Henneke von Sehestede, der Drage 1580 von seinem Bruder Gabriel käuflich erworben hatte, überließ schon selbigen Jahres das Gut für 33 000 Thaler an Claus von Ahlefeldt auf Gelting, und dieser verkaufte es 1581 an Balthasar von Ahlefeldt oder genauer „Baltzer wan Alleweldt“ für dieselbe Summe. „Baltzer van Alleweldt“, der Bruder des vor ihm verstorbenen älteren Hans wan Alleweldt, derselbe, der auf dem Kirchenstuhl unter der Hohenasper Kanzel mit eingeschnittenen lateinischen Buchstaben deutlich als „edler, erntfester“ Sohn des 1559 im Kriege mit Dithmarschen gefallenen „seligen Borgwart“ und der Dorothea geb. von Rantzau von Schmol bezeichnet ist, war Geheimrat, Amtmann auf Rendsburg und Besitzer der Güter Collmar, Neuendorf, Heiligenstedten, Campen und Mehlbeck. Seine Gemahlin war die aus dem erwähnten Kirchenstuhl gleichfalls und auch auf dem sogenannten Mehlbecker Kirchenstuhl (s. nuten) verzeichnete Margaretha zu Rantzow (Rantzau), welche, Enkelin des Feldmarschalls und Statthalters Johannis zu Rantzau, Bothkamp und Breitenburg und seiner Gemahlin Anna, geb. Walstorp, die Tochter Heinrichs zu Rantzau, des gelehrten Gemahls der Christina von Halle und des berühmten Statthalters Königs Friedrich II. von Dänemark in Schleswig und Holstein war, desselben, der, 1590 Besitzer des alten Stammguts „Rantzau“ an der Landstraße zwischen Plön und Lütjenburg geworden, „im Jahre 1598, seines Alters 73″ auf sein Grab zu Itzehoe**) die stolze Inschrift setzen ließ:
*) Vergl., im übrigen Dr. Rich. Haupts „Bau-und Kunstdenkmäler“.
**) Die „Rantzausche Grabkapelle“ wurde neuerdings vom Grafen Kuno zu Rantzau auf Breitenburg renoviert.
„Heinrich Rantzaus Grab. Das übrige wissen die Völker In Europa rings und in der westlichen Welt.“
(Henrici tumulus Ranzoi heic; caetera norunt Europae gentes orbis et occiduus.
Anno Domini 1598, aetatis 73.)
Nicht nur, daß er als Herr von Heiligenstedten und Drage nach 1581*) das sogenannte Ahlefeldt-Rantzausche Herrenhaus mit Burggraben ringsum auf der Höhe zu Norden der Drager Aue erbauen und 1583 am Ufer der Stör das Schloß Heiligenstedten von dem italienischen Baumeister Franz von Roncha aufführen ließ, er war’s auch, der, nachdem er 1602 zugleich mit Rolloh und anderen Grundstücken das Patronatrecht sich käuflich erworben,**) als Patron der Kirche zu Hohen-Aspe durch die sogenannten „Ahlefeldtschen Stiftungen für den Prediger und Organisten in Hohenaspe“ und als Patron der Kirche zu Heiligenstedten durch das sogenannte „Ahlefeldt-Rantzausche Hospital auf dem Stördeich“ seit 1638, dem Jahre, wo sein Testament zur Ausführung kam,***) in unauslöschlichem Andenken in nah und fern gestanden.
Nach seinem am 6. März 1626 zu Kiel erfolgten Tode #) ging das Gut Drage über auf den Ritter, Dompropst zu Hamburg, Königl. Amtmann von Steinburg und Süderdithmarschen, Königl. Landrat und Herrn zu Collmar, Heiligensiebten, Neuendorf, Panker, Hasselburg, Putlos und Campen, Detlef zu Rantzau, seinen mit Dorothea von Ahlefeldt vermählten Schwiegersohn. Samt seiner Gemahlin von demselben Geist der Liebe und Barmherzigkeit erfüllt, wie sein verstorbener Schwiegervater, belegte er nicht nur die von diesem für die Kirche zu Hohenaspe bestimmten 6000 Mark lübisch, mit deren „jährlichen Zinsen ein Kapellan zu Aspe zu ewigen Tagen unterhalten werden sollte, in 2 Höfen der Kirchspiele Brockdorf und St. Margarethen unablöslich zu
*) Vergl., Dr. Rich. Haupt. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein. 1888.
**) Siehe Schröders Topographie.
***) Vergl.. Friedrich Seestern-Pauly. Die milden Stiftungen. 1831. 1. Teil Seite 137 – 143.
#) Er ruht samt feinen Ahnen und seiner Gemahlin und deren Ahnen in der Rantzauschen Grabkapelle zu Itzehoe.
6 1/4 p.Ct., er ordnete auch desselben Schenkung von zwei in der Hollgrube, einer Erbpachtsstelle im Gute Mehlbeck, belegenen Stücken Landes, deren Revenuen halbschiedlich dem Prediger und dem Organisten in Hohenaspe zu gute kommen sollten, und mehrte das von jenem zur Errichtung eines Hospitals, „worin eine Anzahl alter verlebter Armen und anderer ihrer Leibesgebrechen halber sich zu ernähren untauglicher unter beiden adeligen Rittersitzen Heiligenstedten und Drage gesessenen Leute ihren notdürftigen Unterhalt haben und der Gottseligkeit obliegen möchten,“ bestimmte Kapital von 2000 Mark lübisch, welche unablöslich zu 6 1/4 pCt. in einem Hofe der Wilstermarsch belegt waren, um 15 000 Mark lübisch, welche er gleichfalls in der Wilstermarsch in 5 Höfen unaufkündbar zu 6 1/4 pCt. belegte.*) Heimgehend 1639,**) nachdem er unterm 12. Mai 1639 von Glückstadt aus für die betr. Stiftungsurkunden die landesherrliche Bestätigung empfangen, hatte der edle erste Rantzau auf dem Gute Drage aber auch noch durch ein weiteres verdienstvolles Werk sich samt Gemahlin ein unvergängliches Denkmal gesetzt.
Als Patron der Kirche zu Hohen-Aspe hatte er in den Jahren 1630 und 1634 das von den wilden Horden des dreißigjährigen Krieges verwüstete Hohenasper Gotteshaus gründlich renovieren lassen, bei welcher Arbeit wie bei Aufstellung des neuen Missals vom Jahre 1646, der derzeitige Pastor Johannes Lüders, dessen großes Oelbild über dem Beichtstuhl des Pastors zu Norden des Altars der Kirche zu Hohenaspe die Unterschrift trägt: „Johannes Lüders, gestorben 1652 zu Aspe nach 33jähriger Amtsführung,“ treulich mit ihm Hand in Hand gegangen.
Nicht nur daß davon zeugen die um das alte bronzene Taufbecken in erhabener Erzschrift sich findenden Worte: „Anno 1630. Diese Tauffe, so von den kayserlichen Soldaten bey feindlicher Occupirung dieser Lande zerschlagen vnd wegkgeführet, aber die Stücken auff fleissiges Nachforschen herbaygebracht worden, hatt der Königlicher Herr Ambtmann
*) Vergl.. F. Seestern-Pauly a.a.O.
**) Auf seinem Sarg zu Itzehoe steht, daß er, geboren 10. Aug. 1577, abgeschieden den 10. März 1639 durch einen sanften und seligen Tod.
zver Steiinborch Herr Detlef Rantzow Ritter Patron dieser Kirchen wieder vmbgiessen vnd anfertigen lassen durch M. Magnum Brödler“, auch die Worte unten an dem uralten, wahrscheinlich schon um 1460*) gefertigten, wertvollen Altarschrein, auf dem die 12 Apostel, die Verkündigung, die Geburt Jesu, die Weisen, Gabbatha, die Geißelung und die Kreuztragung dargestellt sind, liefern den klaren Beweis. Steht ja doch da mit Goldschrift geschrieben: Anno 1634 hat der Hochedler gestrenger vester mannhafter Herr Detleff Rantzouw, Ritter, vnd dessen Hochedle vielehrentugenthafte Hausehre Frau Dorothea Rantzouw, Kirchen-Patronen, diess, Altaer, Predigstuel vnd Kirchen also renovieren lassen.
Wie stimmt zu alledem auch so schön die Reihe von Sprüchen auf seinem Sarg: „Weish. 3.1; 2. Tim. 4. 7 u. 8; Röm. 14. 8; Tob. 2. 17 u. 18; Ps. 73. 25 f.; Ps. 4. 9″!
Von der verwitweten Frau Dorothea Rantzau, auf deren Sarg neben dem ihres Gemahls verzeichnet steht, daß sie, den 4. August 1586 zu Heiligenstedten geboren, 1601 mit Marquard Rantzau auf Saxdorf und Hasselburg, der 1610 gestorben, vermählt, 1614 sodann in die zweite Ehe getreten, den 23. Januar 1647 selig auf ihrem adeligen Sitz zu Drage in dem Herrn entschlafen sei, gelangte Drage um 1647 in den Besitz **) des Sohnes ihres Bruders, des Statthalters und Reichsgrafen Gerhard zu Rantzau und Breitenburg, wie auch zu Rosdorf.
Es war Christian zu Rantzau, der Ritter und Reichsgraf zu Breitenburg,***) der Geheim-, Reichs- und Land-Rat, der Oberstallmeister, Präsident in collegiis status, Assessor in allen Kollegien, Gouverneur und Amtmann zu Steinburg und Süderdithmarschen, der erst (1648) zum Statthalter, dann 1661 zum Oberstatthalter der Herzogtümer Schleswig und Holstein, ernannte erste Minister des Königs Friedrich III. von Dänemark, Königl. Vertreter in Wien und Königl. Ge
*) Siehe Dr. Rich. Haupt a.a.O.
**) »Ihres Schwiegersohns“ (?), vergl. die Topographie von J. v. Schröder und Biernatzki (1855).
***) Die Ernennung erfolgte den 16. November 1650 durch Kaiserl. Diplom.
sandte auf dem Reichstag zu Regensburg (1653), derselbe, der, seit 1649 Besitzer des Amts Barmstedt, welches bei der Teilung des Schauenburgischen Landes an den Herzog von Gottorf gefallen, von 1650 an in dieser seiner Reichsgrafschaft ganz unabhängig von König und Herzog regierte und zwar sowohl als Staatsoberhaupt wie als höchster Bischof der beiden Kirchen zu Bramstedt [richtig wohl: Barmstedt] und Elmshorn,*) der 1657 das Schloß Rantzau unweit Barmstedt in reizender Gegend erbauen ließ, 1663 das Hospital in Elmshorn stiftete und mit einer Kapelle versah, und von dem noch eine eigenhändig unterschriebene Entscheidung einer Streitsache über Schankgerechtigkeit, dd. Drage, den 4. Juli 1649, in Kopie im Hohenasper Kircheninventar sich findet.
Entschieden der hervorragendste Rantzau, vereinte dieser berühmte ehemalige Zögling der bekannten Ritterakademie in Soroe in sich die Tugenden seiner großen Ahnen, sowohl des gewaltigen Kriegshelden Johann, als auch des großen Gelehrten Heinrich zu Rantzau,**) ein ächter Held im Kriege
*) Siehe Michelsens Kirchengeschichte IV. Seite 128.
**) Es drängt mich hier, auch über die beiden ältesten Rantzaus Genaueres noch zu berichten. Erster Besitzer und Stifter von Breitenburg, Besitzer auch von Bothkamp, Starenhagen und Mehlbeck, war Johann zu Rantzau, einer der berühmtesten und angesehensten Männer seiner Zeit, geboren im Jahr der Entdeckung Amerikas, den 12. November 1492. Von Jugend aus Kriegsmann, bereiste er England, Spanien, Asien, wurde 1517 in Jerusalem Ritter des heiligen Grabes und kehrte durch Frankreich und Italien, wo er 3 Jahre lang in Rom verweilte, in seine Heimat zurück. Bald darauf in den Dienst des Herzogs Friedrich von Schleswig-Holstein getreten, begleitete er dessen Sohn, den Prinzen Christian, als Hofmeister durch Deutschland, an den Brandenburger Hof und wohnte 1521 mit ihm dem Wormser Reichstag bei, um Luther, dem er anhing, sich verteidigen zu hören. Sodann zum Hofmarschall und Amtmann zu Steinburg ernannt, und vom Herzog Friedrich in die wichtigsten Staatsangelegenheiten eingeweiht, zog er im Jahre 1523 als Kommandeur eines Heeres dem Dänenkönig Christian II. entgegen, eroberte Jütland, drang durch Fühnen und Seeland bis Kopenhagen vor und half, als endlich die Hauptstadt am Sund nach achtmonatlicher Belagerung sich ihm ergeben, dem Herzog Friedrich als Friedrich I. auf den dänischen Thron. Nachdem er auch am schwedischen Kriege teilgenommen, ward er zum Kanzler ernannt und förderte nun eifrig die Reformation in den Herzogtümern. Im Jahre 1534 Oberfeldherr geworden, schlug er die Lübecker, welche, in Holstein eingefallen, den Grafen Christoph von Oldenburg auf den dänischen Thron setzen wollten. Er durchzog dann 1535 aufs neue
wie im Frieden, ein kräftiger Verteidiger der Wahrheit und Gerechtigkeit, ein eifriger allseitiger Förderer des Landeswohls. Ungemein mit irdischen Gütern gesegnet, mochte er wohl zu Itzehoe in einem silbernen Sarg, darauf ein goldenes, mit 4
Jütland und Fühnen und stärkte König Christians III. Thron. Infolgedessen zum Statthalter der Herzogtümer ernannt, war er 1538 mit dem König in Braunschweig bemüht, ein Bündnis mit den Fürsten Augsburgischen Bekenntnisses zustande zu bringen und erhielt 1544 nach dem Friedensschluß mit dem Kaiser eine schwere goldene Kette von diesem zum Geschenk, legte aber, weil er mit seiner Ansicht über die Teilung der Herzogtümer zwischen dem König und dessen Brüdern nicht durchgedrungen war, schließlich alle seine Aemter nieder und lebte 14 Jahre lang stille auf Breitenburg. Erst dringendste Bitten des Nachfolgers Christians III, des Königs Friedrich II. und des Herzogs Adolph bewogen ihn, an der von diesen beschlossenen Eroberung Dithmarschens teilzunehmen. Am 22. Mai 1559 rückte er an der Spitze des Heeres in Dithmarschen ein, erstürmte Meldorf, besetzte Heide, und schloß am 20. Juni 1559 den Frieden. Am 12. Dezember 1565 heimgegangen und mit großer Pracht in Itzehoe beigesetzt, wurde er von seinem Sohn durch ein in der St. Nikolai-Kirche in Kiel ihm gesetztes Epitaphium geehrt, das die Inschrift erhielt: „Herr Johann Rantzau, Ritter, welcher dreier Könige Oberfeldherr und Rat gewesen, hat an diesem Ort das göttliche Wort gehört, ist selig gestorben 1565 den 12. Dezember seines Alters 73 Jahr 1 Monat.“
Zweiter Besitzer von Breitenburg, Besitzer auch von Mehlbeck und von nicht weniger als 19 weiteren Gütern, war Johanns zu Rantzau Sohn Heinrich, „der gelehrte Rantzau“ auf dem Schlosse Steinburg den11. März 1526 geboren. Nachdem er als Student in Wittenberg zu Luthers Füßen gesessen und 1548 mit Herzog Adolph in Brüssel am Hofe Kaisers Karl V. gewesen, auch bei der Belagerung von Metz in kaiserlichem Dienst durch Tapferkeit sich ausgezeichnet hatte, wurde er in feiner Heimat Landrat und Amtmann zu Segeberg, vermählte sich 1554 mit der reichen Tochter des Franz von Halle zu Rinteln und Drachenburg, Christina von Halle, die ihm 400 000 Thaler zubrachte, nahm 1559 an der Eroberung Dithmarschens teil, wurde 1564 zu einem Kongreß nach Rostock entsandt, und folgte 1565 seinem Vater als Statthalter der Herzogtümer. Im Jahre 1591 ließ er in Itzehoe sich eine Kapelle bauen und beschenkte die dortige Kirche mit 160 Thalern, 1595 legierte er zum Andenken an seinen Vater 35 Mark Rente zur Verteilung an Arme (Siehe Seestern-Pauly a.a.O.). Noch kurz vor seinem Tode 1597 unternahm er mit König Friedrich II. eine Reise durch Deutschland. Ueber das Stammgut Rantzau, seinen Tod und sein Begräbnis in Itzehoe siehe bereits oben. In Holbergs Reichshistorie II. Seite 540 heißt es von ihm: „Er war wegen seiner Gelehrsamkeit, Klugheit und großen Tugenden ein Wunder seiner Zeit. Dieser Herr war des großen Generals Johann Rantzaus Sohn, welcher außerdem, daß er ein berühmter Kriegsheld war, auch ebenso vortrefflich in der Gelehrsamkeit und in den Wissen-
runden Medaillons der heiligen Evangelisten und Blumengewinden eingefaßtes und mit einem silbernen Kruzifix geziertes Kreuz befestigt worden, zur Ruhe gebettet werden, und in die Gruft hinein nicht nur die Daten tragen: „Geboren anno 1614, den 2. Mai, zu Hadersleben, gestorben den 3. November 1663 in Kopenhagen“, sondern auch neben dem Bibelwort Joh. 3, 16 die Reimlein:
Wie dessen Seel und Geist geneußt die Himmelsruh,
So ruht der Körper auch, bis daß sich nachher thu
Der letzte Wundertag einfind’n auf dieser Erden,
Da alsdann Seel und Leib eins wieder werden.“
Nach seinem Tode folgte ihm als Besitzer von Drage sein Sohn Detlef zu Rantzau, geboren den 11. März 1644. Reichsgraf und Statthalter, wie sein Vater, gelangte er zu diesen Würden, nachdem er bisher Amtmann und Geheimrat in Rendsburg gewesen. Vermählt zuerst mit Catharina Hedwig geb. von Brockdorff, die ihm 12 größtenteils früh verstorbene Kinder schenkte, dann mit Dorothea Benedikta geb. von Ahlefeldt, war er, von dem im Hohenasper Kircheninventar noch die eigenhändig unterschriebene Konfirmation der vorhin erwähnten Entscheidungsurkunde dd. Drage, den 24. März 1681, in Abschrift sich findet, der Vater der beiden letzten Rantzaus auf Drage. Gestorben den 10. September 1697 auf Drage, ward er am 16. Dezember d. Js. in feierlicher „funeral deduction“ nach Itzehoe übergeführt, nachdem im Trauerhause die Leichenparentation stattgefunden. Es bethätigten sich bei der Ueberführung von Drage aus u. a. die Marschälle Classen und Hildebrandt, der Jägermeister Kalkreuter, von Brockdorff jun., von Depenau (der Träger
schäften als sein Vater in Kriegssachen sich hervorthat. Er verstand außer den europäischen Sprachen auch lateinisch, griechisch und hebräisch. Er hatte es in allen Wissenschaften sehr hoch gebracht und beförderte nicht nur durch seinen Schutz die Studien, sondern schrieb auch selbst viele Bücher. Seine Güter im Reiche und in den Herzogtümern waren so groß, daß er imstande war, verschiedenen Potentaten Gelder vorzustrecken. Kurz, man wird wenige Unterthanen derselben Zeit nennen können, die von größeren Verdiensten und in größerem Ansehen gewesen sind.“ Noch sei erwähnt, daß er auf seinen 21 Gütern 39 Mühlen, Papier-, Pulver-, Säge-, Eisen- und Kupfermühlen anlegen ließ. Siehe Joh. v. Schröders Schlösser und Herrenhäuser.
des Elephantenordens des Verewigten), Postmeister Rode, Kirchspielvogt Praetorius, Kammersekretär Berens, 3 Mohren, 2 Pagen, 4 Lakaien in Trauermänteln und mit Wachsfackeln und Edelleute in Menge mit Vögten, Bereutern und Führern der edlen schwarzbeflorten und mit den gräflichen Wappen versehenen Rosse des Verewigten, und folgten dem die Leiche tragenden Himmelwagen zahlreiche prächtige Karossen.*)
Von den beiden letzten Rantzaus auf Drage folgte den: Vater 1697 zunächst der Geheimrat Christian Detlef, Graf zu Rantzau, ein als ausschweifend, grausam und heuchlerisch geschilderter Herr, der, von seinen Untergebenen zum Teil geradezu gehaßt, von König Friedrich Wilhelm, seinem Kreditor, 1711 – 1720 auf den preußischen Festungen Spandau, Peitz und Memel gefangen gehalten worden und unter andern 1705 zwei Kamp Landes (60 – 70 Tonnen) der Loofter Feldmark gewaltsam sich aneignete und 1710 zwei dortige Hufen zum Hoffeld heranzog.**)
Nach des älteren Bruders durch Meuchelmord herbeigeführtem Tode aber war, nachdem er schon während der Arrestzeit desselben sich die Oberhoheit in der Grafschaft Rantzau angemaßt hatte,***) von 1721 an nur kurze Zeit Besitzer des Gutes der angebliche Brudermörder Graf Wilhelm Adolf zu Rantzau, #) von dem im Hohenasper Kircheninventar noch 2 Aktenstücke dd. Drage, den 28. März 1719, und Drague, den 12. Juli 1721, mit eigenhändiger Unterschrift vorhanden sind, nämlich die Abschrift der Konfirmation der vorhin erwähnten Entscheidungsurkunde und die Abschrift einer Verfügung, betreffend die sogenannten Kirchenlanzen (Kirchenlansten), welche letztere, von dem Besitzer des Ottenbütteler Edelhofes, dem Syndikus und Klosterschreiber in Itzehoe, Nicolaus Pflueg, zu Ottenbüttel ausgefertigt, den Grafen bezeichnet als „Seine Hochgräfliche Exzellenz Wilhelm
*) Siehe Pastor Schröder (Itzehoe) in den Itzehoer Nachrichten.
**) Siehe Schröders Topographie und Schlösser und Herrenhäuser.
***) Siehe die „Streitigkeiten über das Patronat der Elmshorner Kirche“ von Rauert im Archiv für Staats- und Kirchengeschichte Bd. 4. Seile 588.
#) Siehe unten.
Adolph von Rantzau, Grafen zu Rantzau und Leuenholm, Herrn auf Breitenburg, Ritter des Elephanten-Ordens und Ihro Königl. Majest. zu Dennemark-Norwegen bestallten Cammer-Herrn“, und die einzige noch vorhandene Urkunde des Kirchenarchivs zu Hohenaspe ist, welche als derzeitigen Pastor von Aspe Herrn Christian Riedemann bezeichnet.
Hier nur von ihm noch weiter dies, daß er 1717 befohlen, die erste schon 1140 vorhanden gewesene Kirche im ehemaligen Erzbischofssitz Barmstedt abzubrechen und 1718 durch die jetzige „heilige Geistkirche“ zu ersetzen.*)
V. Der Edelhof in Ottenbüttel und seine Beziehungen zu Drage und Hohenaspe.
Wie schon zum Teil ersichtlich geworden, hat in das Getriebe Drages und Hohenaspes im Lauf der Zeit gar vielfach der Edelhof im Dorfe Ottenbüttel, dem möglicherweise ersten Kirchort der Gemeinde Aspe, eingegriffen. Von Interesse ist darum ein Ueberblick über dessen besondere Geschichte von Anfang bis in die neueste Zeit hinein, ehe der traurigen Mordaffaire Erwähnung geschieht, welche plötzlich der Herrschaft der Rantzaus auf Drage dauernd ein Ende gemacht.
Als erste Besitzer des früher ca. 300 Tonnen großen und erst allmählich durch Abtrennung von Parzelen auf ca. 50 Tonnen beschränkten Edelhofes sind nachzuweisen Heinrich, advocatus oder Vogt **) von Ottenbüttel (schon 1149), dessen Sohn Hasso von Ottenbüttel, Ritter Hartwig Busche von Ottenbüttel (1226), der 1230 nachweislich mit 4 Bewohnern des Dorfes Stellau auf einer Höhe die Kirche zu Stilnowe, dem späteren Stellau, gründete,***) und Ritter Etheler von Ottenbüttel (1236), als deren Nachfolger auf längere Dauer aber dieselben Herren, welchen auch das Gut Drage gehörte, die Herren von Krummendiek, Beckdorff und Beckmünde, von
*) Siehe Schröder- Topographie.
**) Die „Vögte“ waren nicht allemal, aber vielfach doch Schirmvögte einer Kirche und Amtmänner. Vergl. Michelsens Kirchengeschichte,
***) Siehe Schröders Topographie und Westphalens mon. ined. I. 34, 40, 52, II. 20.
denen unter anderen Iven von Krummendiek 1376 der Kirche in Aspe „die jährlichen Einkünfte von einem Drömpt Roggen aus einer Hufe des Dorfes Ottenbüttel“ schenkte,*) und danach die Herrn von Sehestede.
Wie aus den noch wohlerhaltenen pergamentnen Kaufkontrakten des gegenwärtigen Besitzers dieses „adeligen Freihofs“ deutlich hervorgeht, besaßen den Hof 1596 der Sohn Jürgen Sehestede’s und Bruder des Emeke und Oswald Henneke Sehestede,**) 1623 Henning Pogwisch, Sohn des Henning Pogwisch zu Petersdorf und der Metta Krummendiek, Schwester des Henrik Krummendiek,***) 1651 Hieronymus Sehestede, Sohn Oswalds von Beckmünde, dann Caspar von Buchwald’s Gemahlin und Hieronymus, Schwester Anna Olegardt Sehestede, um 1667 Magdalena von Ahlefeld auf Wisch,#) 1669 Cornelius de Hertogh, 1677 Rudolf von Artkell, 1692 Nicolaus Pflueg, ##) 1733 dessen Sohn Lieutenant Cay Friedrich Pflueg. Nachdem von diesem nach etlichen Tagen Marquard Behrens ihn erworben, ward er nach etlichen Jahren (um 1738) an die Familie von Saldern verkauft. Am 22. April überließ endlich Frau Amtsverwalterin Anna Maria von Sallern (Saldern), geb. Kamphövener, Witwe des Friedrich von Sallern (Saldern), Amtsverwalters früher in Apenrade, später in Neumünster (gest. um 1738), und Mutter des Caspar von Saldern ###) in Neumünster, wie auch der Anna Catharina, Gemahlin des Pastors Andreas Langheim in Hohenaspe, den Hof durch ihren im Kaufkontrakt als Kurator bezeichneten Sohn „Etatsrat von Saldern von Schierensee“ (den vorhin genannten Caspar von Saldern) für 7000 Mark lübisch an Hinrich Stöcker und Claus Stühmer, von denen das alte Hofgebäude, welches nach
*) Siehe Schröders Topographie und die Urkundensammlung des Guts Drage, nach der er „anders geheten Stauerbur Wagen».“
**) Siehe unten.
***) Siehe unten.
#) Siehe über die berühmten Geschlechter der „Pogwischen“ und „Wischen“ Mlchelsens „Schlesw. Holst. Kirchengeschichte“ II. 92 und Dr. Kaestner» „Geschichte der Bordesholmer Kirche“ (1881). Siehe auch unten,
##) Siehe oben.
###) Siehe dessen Biographie von Justizrat Schmidt-Lübeck im „Staatsb. Magazin“ Bd. VII. Heft 1.
der Notariatsurkunde vom 22. April 1755 zwei Etagen hatte und 12 gute Wohnzimmer, wornntee der Saal und die tägliche Stube mit altmodischen Tapeten behängt war, enthielt, und neben dem ein von der Amtsverwalterin vor 12 Jahren erbautes Stallgebäude von 8 Fach stand, während vor demselben ein Thorhaus von 12 Fach und ein geräumiger eingefriedigter Hofplatz und hinter demselben ein großer Garten mit Obst- und Taxus-Bäumen und Lauben war, abgebrochen wurde. Es folgte diesen auf dem noch immer als „Freihof“ geltenden Hofe nun zunächst als Besitzer Christian Martens, dann noch vor 1778 Detlef Witt, von welchem er in der Folgezeit auf Bendix Reimers, Hans Maaß, Detlef Maaß und Claus Glißmann überging, welcher letztere als zweiter Mann von Detlef Maaß‘ Witwe Magdalena geb. Rheder noch heute auf demselben wohnt.
Im Volksmund heißt der ehemalige „adelige Freihof zu Ottenbüttel“ noch jetzt, wo nichts von seinem Adel, als nur die Freiheit von Abgaben und ein besonderer Kirchenstuhl*), ihm geblieben ist, der „Kaiserhof“ und zwar nachweislich nicht ohne Grund, weil nämlich zwar nicht, wie man behauptet hat, Peter der Große 1716**) dort gewesen sein kann, wohl aber der Herzog Karl Peter Ulrich von Holstein da gewesen ist, ehe er, bereits am 7. November 1742 zum russischen Thronfolger mit dem Titel „Großfürst aller Reußen“ ernannt,***) nach der russischen Kaiserin Elisabeth 1762 erfolgtem Tode Kaiser von Rußland wurde, um bald, von seiner Gemahlin Katharina zur Thronentsagung gezwungen, eines plötzlichen gewaltsamen Todes zu sterben, was daraus erhellt, daß die Mutter des zur Zeit der großfürstlichen Regierung sehr einflußreichen „Russischen Geheimrats“ Caspar von Saldern #) hier wohnte.
*) Siehe unten.
**) Vergl. „Die Heimat“, Mai-Heft 1893. Seite 112.
***) Siehe Michelsens Schlesw. Holst. Kirchengeschichte IV. S. 109.
#) Vergl die Biographie a.a.O., wonach Casper von Saldern, geb. 1710 in Apenrade, vom schlichten Amtsverwalter in Neumünster und Kanzleirat (1740) in rascher Folge 1741 (nicht erst 1744) zum Justizrat, 1744 zum Amtmann, 1752 nach des Geheimrats von Westphalen Fall und seiner Reise zum Großfürsten in Petersburg zum großfürstlichen
VI. Die Pastoren zu Hohenaspe vor dem Jahre 1757.
Von den zahlreichen vorreformatorischen katholischen Pfarrern zu Aspe finden sich nicht mehr als zwei erwähnt,*) nämlich ein Johannes um 1336 (derselbe wurde nach der oben erwähnten Mühlenurkunde im Archiv zu Hohenaspe vom Jahre 1336 von dem Ritter Nicolaus de Crummendieke bevollmächtigt, im Verein mit den derzeitigen Kirchenjuraten aus den Einkünften der von diesen dem Ritter Hartwig Busche, seinem Bruder, abgekauften Wassermühle in Rolloh den bei den jährlichen Messen und Vigilien für seinen Vater, Ritter Nicolaus, thätig gewesenen Vikar und Glöckner mit beziehungsweise einem Thaler und sechs Groschen zu belohnen) und ein Lambert um 1349, dessen Vikar ein Johann Florencius gewesen. Als Ort, wo der letztgenannte Pfarrer
Etatsrat, Ritter des Holst. St. Annenordens und Besitzer des Guts Schierensee, 1762 nach Peters HI. Thronbesteigung zum Konferenzrat und Bevollmächtigten in Kopenhagen, nach desselben plötzlicher Entthronung und gewaltsamem Tode, den 17. Juli 1762, aber unter der Kaiserin Katharina II. zum kaiserlich-russischen Geheimrat und 176S zum Ersten in der Landesverwaltung zu Kiel, dann folgenden Jahres 1764 zum russischen Gesandten in Warschau und Ritter des weißen polnischen Adlerordens, wie auch Inhaber des von Stanislaus Poniatowsky, den er zum König in Polen gemacht, gestifteten Stanislausordens, und zum Minister des vormundschaftlichen Regierunqskonseils in Kopenhagen, 1768 zum ständigen Präsidenten des Generaldirektoriums in Kiel, 1767 zum ersten Unterzeichner des provisorischen Traktats zwischen Rußland und Dänemark, 1768 zum Inhaber des dänischen Elephantenordens und großfürstlichen Unterzeichner des Vergleichs über den Länderaustausch. 1771 zum Besitzer auch des Guts Annenhof, nach Struensees Fall 1772/73 zum Vollender des Definitiv-Traktats zwischen Rußland und Dänemark, 1773 zum Ueberlieferer sowohl des großfürstlichen Anteils an Holstein, als auch der Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst an den Großfürsten und von diesem an den Bischof von Lübeck, sich emporschwang und von da an bis zu seinem Tode (31. Oktober 1786) auf seinem iumitten der prächtigsten Gartenanlagen neuerbauten Schloß zu Schierensee und in seinem Hause in der Flämischenstraße zu Kiel privatisierte. Vergl. auch Schröders Schlösser und Herrenhäuser. Seine Gemahlin, die sein Biograph nicht kennt, hieß nach dem Hohenasper Taufregister Catharina Luciana geb. Tieden.
*) Vergl. Westphalen mon. ined. II. 188.
wirkte, wird in der betr. Urkunde freilich „Ymmissum“ angegeben, doch wird dies Wort*) als ein wegen Undeutlichkeit der Schrift falsch abgeschriebenes „Ymespe“ aufzufassen sein**) und nicht durch „Immesein“, einen Ort im Bremischen, erklärt werden dürfen,***) zumal „Ymespe“ soviel wie jetzt „Um Aspe“ heißt und es als Irrtum angesehen werden muß, wenn man dasselbe durch „in Espe“, d. h. im früher angeblich so genannten Hohenfelde, zu erläutern sucht.#) da „Espe“ gleichbedeutend mit „Aspe“ ist und noch heutzutage beide Ausdrücke für die „Zitterpappel“ in Gebrauch sind, und da zudem „um Aspe“ darauf hindeutet, daß die Wirksamkeit des Pfarrers und seines Vikars, beziehungsweise seiner Vikare, sich nicht auf Aspe nur beschränkte, vielmehr über Aspe hinaus auf das Kirchspiel Hohenwestedt sich erstreckte.##)
Das Luthertum scheint erst recht spät im Kirchspiel Hohenaspe Boden gewonnen zu haben. Wenigstens sind erst seit dem Jahre 1560 evangelisch-lutherische Pastoren hier angestellt gewesen. Nachweislich ###) nämlich wirkte in Hohenaspe als lutherischer Geistlicher
1. von 1560 an bis zu seinem Tode 1590 Tilemann Papenhagen, von dem sonst weiter nichts bekannt ist. Ihm folgte
2. 1591 Magister Nikolaus Wilde, ein feiner gelehrter Mann, gestorben den 26. Februar 1616. Obwohl besten unverheirateter Sohn Hartwig noch bis Ostern 1619 Haus und Hebung behielt, trat doch bereits um Michaelis 1618
3. an seine Stelle Johannes Lüders aus Uetersen (latinisiert Luderus), ein Bruder des Diakonus Michael Lüders
*) Vergl., Dr. Schröder (Crempdorf) in dem „Archiv für Staats- und Kirchengeschichte der Herzogtümer Schleswig, Holstein, Lauenburg pp.“ (Altona 1840) Bd. 4. Seite 160.
**) Vergl.. das „Neue staatsbürg. Magazin“ Bd. 6. Seite 528.
***) Gegen Dr. Kuß a.a.O. Bd. 4. Seite 393 und Seite 587, und Bd. 6 Seite 708.
#) Gegen Geus in seinen Beiträgen II. 190.
##) Siehe oben.
###) Vergl.. Dr. Schröder in dem „Archiv f. R. und K.-Gesch. Bd. 4. Seite 160 ff.
in Neuendorf, welcher, gestorben den 19. Mai 1652,*) eine Witwe Alheit Lüders und u.a. eine Tochter Katharina, die Großmutter des Pastors Christian Grassau in Neuendorf, des bekannten Chronographen, hinterließ.
4. Sein Nachfolger**) war von Cölln 1652, mit dem die Witwe Lüders sich wegen des Gnadenjahres nicht einigen konnte, und der, bekannt eiumal durch sein nach dem Kircheninventar ihm und seinen Erben gehörendes Begräbnis im Kirchsteig zu Hohenaspe und sodann durch das von ihm gestiftete „Cöllnische Legat“ von 100 Thalern Kapital zu 5 pCt. pro anno,***) bereits 1654
5. erseht wurde durch Magister Johann Grassau aus Uetersen, welcher, den 6. April 1654 ordiniert, 1661 als Pastor nach Collmar verzog, worauf selbigen Jahres noch
6. Friedrich Werner, der bisher Feldprediger gewesen, und 1661 in Glückstadt eine Dankpredigt auf König Friedrichs III. erlangte Souveränität in Quart hatte drucken lassen, die Pfarre erhielt. Nachdem dieser mehr als ein Vierteljahrhundert sein Amt verwaltet und im März 1690 in Hohenaspe heimgegangen war, folgte
7. noch in demselben Jahre Christian Riedemann. Vorher, seit 1663, Diakonus und kurze Zeit auch Pastor in Beidenfleth gewesen, am dritten Advent, den 14. Dezember 1690, aber auf dem Kirchhof nach dem Gottesdienst unter
*) Dr. Schröder a.a.O. giebt irrtümlich 1647 an. Vergl. die Unterschrift des Oelbildes. Siehe oben.
**) Dr. Schröder a.a.O. sieht eine Lücke zwischen Nr. 3 und Nr. 5, weiss aber nicht sie auszufüllen. Hier ist der Fehlende.
***) Es ist über dies Legat die Bestimmung vorhanden: „So oft ein neuer Pastor allhie seinen Dienst antritt, wird ihm von Juratis vorgestellt, ob er dies Legatum der 100 Thaler selber haben will oder nicht. Nimmt der Pastor es selbst, so behält er diese 100 Thaler, solange er dem Dienst vorsteht, ohne die geringsten Zinsen davon abtragen zu dürfen, nach seinem Tode aber werden diese 100 Thaler entweder den Juraten oder dem Successori in officio von seinen Erben gegen Quittung ausbezahlt. Wenn der Pastor aber diese 100 Thaler nicht zu seinem Gebrauch haben will, müssen Jurati selbige annehmen und sicher unterzubringen suchen, daß sowohl Kapital als Zinsen allemal in salvo bleiben, widrigenfalls sie für beides zu haften verbunden sind. Die Zinsen aber von diesem Kapital sollen dem Pastori jährlich ausgekehrt werden.“
vier Kompetenten zum Pastor in Hohenaspe erwählt und den 20. Dezember 1690 vom Patron, dem Grafen Detlef zu Rantzau, berufen und angenommen, wurde dieser, welcher ein recht konfuser und unklarer Redner war, während seine Hausehre als zanksüchtig galt, nachdem er länger schon als sein Vorgänger im Amt gestanden, 1731 genötigt, einen Adjunkten zu nehmen. Der von dem bereits 74 Jahre zählenden Greis vorgeschlagene Johs. Niebuhr aus Altona wurde zurückgewiesen, und wurden statt dessen nacheinander Joachim Heinrich Sellcke und Andreas Langheim ihm adjungiert, die er, der 1753 noch lebte, also mindestens, – das Todesjahr und der Ort seines Todes ist hier unbekannt – 96 Jahre alt wurde, trotz erheblichen Vermögens nötigte, ihm jährlich eine beträchtliche Abgabe vom Dienst zu bezahlen, was zu vielen Streitigkeiten und Widerwärtigkeiten Veranlassung gab.
8. Der erste Adjunkt Joachim Heinrich Sellcke, ein Sohn des Pastors Joachim Sellcke in Neuenbrook, 1731 zur Wahl präsentiert mit Andreas Langheim und K. F. Mercatus, welcher letztere, vor dem Wahltage nach Büsum berufen, durch den Suppleanten H. K. Cruse aus Schleswig ersetzt wurde, und am 8. Juli d. Js. mit 88 Stimmen gewählt, war, während die Pastoratsdiensteinkünfte derzeit sich laut Taratum auf 400 Thaler Fixum und 100 Thaler Accidentien beliefen, anfangs auf eine Einnahme von 100 Mark Fixum und eventuell 100 Thalern Accidentien beschränkt, später aber durch Vertrag vom 6. November 1732 verpflichtet, dem Pastor Riedemann,*) welcher mit ihm abwechselnd jeden zweiten Sonntag zu predigen hatte, jährlich vom Gesamtdiensteinkommen 800 Mark abzugeben. Als er schon im September 1733, – wo und an welchem Datum ist nicht bekannt – mit Tode abgegangen war, wurde
9. zweiter Adjunkt sein Wahlkonkurrent Andreas Langheim.
Weil wir diesem, wie auch seinen nächsten beiden Nachfolgern, im weiteren Verlauf der Dinge öfters begegnen werden, genügt es, hier auf wenige Angaben nur sich zu beschränken.
Prof. Dr. Michelsen schreibt a.a.O. ungenau Ridemann.
Nachdem er inzwischen wieder am 2. Dezember 1731 in Neuenkirchen in Norderdithmarschen zur Wahl gewesen und nicht gewählt worden war, wurde er 1734 zum zweiten Mal mit Evers und Burchardi*) für Hohenaspe präsentiert und diesmal, den 2. Mai d. Js., mit 80 Stimmen gewählt, am 3. Trin., den 11. Juli 1734, von dem „Herrn Präpositus Kirchhof“**) introduziert. Ob Pastor Riedemann, dem er die jährliche Abgabe vom Diensteinkommen um 200 Mark herabzumindern imstande war, noch ferner jeden zweiten Sonntag predigte, ist ungewiß und wenig wahrscheinlich. Noch weniger aber ist mit Sicherheit festzustellen, wann der Adjunkt als Pastor an Riedemanns Stelle trat, da er nur zu Anfang eiumal als Pastor adjunctus im Kirchenregister sich bezeichnet und späterhin in seinen ungemein deutlich geschriebenen Einträgen, welche von denen seines Vorgängers sich sehr vorteilhaft unterscheiden, jedoch die seines Nachfolgers nicht übertreffen, niemals am Jahresschluß sich unterzeichnet hat, da ferner der von ihm über die Taufe seiner erstgebornen Tochter am 21. Juli 1737***) gemachte Eintrag, in dem er sich als „Pastor allhier“ bezeichnet, schwerlich den Anfangstag seiner Wirksamkeit als Pastor Loci angiebt, und da endlich bestimmte Nachrichten über des Pastors Riedemann letzte Amtswirksamkeit und letzte Lebenstage sich nicht finden lassen wollen. Wir vermögen ja nur einen unsicheren Schluß zu ziehen aus dem Umstand, daß er am Ist. April 1736 imstande war, sich „mit der Jungfer Anna Catharina von Sallern, aus Apenrade gebürtig,#) im Pastorat-Hause durch Gottes Gnade von dem Herrn Pastor Dücker in Schenefeld copulieren“ zu lassen.
VII. Der Grafenmord und seine nächsten Folgen.
Am 10. (11.?) November 1721 fiel auf der Schnepfenjagd bei Alt-Voßloch zwischen Barmstedt und Elmshorn, ge
*) Siehe unten.
**) Albert Christian Kirchhof, Propst in Itzehoe seit dem 6. Januar 1715. gestorben daselbst den 9. Aug. 1745.
***) Siehe unten.
#) Prof. Dr. Michelsen a.a.O. hat fälschlich angegeben, daß sie aus Altona gebürtig gewesen.
nauer noch in der sogenannten Brunnenallee unweit des Schlosses Rantzau an der Rantzaue (Langeleraue), da, wo noch jetzt ein Stein den schaurigen Ort bezeichnet, ein Schuß, von einem Meuchelmörder abgegeben, der plötzlich dem Leben des Grafen Christian Detlef zu Rantzau ein Ende machte.
Weil des Erschossenen einziger Bruder, Graf Wilhelm Adolf zu Rantzau, der nach der Blutthat sofort auf Befehl des Königs Friedrichs IV. von Dänemark gefangen genommen wurde, obwohl der dänischen Krone landesherrliche Gewalt über die Grafen zu Rantzau rechtlich nicht zustand, den Verdacht der Mitschuld an dem Morde nicht von sich abzuwälzen vermochte, wurde er, nach „der in der Gräflich rantzauischen Blutsache ergangenen Inquisition“ am 9. April 1726 vom Kriminalgericht in Rendsburg zwar nicht zum Tode verdammt, jedoch „wegen der dabei vorgekommenen Umstände ad perpetuos carceros“ – zu lebenslänglicher Gefangenschaft – verurteilt und „derselben zufolge darauf nach Munkholm in Norwegen abgeführt.“ *)
Auf dieser kleinen seit 1658 stark befestigten Felseninsel vor dem Drontheim-Fjord, welche auch einst von 1680 – 1698 der schaurige Kerker Peter Griffenfeld’s, Staatsministers Christians V., gewesen, schmachtete er im dunkeln Gelaß des Rundturms am 1028 gegründeten Benedictiner-Kloster unsäglich lange Jahre. Ein Fluchtversuch, bei dem er sich, wie später an seinem in der Familiengruft zu Itzehoe zur Ruhe gebetteten Leichnam deutlich erkennbar war, an einem Bein schwer verletzte, mißlang und trug ihm nur noch härtere Gefangenschaft auf Akershus, der Citadelle von Christiania, ein, wo er am 21. März 1734 endlich ohne Erben sein Leben beschloß.**)
König Friedrich IV. von Dänemark begründete das Recht der dänischen Krone zur sofort geschehenen Besitzuahme der ganzen Grafschaft Rantzau mit einem „Donations-Instru-
*) Siehe „Corpus statuorum provincialium Holsatiae“ (1750), den ersten Nebenband des „Corpus constitutionum regio-holsaticorum“ Seite 302. Vergl. unten. Siehe auch Memoires du Comte de Rantzow, Amsterdam 1741.
**) Siehe Schröders Topographie.
ment“ (einer Schenkungsurkunde) des Grafen Detlef zu Rantzau vom 10. August 1669.
In dieser Urkunde heißt es folgendermaßen*): „Dero Königl. Majest. zu Dänemark und Norwegen u. f. w. meines allergnädigsten Königs und Herrn bestallter Rat und Vice- Statthalter in den respective Herzog- und Fürstentümern Schleswig und Holstein, Ich Detlef, Graf zu Rantzau und Herr auf Breitenburg, Ritter, urkunde und bekenne hiemit, und inkraft dieses für auch, meine Erben und Erbnehmer, auch sonst jedermänniglich:
Nachdem ich mich gutermaßen erinnere, wie mein in Gott ruhender Herr Vater sel. weiland, der Hoch- und Wohlgeborne Graf und Herr, Herr Christian, Graf zu Rantzau und Herr auf Breitenburg, Ritter u.s.w., Allerhöchst gemeldet Ihro Königl. Majestät bestallt gewesener geheimer Reichs- und Land-Rat, Oberstatthalter, Präsident im CoIIegio Status, Assessor in allen übrigen Consiliis, wie auch Amtmann zur Steinburg und in Dithmarschen u.s.w., des festen Vorsatzes gewesen, in Ansehung und Betrachtung der vielfältigen und fast unzähligen Königlichen hohen Gnaden-Benefizien und Dignitäten, welche von Ihro Königl. Majestät, meinem allergnädigsten Könige und Herrn, sowie auch von Dero Herrn Vater und Herrn Vorfahren, sämtlichen Königen zu Dänemark und Norwegen u.s.w. aller- und hoch-löblichsten Andenkens, hochgedachter mein sel. Herr Vater und dessen Vorfahren von undenklichen Jahren her hochrühmlichst und nützlichst empfangen, besessen und genossen, Allerhöchstgedachter Ihro Königl. Majestät dessen Allodial-Grafschaft Rantzau mit allen ihren Hochherrlichkeiten und Gerechtigkeiten, samt allen übrigen Pertientien, nichts ausgeschlossen, sondern in allermahe, gleichwie mein Hochgedachter Herr Vater sel. dieselbe freiest besessen und innegehabt, auf den Fall, daß über kurz oder lang mehr Hochgedachten meines sel. Herrn Vaters eheliche Leibeserben und Descendenten männlicher Linie aufhören würden, auch damit solche Grafschaft auf solchen Fall ihre
*) Siehe „Corpus statuorum provinzialium Holsatiae“ (1750). Der Uebersichtlichkeit wegen ist die alte Orthographie durch die neue ersetzt worden. Vergl. auch Lünig „Specilegium seculare I.“ Seite 856.
Herrlichkeit und Lustre nicht verlieren, endlich zu einem Privatamte gedeihen und aus den Reichs- und Kreis-Matrikeln gesetzt werden möchte, erblich zu vermachen.
jedoch solcher Ihro Excellenz sel. gehabter Vorsatz durch unverhofftes und zu frühzeitiges Absterben, seinen völligen Effekt nicht erreicht, Ich aber selbiger meines seligen Herrn Vaters rühmlichster Intention billig inhäriere.
daß Ich daher auch um eben derselben Bewegnis willen und also aus wohlbedachtem Mut und freiem Willen, ohne einziges Menschen Anmutung und Begehren oder Persuasion konstituieret und verordnet, gleichwie ich denn hiemit und kraft dieses wohlbedächtlich, ungezwungen und ungedrungen, auch wie es zurechte-beständigst und kräftigstermaßen geschehen kann, soll und mag, konstituiere und verordne,
daß, wofern der Allerhöchste nach seinem väterlichen Rat und Willen über mich über kurz oder lang gebieten und mich ohne männliche eheliche Leibeserben aus dieser Sterblichkeit abfordere, oder aber, wenn ich gleich eheliche männliche Leibeserben nachgelassen, selbige nach Gottes Willen über kurz oder lang absterben, und also keine eheliche männliche Leibeserben in absteigender Linie von mir übrig sein würden,
alsdann obbesagte meine Allodial-Grafschaft Rantzau mit allen ihren Privilegien, Hochherrlichkeiten und Gerechtigkeiten, samt allen übrigen Pertinentien, sowie auch meine Herrschaft und das Schloß und Festung Breitenburg mit den dazu gelegten Gütern und aller ihrer Zubehör, wie sie auch Namen haben mögen, desgleichen Geschütz, Gewehr und Ammunition, wie ich solche meine Graf- und Herrschaft, samt obberührten ihren Privilegien, Exemtionen, Herrlichkeiten und Gerechtigkeiten jetzt freiest und rechtmäßig besitze, jedoch die Mobilien, Moventien, per Expressum davon ausbeschieden. Allerhöchst gedachter Ihro Königlichen Majestät erblich und ohne irgendwelche Exemtion oder jemandes Ein- und Widerreden, wer der auch sein könnte und möchte, heimfallen und zu ewigen Tagen zu dero allergnädigsten Disposition verbleiben solle.
Wofern ich aber eheliche Leibeserben fraulichen Geschlechts Nachlassen möchte, verbleiben zwar auch solchenfalls obbesagte meine Graf- und Herrschaften Rantzau und Breitenburg, wie
vorgemeldet, Allerhöchst gedachter Ihro Königl. Majestät einen Weg wie den andern,
jedoch daß selbiger weiblichen Linie anstatt meiner Herrschaft Breitenburg und ihren dazu gelegten Gütern ein Aequivalent und zwar so hoch, wie selbige meine Herrschaft an Pflügen sich belaufen wird, an guten in Holstein wohlbelegenen Landgütern und ebenso vielen Pflügen hinwiederum gereicht werde.
Sollte aber selbige weibliche von mir posterierende Linie aussterben und also von meinen ehelichen Leibeserben und deren ehelichen Descendenten nichts mehr übrig sein, alsdann fällt Ihro Königl. Majestät mehrgedachtes solches Aequivalent, wie obgemeldet, ebenmäßig wiederum anheim.
Wobei denn auch insonderheit zu Allerhöchst geehrter Ihro Königl. Majest. eigenem allergnädigsten Gefallen ich allerunterthänigst verstelle, nach diesem Tage über kurz oder lang, über beregte meine Graf- und Herrschaft in eventum, wenn sie Deroselben auf meinen Todesfall vorbeschriebenermaßen an fallen würden, gleichwie Sie über Ihre eigenen Königreiche, auch Lande und Leute, irgends thun möchten und wohl könnten, freiest zu disponieren und zu verordnen,
nur mit dem allerunterthänigsten und von Ihro Königl. Majestät allernädigst eingewilligten Bedinge, wenn oft besagte meine Grafschaft Rantzau nach Gottes gnädigem Willen auf vorgemeldte Begebenheit Ihro Königl. Majest. oder demjenigen, welchem Sie von den Königl. Ihrigen dieselbe per dispositionem oder andere gefälligere Gestalt etwa aufmachen möchten, anheimfallen sollte, daß alsdann selbige Grafschaft von der Grafschaft Pinneberg zu ewigen Tagen separieret und bei dem Namen der Grafschaft Rantzau ungeändert verbleibe.
Und weil auch vor einigen Jahren auf das Kirchspiel Kellinghusen Königl. Anteils von mir ein gewisser Kapitalposten oft Allerhöchst gemeldter Ihro Königl. Majestät angeliehen worden, so ist darüber meine beständige Gemütsmeinung, daß Ihr und dero Königl. Erben derselbe nach meinem tätlichen Abgänge, er begebe sich auch über kurz oder über lang, ohne irgend welchen Entgelt wiederum heimfallen
und von meinem Erben und Erbnehmer auf die diesfalls in Händen habende Königl. Verschreibung nicht das Geringste gefordert werden soll, kann oder mag,
nicht zweifelnd, vielmehr der allerunterthänigsten Zuversicht lebend, Allerhöchst gedachte Ihro König!. Majestät werden diese meine allerunterthänigsie Devotion in allen Königlichen Gnaden vermerken und Derselben, wie bisher so auch fernerhin, zu allen ferneren König!. Hulden und Gnaden mich und die Meinigen je und allewege anbefohlen sein lassen.
Dessen zu wahrer Urkunde, auch alles getreulich und bei meiner Gräflichen Ehre, gutem Glauben und wahren Worten wohl und unverbrüchlich zu halten, habe ich dies Anwartungsinstrument mit meinem hierunter befindlichen eigenen Handzeichen und aufgedrückten Gräflichen Insiegel vollzogen, korroborieret und bestätigt.
So geschehen auf meinem Hause, den 10. Aug. Anno 1669.
(L.S.C. ) Detlef, G. z. Rantzau.“
Nur „die Herrschaft Breitenburg“ überließ der König, „jedoch unter gewissen Konditionen“, „der Frau Gräfin Catharina Hedwig von Castell-Rüdenhausen (geb. 8. Juni 1683, gest. 11. März 1743), als der einzigen Schwester der beiden unglücklichen Grafen“, und „deren Descendenten“, während „die bei dem Namen der Grafschaft Rantzau unverändert verbliebene“ Allodial-Grafschaft nunmehr „besonders administriert und einem eigenen Appellationsgericht unterstellt wurde.“
Daß bei dieser erst 1671 vom Kaiser bestätigten „Donation“ und bei dieser Besitzuahme von dem „Donum“ alles mit rechten Dingen zugegangen sei und ein von den Angehörigen des unglücklichen Grafen Wilhelm Adolf zu Rantzau (er war vermählt mit Charlotte Louise, Gräfin von Wittgenstein, gest. 1734) bei dem deutschen Reichskammergericht gegen den König von Dänemark anhängig gemachter Rechtsstreit triftigen Grund nicht gehabt habe, ist mehr als unwahrschein
lich,*) da feststeht, daß die Donation des Grafen Detlef zu Rantzau bei festlichem Mahle zustande gekommen, und daß eine sofort nach demselben aufgesetzte Revokationsakte spurlos verschwunden ist, und da allem Anschein nach der unbekannte Meuchelmörder mit dem verurteilten Grafen kein Komplott gemacht hat.
VIII. Drage und Friedrichsruhe.
Dem König Friedrich IV. von Dänemark, mit besten Verfahren gegen den Grafen Wilhelm Adolf und das deutsche Reichsland der Kaiser nicht einverstanden war,**) folgte, nachdem derselbe zuvor 1728 noch Drage von der Frau Gräfin Catharina Hedewig von Castell-Rüdenhausen für 42 000 Thaler gekauft hatte,***) im Jahre 1730 Christian VI. (gest. 1740). Sofort nach seinem Regierungsantritt erkor sich dieser als königlichen Administrator, Statthalter und Generalgouverneur in den beiden Fürstentümern Schleswig und Holstein einen Hohenzoller, der als bestellter Generalfeldmarschall-Lieutenant, kommandierender Chef der Truppen in den Fürstentümern Schleswig und Holstein, Obrist des jütischen Fußregiments und Ritter des Elephantenordens, bereits in königlich-dänischen Diensten stand. Er machte ihn zugleich zum Residenten im Rantzau’schen Erbe und wies ihm Drage als Wohnsitz an.
Dieser Hohenzoller, welcher 1735 mit seiner Mutter und einem Bruder nach Kopenhagen übergesiedelt, war der Bruder Ihrer Majestät der Königin Sophia Magdalena, der Tochter des Markgrafen Christian Heinrich von Brandenburg-Culmbach-Weverlingen, also Schwager des Königs Christians VI. Vermählt mit Ihro Hochfürstlichen Durchlaucht Frau Christine Sophie, einer gebornen Prinzessin von Braunschweig-Lüneburg-Bevern und der Schwester der liebenswürdigen Gemahlin des Preußen-Königs Friedrichs II., des Großen, Elisabeth Christine, welche bekanntlich 1733 ihren Ehebund
*) Das gräflich Castell’sche Begräbnis zu Itzehoe hat das Symbolum: „Das Vergangene zu vergessen, das Gegenwärtige zu genießen und das Zukünftige von dem ewigen und allmächtigen Gott zu gewärtigen.“
**) Siehe Michelsens Kirchengeschichte IV. Seite 130.
***) Siehe von Schröders Schlösser pp.
geschlossen, einer Nichte der Kaiserin Maria Theresia von Oesterreich, der Mutter der Königin Maria Antoinette von Frankreich, führte Ihro Hochfürstliche Durchlaucht Friedrich Ernst die Titel: „Von Gottes Gnaden Markgraf zu Brandenburg, in Preußen, zu Schlesien, Magdeburg, Cleve, Jülich, Berg, Stettin, Pommern, der Cassuben und Wenden, zu Mecklenburg und Crossen Herzog, Burggraf zu Nürnberg, Fürst zu Halberstadt, Minden, Camin, Schwerin, Ratzeburg und Mörs, Graf zu Hohenzollern, der Mark, Ravensberg und Schwerin, Herr zu Ravenstein, der Lande Rostock und Stargard.“ Der Fürst im Purpurmantel, der samt seiner hohen Gemahlin, trefflich in Oel gemalt, noch heute in der Kirche zu Hohenaspe allsonntäglich auf die Gemeinde herabschaut, wird er, der im übrigen in Dänemark weder als Offizier noch als Mensch, ob mit Recht oder mit Unrecht, wir wissen es nicht, viel gegolten,*) in einem königlichen Handschreiben dd. Friedrichsberg, den 6. September 1743 als „Unser freundlich lieber Vetter und Schwager“ bezeichnet. Am 23. Juni 1762 heimgegangen und am 6. August d. Js. im Hochfürstlichen Begräbnis innerhalb des Südeingangs der Kirche zu Hohenaspe beigesetzt, am 7. April 1779 im Grabe mit seiner am 26. März d. Js. ihm gefolgten Witwe aufs neue vereint, hat der in Frieden Gebettete leider seinen Wunsch in dauerndem Frieden zu schlummern in der Gruft nicht erfüllt erhalten, da schändliches Raubgesindel zu zweien Malen**) es wagte, seinen einbalsamierten Leichnam, den jetzt ein zweiter sicherer Sargdeckel verhüllt, bis auf einen sehr geringen Rest all seiner ihm mitgegebenen Kleinodien zu berauben.
Im Jahre 1745 sah „Marggraf Friedrich Ernst von Brandenburg-Culmbach“ (wie er kurzweg zeichnete und sich nennen ließ) den Ausbau seines neuen Schlosses vollständig vollendet. Sein königlicher Schwager Christian VI. hatte nämlich sofort das alte Rantzausche Herrenhaus zum Abbruch verurteilt und seine Hofbaumeister, den Architekten und Maurermeister Christian Böhme aus Kopenhagen (gest. 18. Novem
*) Seine Biographie von P. F. Rist im „Dansk Biografisk Lexikon Bd. V. Seite 358 war leider dem Verfasser nicht erreichbar.
**) Nachweislich den 17./18. Dezember 1831.
ber 1753) und den Zimmermeister Jens Petersen Vysborg ebendaher, beauftragt, das abgebrochene Hofgebäude durch ein Palais zu ersetzen, und für die schon im Jahre 1740 fundierte Residenz den seit 1745 ständig im Kirchenregister und den Kirchenarchivalien sich findenden Namen „Friedrichsruhe“*) gewählt.
Es war ein stolzes, mächtiges, stattliches Gebäude, in dem er fortan residieren durfte. Nach dem im „dänischen Vitruv 2. 255 f.“**) sich findenden Grundriß war es ursprünglich so geplant, daß es bestehen sollte aus einem 44 Meter im Quadrat enthaltenden Mittelbau mit 2 vorgestreckten Flügeln von ca. 47 Metern Länge und 10 Metern Breite und einem Hofraum von 50 Metern Weite und 15 Metern Tiefe. Die ebendaselbst sich findende Vorderansicht des Schlosses aber zeigt noch 2 Seitenflügel, mit je 5 Fach Fenstern. Es hat mithin der Plan später noch eine Aenderung erfahren. Zweistöckig mit Erdgeschoß, hatte es nach dieser Ansicht in der Front außer den je 5 Fach Fenstern der Seitenflügel je 5 Fach Fenster an den vorgestreckten Flügeln und an der Hauptfassade oben 5 Fach Fenster, dagegen zur Rechten wie zur Linken des Portals je 2 Fach Fenster. Sehr wohl möglich ist es, daß, wie der Volksmund noch jetzt sich erzählt, es 99 Zimmer gehabt habe. Nach einer anderen Vorderansicht, welche Joh. von Schröder in seinen „Schlössern und Herrenhäusern“ bietet,***) waren an den vorgestreckten Flügeln dem Hofraum zu 6 Fach Fenster, lieber dem Portal mit vierfacher Stein- oder Marmorstufenreihe war ein flacher Giebel, geschmückt mit dem Wappen des königlichen Statthalters. Durchweg massiv, war das Gebäude mit schrägem Ziegeldach versehen, und ragten aus dem Mittelbau 2, aus den vorgestreckten und Seiten-Flügeln je ein Schornstein, hervor.
Im Innern gar prächtig mit kostbaren „Tapeten, Spiegeln, Wand- und Thür-Gemälden, Teppichen, Portieren „, #)
*) Nach von Schröder (Herrenhäuser) hatte der König 1745 auf eine Fensterscheibe geschrieben: „Friedrichsruhe, bleibe beglückt immerzue“
**) Siehe Dr. Rich. Haupt a.a.O.
***) A.a.O.
#) Vergl. die Parzelierungsurkunde von 1787.
kurzum mit allem möglichen Komfort, ausgestattet, lag Friedrichsruhe zu Süden der Anhöhe, auf welcher zweifelsohne das alte Rantzausche Herrenhaus gestanden und jetzt, noch umrahmt vom alten Burggraben, iumitten mächtiger Wirtschaftsgebäude das neueste ansehnliche Hofgebäude belegen ist, nämlich auf dem jetzt mit einer provisorischen Grenzscheide eingefaßten planierten Wiesengrunde. Wie sorgfältig die Fundamente gelegt worden, bezeugen noch heute die tief im Grunde steckenden mächtigen Felsen.
Geschieden von der lieblich durch das Wiesenthal sich schlängelnden Drager Aue nur durch eine lange Aspen-Allee, parallel der jetzt noch vorhandenen stattlichen Doppelreihe greiser Aspen mit mächtigem Stamm und hoch emporragenden Wipfeln, die am Burggraben entlang dem schönen Tiergarten und der ehemaligen Oberförsterei zuführt, hatte das Schloß, obwohl seine Fassade nach Norden zeigte, natürlich seine freundlichsten Räume nach Süden über dem der Allee längs der Aue zuführenden Portal, wo, während an der Ost- und Westseite des Hauptgebäudes je 9 Fach Fenster waren, 10, beziehungsweise 11, Fach Fenster einen wundervollen Fernblick gewährten. Von den Ecken der Seitenflügel erstreckten lange Hofmauern sich nach Norden bis zur Anhöhe hinauf, und mündete der Thorweg der am Rande der Anhöhe von beiden Mauern aus gezogenen und im Winkel nordwärts geschweiften Eisengitter*) **) jenseits des Burggrabens in den Hofraum vor dem Herrenhause und zwar genau an der Stelle der jetzigen Pforte. Noch sei erwähnt, daß das Material des Schlosses Friedrichsruhe von Tönning herbeigeschafft worden und das alte Schloß an der Mündung der Eider auf Drager Grund und Boden neu erstand. Wie alt es da geworden? Daß es nur 42 Jahre alt geworden, während das abgebrochene Rantzausche Herrenhaus bereits mehr als 150 Jahre zählte, als es dem Untergang geweiht wurde, giebt zu denken.
*) Teilweise zweistöckig und bewohnbar.
**) Liehe die von Schröder’sche Ansicht.
IX. Christinenthal, das alte Weddelsdorf.
Wie Schloß Heiligenstedten noch heute sein liebliches Julianka hat, so hatte auch Friedrichsruhe sein freundliches Christinenthal. Cs führte dieser etwa1 3/4 Meilen nordöstlich von Itzehoe gelegene Meierhof ehemals den Namen „Weddelsdorf“, erst der Frau Markgräfin Christine Sophie zu Ehren wurde er „Christinenthal“ genannt.
Vor alters ein Gut, zu dem das Dorf Reher, Kirchsp. Schenefeld, gehörte, und Eigentum der Familie von Krummendiek, war Weddelsdorf, jetzt Christinenthal, 1610 mit dem Gute Drage vereinigt worden. Christian VI. von Dänemark begnügte sich nicht damit, seinem Schwager, dem Statthalter von Schleswig und Holstein, nur ein Palais auf Drage erbaut zu sehen, er mußte auch ihm eine Sommerresidenz einrichten. Der Meierhof „Christinenthal“ erhielt deshalb seine königliche oder markgräfliche Villa „Solitude“. Wie lange diese Sommerresidenz bestanden? Die kurze Notiz* ) beantwortet diese Frage zur Genüge: „Das Wohnhaus ist neu.“ Im übrigen von dem Verbleib der Villa Solitude und des Schlosses Friedrichsruhe in einem anderen Kapitel.
X. Die markgräfliche Hofhaltung.
Daß die markgräfliche Hofhaltung auf Schloß Friedrichsruhe schwerlich von langer Dauer sein und jedenfalls ihr 50jähriges Jubiläum nicht feiern werde, war ein einfaches Rechenexempel.
Ein Ueberblick über die ganze große Zahl der ständigen oder öfteren Umgebung des königlichen Statthalters ergiebt ein Resultat, das unverkennbar auf nicht wohl lange Jahre liquidierbare Kosten schließen läßt.
Aus Friedrichsruhe weilten nachweislich nicht selten Allerhöchste, Höchste und hohe Herrschaften als Gäste des markgräflichen Paars. Nicht nur daß Ihre Majestäten der König Christian VI. und die Königin Sophia Magdalena samt Sr. Königlichen Hoheit dem Kronprinzen Friedrich, dem späteren König Friedrich V., und Ihre hochfürstlichen Durch
*) Vergl. Schröder’s Topographie.
tauchten der Markgraf Friedrich Christian mit Prinzessin Christians Sophia Charlotta von Brandenburg-Culmbach, wie auch Ihre Hoheiten der Herzog Ernst Ferdinand und die Herzogin Eleonore Charlotte zu Braunschweig-Bevern mit den Prinzen Georg Ludwig, August Wilhelm und Friedrich Carl Ferdinand (welcher letztere später General der Infanterie und Gouverneur von Rendsburg und Kopenhagen war) und der Prinzessin Friederika Albertina als nahe, liebe, stets willkommene Verwandte nachweislich öfters auf Friedrichsruhe weilten; es fanden auch nicht selten sich ein Ihre Hochfürstl. Durchl. Prinz Carl von Glücksburg und Fürst Carl Ezard von Ostfriesland, Ihre Hochgräfl. Excellenzen Reichsgraf Ludwig Casimir von Ysenburg-Büdingen, Graf und Amtmann zu Itzehoe Detlef von Dehn, die Generalmajoren Andreas von Hauch und Peter Elias von Gähler, der Generaladjutant Graf Caspar Hermann Gottlob von Moltke, der Obrist Ferdinand August von Dehn, Kommandeur des schleswigschen Landmilizregiments, Seine Hochgräfl. Excellenz Generaladmiral Friedrich von Daneskjold-Samsoe (bekanntlich eifriger Förderer der dänischen Marine) nebst Gemahlin Comtesse von Wedel, und der Generalkriegskommissär Etatsrat Johann Hinrich von Lohendahl vom Gute Mehlbeck, und wer weiß, wie viele noch mehr, die unsrer Kunde sich entziehen?
Schon diese öfteren und nicht seltenen Besuche kosteten Geld, viel Geld. Und dennoch war der Aufwand für sie ein kleiner Bruchteil nur des ganzen. Welche Summen verschlang erst das tägliche Leben des hochfürstlichen Hofes mit seinem ganzen kolossalen und ständigen Personal von Hofbeamten und von Hofdienerschaft! Wer zählt die Schar, wer kennt die Namen?
Sei der Versuch gewagt auf Grund der Kirchenregister und Aktenstücke Hohenaspes ein möglichst genaues Bild der ganzen großen Zahl zu zeichnen.
Da ist die zu besonderen Gottesdiensten neben denen in der Kirche zu Hohenaspe vornehm eingerichtete Kapelle des Schlosses zu Friedrichsruhe. Während die erstgenannte auf einfacher, doch würdiger Altarbekleidung*) nur noch zwei
*) Zweifelsohne Geschenk der Ahlefeld-Rantzaus.
messingne Altarleuchter*) hat, während sie noch nur für die Feier des heiligen Mahls eine große silberne Kanne, zwei vergoldete Kelche mit Patenen, ein silbernes Cibarium**) und einen vergoldeten Krankenkelch***) und für die Feier der heiligen Taufe ein großes bronzenes Taufbeckens #) besitzt, während sie noch nur über dem Altarraum einen kleinen neunarmigen messingnen Kronleuchter mit Reichsadler ##) hat und ihre Liebesgaben für die Armen in einem einfachen rotsamtneu Klingelbeutel ###) empfängt, hat diese Kapelle sämtliche Kirchen-Paramente und -Ornamente, welche unterm 9. März 1779 als Vermächtnis der markgräflichen Witwe in den Besitz der Kirche zu Hohenaspe übergegangen sind, nämlich zwei große prächtige silberne Altarleuchter mit dem Namenszuge des Markgrafen unter der Krone, zwei purpurne, mit Goldborden geschmückte und mit des Markgrafen und der Markgräfin in sich verschlungenen Namenzügen versehene Altarbekleidungen, zwei weiße, mit ächten Spitzen eingefaßte Altardecken, eine silberne vergoldete Kanne, einen vergoldeten Kelch, eine vergoldete Patene, ein vergoldetes Cibarium mit dem markgräflichen Namenszuge unter der Krone und einen mit Silber eingefaßten, goldgestickten, purpurroten Klingelbeutel.*#)
Nicht nur der Pastor zu Hohenaspe hat hier zu amtieren, sondern es ist auch ein besonderer Kabinettsprediger angestellt. Neben Andreas Langheim, geboren den 11. Juli 1704 in Tondern, von 1734—1767, in welchem Jahre er plötzlich den 5. August in Stellau am Schlagfluß starb, Pastor in
*) Geschenk von Clawes Lawerenz (1630), früher auch bei Leichenbegängnissen verwendet.
**) Wahrscheinlich Geschenke der Ahlefeld-Rantzaus. Das Cibarium, sehr schön, hat Wappen mit Elephant darunter und darüber die Buchstaben „C G z R H A BR“, wahrscheinlich Abkürzung von „Christian Graf zu Rantzau, Herr auf Breitenburg“.
***) Geschenk von Johann Jakob aus Looft (1746).
#) Sehr alt.
##) Wohl Geschenk der Ahlefeld-Rantzaus.
###) Aus unbekannter Zeit.
*#) Ein als Unterlage dienendes rotes Altartuch hat unter der Krone die Jahreszahl 1755. Es wurde nachweislich mit einer nicht mehr vorhandenen roten Sammetdecke, die mit Tressen besetzt war, von Charlotta Christina von Drost gespendet.
Hohenaspe, wirkt als solcher Pastor Petrus Burchardi (gestorben den 26. August 1763 in Itzehoe, bestattet den 30. August d. J. in der Hohenasper Kirche). neben Johann Christoph Eberwein, geboren den 3. September 1730 in Göttingen, zuerst Kabinettsprediger beim Grafen von Daneskjold-Samsoe, dann von 1758 – 1772 Pastor in Hohenaspe, dem Dichter des Kirchenlieds „Ach, daß ich Gottes Weg verließ“, Pastor Ernst Matthias Christian Hennings, geboren den 19. März 1741 in Meldorf, nach 2jähriger Amtsführung auf Friedrichsruhe am 3. November 1772 zum Pastor in Hohenaspe erwählt, am 17. November d. Js eingeführt und daselbst den 13. Januar 1618 heimgegangen.
Zur Taufe von Kindern markgräflicher Diener wird freilich nachweislich nur Pastor Andreas Langheim von Hohenaspe per Karosse in die Schloßkapelle gefahren. Er tauft hier
1. den 11. August 1751 Sophia Christiana, geb. den 8. August d. Js., Tochter des Hochfürstlichen Läufers August Hinrich Lorentzen, und sind als Paten anwesend Ihre Majestät die verwitwete Königin Sophia Magdalena von Dänemark, Ihre Hochfürstliche Durchlaucht Christians Sophia Charlotta von Brandenburg-Culmbach und Seine Hochfürstliche Durchlaucht Markgraf Friedrich Christian von Brandenburg-Culmbach,
2. den 2. September 1751 Anthon Christoph, geb. den 29. August d. Js., Sohn des Kammermusikus Johann Friedrich Bährwaldt aus Schleswig, und sind die Paten Etatsrat Anthon Nottelmann, Kammerjunker Otto Christoph von Raven und Frau Majorin Anna Cathrina von Holstein aus Schleswig.
3. den 2. Juli 1756 Friedrich Christian Carl, geb. den 23. Juni d. Js., Sohn des Leibkutschers Martin Klug und seiner Ehefrau Metta Christina, Und haben die Gevatterschaft übernommen nicht nur der Markgraf Friedrich Ernst und Gemahlin, sondern auch Ihre Hochfürstlichen Durchll. Prinzessin Friederika Albertina und die Prinzen Georg und Friedrich Carl Ferdinand von Braunschweig-Bevern,
4. den 4. November 1756 Friedrich Christian, geb. den 31. Oktober d. Js., Sohn des Scheunvogts Claus Alpen, und sind Gevattern nur die markgräflichen Herrschaften von Friedrichsruhe.
Da sind ferner die markgräflichen Bureaus. Es wirken hier Etatsrat Anthon Friedrich Nottelmann (gest. den 20. Juli 1759) dessen Name gewöhnlich unter den Verfügungen des Statthalters*) sich findet, Staatssekretär Dithmer, Kanzleirat Otto Niemann, Kanzleisekretär Friedrich Lorentzen und Stabssekretär Martin Christian Sauerbier.
Dort wohnen der Hofmarschall Christian Ludwig von Schlegel, die Kammerherrn und Kammerjunker Henning Otto von Below (Bölau), Otto Christoph von Raven, Friedrich von Pritzbue, Ernst Ludwig von Hattenbach, Adolf Friedrich von Warnstedt, die Oberhofmeisterin Sophie Dorothea von Wersebé, die Hofdamen Sophie Antoinette von Schwarzkoppen, Friederika Henriette von Watzdorff, Baroneß Christine Elisabeth von Wedel, Louyse Henriette von Kayn, Anna Meta von Ahlefeld, und die Hoffräulein von Kaymen, von Walmoden und von Oualen u.a.
Hier ist der große Speisesaal des Schlosses. Bei Tafel, zu der hin und wieder auch mit Einladung beehrt werden Seine Exzellenz der Geheime Konferenzrat und Landrat von Brockdorff aus Noer und Wensien, Besitzer auch des Gutes Beckhoff (und als solcher einstiger Eigentümer des sogen. Sehestede’schen Erbbegräbnisses) **) nebst Gemahlin Friederika Louyse geb. Gräfin von Holstein, die hohe Erbfrau auf Hanerau und Buchhorst Benedicta Margaretha von Rumohr,
*) Siehe besonders „Corpus constitutionum regio-holsaticorum“ oder „Allerhöchst autorisierte Sammlung der in dem Herzogtum Holstein, königl. Anteils, samt inkorporierten Landen, wie auch der Herrschaft Pinneberg, Stadt Altona und der Grafschaft Rantzau, in kraft eines beständigen Gesetzes ergangenen Konstitutionen, Edicte, Decrete, Resolutionen, Privilegien, Konzessionen und anderen Verfügungen,“ herausgegeben von Friedr. Detl. Carl von Cronhelm, königl. dän. Justizrat und Mitglied der Glückstädtischen Regierungskanzlei 1749—1757 zu Altona (5 Bände).
**) Dies Begräbnis im Steig der Hohenasper Kirche, das unterm 17. November 1749 in den Alleinbesitz des Fräuleins Charlotta Christina von Drost, welche seinerzeit Konventualin des Klosters zu Itzehoe war, und von da aus, 82 Jahre alt, den 22. Dezember 1764 in Hohenaspe beigesetzt wurde, überging, hat auf der Sandsteinplatte das von Drost’sche Wappen, die Namen Sophia Wilhelmina und Charlotta von Drost, sowie den Spruch 1. Joh. 1, 7: „Das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde.“
der Klosterhofmeister Peter Balthasar Albinus nebst Gemahlin Sophie Hedwig von Itzehoe und die Frau Amtsverwalterin Anna Maria von Sallern (Saldern) vom Ottenbütteler Edelhofe, wie auch die Pastoren u. a., walten ihres Amtes der Pagenhofmeister Johann Gottfried Schönhut mit seinen Pagen und den Lakaien Conrad Carl Dohrn, Adam Friedrich Ohrtmann, Christian Wiesner u. a. (Hans Jürgen Weymann war des Hofmarschalls, Johann Hinrich Hein des Kammerjunkers Ernst Ludwig von Hattenbach, Carsten Rademann des Etatsrats, Conrad Schrader der Oberhofmeisterin besonderer Lakai), während die Küche und den Keller besorgen die Küchenmeister Ferdinand Engelskirchen und Christian August Parsow, die Köche Bendix Hinrich Gottlieb, Johann Werner Rolefs, Andreas Miete, Johann Friedrich Hinrich Förster und Georg Friedrich Blumberg, samt der Küchenfrau Anna Margaretha Schöner und dem Küchenschreiber Johann Ludwig Marquardt,
Es wird von Interesse sein, neben der letztgenannten Konventualin Charlotta Christina von Drost auf die jüngere in demselben Begräbnis ruhende Schwester Sophia Wilhelmina von Drost kennen zu lernen, über welche ein unregistriertes Blatt im Kirchenarchiv nachstehende Auskunft giebt:
Sophia Wilhelmina von Drost, geboren den 21. Oktober 1683, gestorben den 30. Januar 1725 (alt 41 Jahre, 8 Monate und 21 Tage), ist Tochter des Franz Wilhelm Drost von Senden aus dem Hause zur Beeck, Drosts im Amt Herzberg, und der Catharina Margaretha von Ahlefeld aus dem Hause Seegard. Ihr Großvater väterlicherseits war Johann Franz Drost von Senden, Erbherr zu Moldiek und des Fürsten von Neuburg Kämmerer von Drost, der Gemahl der Maria von Schelen zu Schelenburg im Westphälischen, ihr Urgroßvater Engelbert Drost von Senden, vermählt mit Elisabeth von Gill, ihr Ururgroßvater Franz Drost von Senden, vermählt mit einer von Keppel, und ihr Urururgroßvater R. Drost von Senden. Ihr Großvater mütterlicherseits aber war Hans von Ahlefeld, Herr zu Gravenstein, Gemahl der Anna von Sehestedt aus dem Hause Groß-Nordsee, ihr Urgroßvater Gregorius von Ahlefeld, Erbherr zu Seegard und Gravenstein, Gemahl der Metta von Blume aus dem Hause Seedorf und Pronsdorf, ihr Ururgroßvater Johann von Ahlefeld, vermählt mit Margaretha zu Rantzau aus dem Hause Kohövede, und ihr Urururgroßvater Paul Rantzau, fürstlicher Oberstlieutmant, der jüngste Sohn des Feldmarschalls Johann Rantzau zu Breitenburg, und Besitzer von Hemmelmark, Arlewatt, Kohövede (Ludwigsburg), Lindewitt, Beienfleth, Schafstedt und Bothkamp.
*) Einstiger Besitzer eines Erbbegräbnisses innerhalb des großen Nordeingangs der Kirche zu Hohenaspe.
und die Kellermeister Johann Hinrich von Bergen, Samuel Kock, Otto Christoph Wulff und Rieckmann, samt dem Kellerknecht Lorentz Lorentzen, und mit Tafelmusik aufwarten der Hofmusikus Johann Friedrich Bährwaldt aus Schleswig und die Kammermusici Büchner und Johann Michael Friedrich, welcher letztere früher am russischen Hofe in Dienst gestanden.
Da und dort und hier leisten Hilfe und Beistand und liegen treulich ihren Pflichten ob die Kammerdiener Johann Michael Ringk, Georg Hilscher, Georg Gottlieb Sutorius, Jakobsen und Magnus Carl Conrad Rudolf Baumann, die Kammerfrauen Christians Charlotta Ringken und Maria Barbara Baumann, die Kammerjungfern Margaretha Louysa Köppeln, Maria Herbstfelden und Carlina Louyse Eleonore Kotzebue, wie auch der Kammermohr Matthies u.a.
Drüben ist der markgräfliche Marstall voll edler Rosse. Er steht unter der Obhut der Stallmeister Hans Adolph Lembke, Peter Jürgens und Majolle, während die mächtigen Wirtschaftsgebäude der Aufsicht des Scheunvogts Claus Alpen anbefohlen sind. Bei Ausfahrten sind Rosselenker die Leibkutscher Peter Nehlsen, Christian Opitz aus Kolding, Claus Kühl aus Nortorf und Martin Klug, welcher letztere später als pensionierter Wagenmeister Kätner in Hohenaspe und in Kaaks lebt, von dem noch heute Nachkommen im Kirchspiel wohnen, freilich nicht mehr Träger des Familiennamens,*) und der, auf Kosten des Markgrafen ausgebildet und von dem König vergebens nach Kopenhagen gezogen, mit wunderbarer Sicherheit auch ein Sechsgespann zu lenken versteht, und selbst scheu und wild gewordene Rosse mit großer Meisterschaft zu zügeln und zu regieren weiß, so daß er nicht selten sich seiner hohen Herrschaft besonderen Dank verdient. Als Läufer müssen auch dann dienen die Mss. Johann Steffen Arnold und Hinrich Lorentzen, von denen es heißt, daß sie nicht selten zur großen Freude des Markgrafen und zum Aergernis der Allerhöchsten Herrschaften über ihre dänischen
*) U.a. die Brüder Claus und Hans Voß in Hohenaspe und ihre Schwestern auf der Mühle daselbst und auf Saaren, wie auch die Brüder Claus und Friedrich Maaß in Hohenaspe und von Soften in Ottenbüttel.
„>Konkurrenten weitaus und mit Leichtigkeit den Sieg davongetragen, sowie als Bereuter vor der Hofequipage Monsieur Christian Södring und der Leibhusar Monsieur Johann Christoph Dannenberg.
Hüben wohnt Schloßverwalter Peter Paulsen, (gest. den 20. Oktober 1788, 80 Jahre alt und begraben aus dem Kirchhof zu Hohenaspe). Verheiratet mit Johanna Catharina geb. Bodsgaard aus Lemvig, ist er der Vater des 1797 gestorbenen ersten Gutsinspektors auf Drage und Schwagers vom Pastor Hennings in Hohenaspe Joachim Friedrich Anton Paulsen. Er ist nur Verwalter des Schlosses.
Die Gutsverwaltung, ein wichtiger Posten, weil zu den Hofländereien außer Drage im engeren Sinne des Wortes mit Friedrichsruhe und außer dem Meierhofe Christinenthal mit der Solitude auch die Ortschaften und Stellen Alt- und Neu-Böternhöfen, am Borstelerteich, Brömbsenknöll, ein Teil von Edendorf, Fuhlenhorn, Hadenfeld, Hansch, wo angeblich der Markgraf einst seinen Handschuh verloren, ein Teil von Hohenwestedt, ein Teil von Hohenaspe, Charlottenburg, Margarethenburg, ein Teil von Huje, ein Teil von Kaisborstel, Kathstelle, Lohfiert, Looft, ein Teil von Oldendorf, ein Teil von Ottenbüttel, ein Teil von Peißen, Peißenerpohl,*) ein Teil von Pöschendorf, ein Teil von Ridders, Reher, Rollohe, Schünrehm, Teichkathe und Tiergarten gehören, liegt einer Reihe von Gutsverwaltern ob, die hier und dort wohnen, u. a. Johann Gerckens, Walther, Claus Schnoor, Johann Christian Hein, namentlich aber dem in der Nähe wohnenden Gosche Conrad Trapp.
Der letztere, wohl aus Dänemark gebürtig, und verwandt mit der Familie, aus welcher J H. Trap, der bekannte Verfasser einer „statistisk-topografisk Beskrivelse af Kongeriget Dänemark (Kjöbenhavn 1860)“, hervorgegangen, ist des Markgrafen als Kirchenpatrons Vertreter beim Pastoratsbau in Hohenaspe**) und Vater sowohl von Ernst Christian
*) Es soll in dessen Nähe in Schloß gelegen haben. Ein Herr Reimer von Peitzen, „swarten Detlevs“ Sohn, verpfändete Herzog Adolf sein Dorf Bücken 1444. Auch wird eine „swart Margret“ erwähnt. Siehe Schröder-Topographie,
**) Siehe unten.
Trapp, geb. den 8. November 1745, als von Christian Adolf Trapp, geboren den 11. September 1747, von denen unter Beihülfe der markgräflichen Herrschaften, welche am 11. November 1745 seine Paten gewesen, der erstere im Lauf der Zeit ein weit berühmter philantropischer Pädagoge wird, nach vollendeten akademischen Studien zuerst von 1773 – 1776 Rektor in Itzehoe, dann bis Ende 1777 Konrektor in Altona, hierauf bis 1779 Professor am Philanthropinum in Dessau, sodann bis 1783 Professor der Pädagogik in Halle und end-lich, nachdem er bis 1766 Vorsteher der Campe’schen Erziehungsanstalt bei Hamburg gewesen, Vorsteher der Erziehungsanstalt in Salzdahlum ist und als eifrigster Mitarbeiter am Revisionswerk Campe’s den 18. April 1818 sein Leben beschließt.
Im herrlichen Schloßgarten und ausgedehnten Park nördlich und nordwestlich vom Schloßplatz stehen die prächtigen Baumgruppen, lieblichen Zierpflanzen, wohlgepflegten Beete und Rasen, Treibhäuser, Obstbäume, heimlichen Stätten und schattigen Lauben, wundervollen Standbilder und Vasen, waldumkränzten Schwanen- und Enten-Teiche, Fischheller, die Fasanerie und die Reitbahn*) unter Fürsorge und Pflege der Hofgärtner Tinte, August Friedrich Bauer und Claus Diedrich Behrens mit ihren Gärtnergehülfen und Gartenarbeitern, von denen Ulrich Conrad Löhge aus Kopenhagen, Clas Witthöft aus dem Holsteinischen ist. Für die Fasanerie sind besondere Fasanenmeister, Vogelfänger und Hegereuter, Berendt Dibbern (gest. den 20. Juni 1793 als Pensionist) und Michael Wurtzinger, angestellt, und treibt lohnenden Fischfang in den Fischhellern Asmus Jürgens. Auf der Reitbahn dienen die Reitknechte Reimer Sierk, Johann Looft, Peter Jürgens und Marx Dentzau, während Marx Ruge nur Stallknecht ist.
In den Waldungen rings umher jagt in dauernd ungetrübter**) Friedenszeit als echter Hohenzoller der Markgraf
*) Vergl., die Parzellierungsurkunde von 1787.
**) Nur im Jahre 1762, als 40 000 Mann dänischer Truppen unter dem General St. Germain den Russen durch Mecklenburg entgegenrückten, sah es drohend aus. Doch starb Kaiser Peter III., der gegen Dänemark
häufig mit dem Oberförster Georg Jacobi, Sohn des weiland Hochfürstlichen Wildmeisters zu Bayreuth Johann Adam Jacobi (gest. 2. September 1785, 72 Jahr alt), mit den Oberjägern Balthasar Rubacker, Hinrich Bruhn und Abraham Pohle, mit den Parforcejägern und Büchsenspannern Friedrich Hansen, Marx Jakobs, Friedrich Tilsen, Johann Daniel Lorenz Pöschel und den Jägern Marx Dreyer und Peter Schultz. Er ist meistens umgeben von hoher Jagdgesellschaft von fern und nah. Auch die Frau Markgräfin ist große Freundin der Jagd, und heißt es, daß sie ihrem Diener einen Speziesthaler aus der Hand heraus geschossen, ohne ihn zu verletzen.
Die Aufsicht in den Waldungen führen außer den Förstern noch besondere Holzvögte, unter denen Detlef Kock (gest. nach 49jährigem Dienst sowohl unter den letzten Grafen Rantzau, als auch unter dem Markgrafen am 17. Januar 1757 im Alter von 81 Jahren) in dem Gehege Halloh wohnt.
Die Wiesen und Felder beaufsichtigen die Feldvögte Hinrich Struve und Christian Behrends, Gerichtsvogt in Wald, Wiesen, Feld und Flur ist Hans Gloye.
Als Holländer wirken u. a. Hinrich Gribel, Johann Jansen, Jakob Kopperschmidt und Johann Ernst Lammer.
Als Hofchirurg fungiert Johann Christian Hofmann aus Bergedorf, bis endlich auf kurze Zeit Dr. med. Friedrich Christian Ernst Ringk (gest. 29. Januar 1769, erst 29 Jahre alt) als Hofmedicus eintritt.
Hoffouriere sind Jakob Holm und Johann Christian Eschen (aus Hamburg und römisch-katholisch), als Postillons dienen Christian Schultz und Asmus Böck, Hirten sind Hans Ehlers, Claus Gloye u. a., eine erwähnenswerte Wäscherin ist Frau Anna Margaretha Steinbachen aus Norwegen, Thorwächter Lorenz, Hundekoch und Hundemeister Johann Glasau, und Nachtwächter endlich hochtrabenden Namens Sylvester Wernecke Wesch (gest. den 6. April 1791 als Pensionist in Hohenaspe, 77 Jahre alt).
von jeher haßerfüllte, frühere Großfürst Karl Peter Ulrich, plötzlich, als die Heere nur noch wenige Meilen von einander standen, und Catharina II., friedensbereit, stand ab von der Forderung der Zurückgabe Schleswigs.
Wo diese massenhafte Dienerschaft wohnt? Zum geringsten Teil nur innerhalb der Grenzen des Schloßhofs, zum weitaus größten Teil in Häusern und Häuschen im Schatten der Bäume, an den Wegen und anderswo.
Beständig liegt auf Drage auch eine Leibkompanie, die den Ehren- und Nachtdienst versieht.
Der Hofbaumeister ist schon früher Erwähnung geschehn. Hinzuzufügen ist nur noch, daß eine Reihe von Hof-Handwerkern und -Arbeitern neben und außer ihnen im herrschaftlichen Dienste stehn.
XI. Der 20. Oktober 1743
Ein Tag aus der markgräflichen Zeit verdient besonders hervorgehoben zu werden. Es hat an ihm vor 160 Jahren schon ein Sohn der Heidenwelt in Hohenaspe das heilige Sakrament der Taufe empfangen.
Der oben erwähnte markgräfliche Kammermohr Matthies, zweifelsohne*) aus Westindien herbeigezogen, war nicht, wie der spätere schwarze Diener der markgräflichen Witwe, Christian Carl Ludwig, welcher einst in der Kirche zu Hohenaspe Gevatter gewesen, bereits ein Christ.
Erst am 20. Oktober 1743 wurde der 16jährige Neger von Pastor Andreas Langheim, nachdem er sorgfältig im Pastorat zuvor im Christentum unterwiesen worden, in die christliche Kirche aufgenommen.
Wie viele vom Hofpersonal auf Friedrichsruhe an diesem 19. Sonntag nach Trinitatis dem Taufakt beigewohnt, und wie zahlreich die sonstigen Gemeindeglieder sich dabei beteiligt haben, ist zwar nicht anzugeben, doch steht fest, daß der feierliche Akt „vor zahlreich versammelter Gemeinde“ geschehen, und daß des Täuflings Paten der Markgraf und die Markgräfin gewesen, und ist sicherlich der Gedanke nicht ausgeschlossen, daß bei dieser Gelegenheit noch vor der Zeit der Erlösung aus der am 19. Dezember 1804 allgemein ab
*) Siehe Michelsens schleswig-holsteinische Kirchengeschichte Teil IV. Seite 191 f.
geschafften traurigen Leibeigenschaft*) Herr, Knecht und Sklave, voll dessen sich bewußt, daß „Gott die Person nicht ansieht, sondern in allerlei Volk, wer ihn fürchtet und recht thut, ihm angenehm ist,“ und wie tief die Worte greifen: „Auch die Kreatur frei werden wird von dem Dienst des vergänglichen Wesens zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes“, demütig mit einander im Heiligtum ihres Gottes und Heilands sich vereinigt haben.
Es sind vielleicht dann Zeugen der ersten und bis dahin letzten Mohrentaufe im Gotteshaus zu Hohenaspe gewesen Markgraf und Markgräfin, Etatsrat, Staatssekretär, Kanzleirat, Kanzleisekretär, Stabssekretär, Hofmarschall, Kammerherr, Kammerjunker mit oder ohne Gemahlin, Oberhofmeisterin, Hofdame und Hoffräulein, Verwalter und Vogt, Küchen- und Kellermeister, Lakai, Koch und Küchenschreiber, Pagenhofmeister und Pagen, Stallmeister und Leibkutscher, Kammerdiener, Kammerfrau und Kammerjunker, Oberförster, Hofjäger und Jägerbursche, Läufer, Bereuter, Leibhusar und Leibwache, Holländer, Fasanenmeister, Vogelfänger, Hegereuter und Hundemeister, Hofmusikus und Kammermusikus, Chirurgus, Postmeister und Postillon, Reitknecht und Hoffourier, Fischer, Hirte, Thorwächter und Nachtwächter, Küchenfrau und Waschfrau, Maurermeister, Zimmermeister, Handwerker und Arbeitsmann, Obergärtner und Untergärtner, Bauersmann und Tagelöhner. Gewiß werden auch sowohl Frau Pastorin Anna Catharina Langheim, geb. von Saldern, als auch ihre Mutter, Frau Amtsverwalterin von Saldern von Ottenbüttel, und
*) Im Dorfe Looft wurde sie schon 1788 gegen eine jährliche Abgabe von 198 Thalern 32 Schilling aufgehoben. Im Gute Drage bestand sie bereits im 16. Jahrhundert, wie aus dem Kaufbrief des Baltzer von Ahlefeld mit Claus von Ahlefeldt auf Gelting vom Jahre 1581 (vergl. das Gutsarchiv zu Drage und Michelsens Archiv für Staats und Kirchengeschichte Band 4, Seite 433 und Seite 448 ff.) hervorgeht, wonach der erstere dem letzteren „4 Kerleß zu Drage im Kaspel Aspe sampt allen und jeden Gerechtigkeiten und Wirbenn umb 10 000 Mark verkaufte“ und zwar „aus redlichen“ ihn „darzu bewegenden Ursachen und zuförderst um sein, seiner Erben und Erbnehmen Frommen, Besten und erfolgten Nutzens Willen.“ Die Rantzaus versetzten Leibeigene (vergl. den Kaufbrief der Gräfin von Castell-Rüdenhausen) vom Gute Rantzau nach Drage.
ihre Schwester Fräulein Sophia,*) die spätere Gemahlin des Liumants Johann Friedrich von Heinsohn, mit ihrem Hofmeister Kandidat Peter Nikolaus Schmidt den Pastor Langheim vom Pastorat hinauf zur Kirche begleitet haben. Gewiß hat auch Frau Organistin Ebeling in dem Pastorats- und Organisten-Kirchenstuhl**) gesessen. Ob Kollegen des Organisten Hektor Gerhard Ebeling neben ihm auf der Orgelempore gestanden, oder er noch der einzige Lehrer des Kirchspiels gewesen, wird später ersichtlich werden. Vielleicht daß auch der Informator des privilegierten Wirts vor Drage, Johann Schröder,***) Carrion aus Sachsen, und der Informator des Hofgärtners Bauer im Tiergarten, Weiße, der heiligen Feier beigewohnt haben.
Es war nicht die jetzige (erst 1884 aus der Werkstatt des bekannten Orgelbauers Marcussen in Apenrade hervorgegangene) vortreffliche Orgel, die der Organist Ebeling vorm Taufakt spielte, doch tönte die alte trotz ihrer Mängel am 19. Sonntag nach Trinitatis 1743 feierlicher als je zuvor.
Von seinem mit drei denkwürdigen Wappen #) geschmückten Beichtstuhl trat endlich tiefbewegt Pastor Andreas Langheim an die alte Taufe. Er hatte vorher auf der altehrwürdigen Kanzel gestanden, die schon dem Jahre 1560 entstammt, und deren Fuß die Portraits einer Reihe hoher Kirchenpatrone und Kirchenpatroninnen trägt, er hatte auch vom Altar aus schon der Gemeinde Gottes Wort geboten. Worüber er gepredigt, ob über Matth. 9, 1 – 8 mit seinen zum Gicht
*) Auffallenderweise kennt der Biograph Caspars von Saldern (Siehe oben) diese beiden Schwestern des „Geheimrats“ nicht, sondern nur dessen Brüder Bernhard Caspar (gest. in Livland), Friedrich (jung verstorben), Carl Friedrich (gest. 1770 als dänischer Generalmajor), Christian Albrecht (geb. 15. Dezember 1721. gest. 1806 als Konferenzrat in Altona) und dessen Schwester Hedwig Eleonora, Gemahlin des Justizrats Detlef von Saldern in Kiel.
**) Nach dem Kircheninventar hat der Pastor auch für seine Frau und Gesinde unten in der Kirche einen aparten mit Gitterwerk umzogenen Kirchenstuhl, worin auch der p. t. Organist für seine Frau oder Mädchen einen Stand hat.
***) Diesem Wirt wurden am 29. Mai 1746 Drillinge beschert.
#) 1) Das Rantzau’sche, 2) die verschlungenen Anfangsbuchstaben von „Wilhelm Adolph Graf zu Rantzau“, 3) das Wittgenstein’sche Wappen. Siehe oben.
brüchigen gesprochenen Jesusworten: „Sei getrost, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben!“, oder über die Sonntagsepistel Eph. 4, 22 – 26: „So leget nun von euch ab, nach dem vorigen Wandel, den alten Menschen usw.“, wir wissen es nicht. Welches Wort er gewählt für die Feierstunde, wo „ein Sohn des dunklen Weltteils“ an dem Taufstein mit seinem Bilde der heiligen Jungfrau und des Christuskindes, der auch einst neu erstanden, ein neugeborner Jünger des Gottes- und Marien-Sohns werden sollte, wir wissen es genau nicht anzugeben. Gewiß ist ihm, der freilich nicht, wie einst Pastor Johannes Lüders, eine Kirchweihe vorzunehmen hatte, weil unter dessen oben erwähnten Amtsnachfolgern das alte Gotteshaus nicht wieder von wilden Kriegerhorden geschändet worden,*) dem aber wohl die Pflicht oblag, ein Herz dem Herrn der Herrn zum heiligen Tempel zu weihen, das rechte Wort von Gott gegeben worden und warm von Herzen zu Herzen gegangen.
Ueber den Taufakt selbst berichtet der Täufer in seinem mit besonderer Tinte gemachten Eintrag ins Taufregister nur wörtlich: „Den 20. Oktober als Dominica 19. nach Trinitatis 1743 haben Ihro Hochfürstl. Durchl. der Herr Markgraff Friedrich Ernst von Brandenburg-Culmbach seinen in Höchstdesselben Diensten sich befindenden 16jährigen Mohren, Rahmens Matthies, nachdem derselbe vorhero von mir im Christenthum unterrichtet worden und darüber in beiderseits Durchl. Hohen Gegenwart und zahlreicher Versammlung in hiesiger Kirche sein Glaubens-Bekenntnis abgelegt, allhie öffentlich tauffen und demselben den Nahmen Friedrich Christian in der Tauffe gnädigst beylegen lassen. Die Gevattern bey dieser Handlung sind gewesen:
1. Ihro Hochfürstl. Durchl. der Herr Markgraff Friedrich Ernst von Brandenburg-Culmbach,
2. Ihre Hochfürstl. Durchl. die Frau Markgräffin Christine Sophie von Brandenburg-Culmbach.“
*) Auch in der späteren sogenannten „Russenzeit“ ist die Kirche, obwohl Kosaken nachweislich auch im Hohenasper Kirchspiel waren, verschont geblieben.
XII. Das neue Kircheninventar und der Neubau des Pastorats zu Hohenaspe.
In demselben Jahre, in welchem der Ausbau des Schlosses Friedrichsruhe vollständig vollendet wurde, war, genau am 20. Mai 1745, während Pastor Langheim im Konsistorium in Itzehoe weilte, das derzeitige Pastorat, ein zweistöckiges, mit Ziegeln gedecktes und außer Flur und Keller 12 Zimmer umfassendes Gebäude, samt der Kirchenlade mit dem Kirchenmissal, den Kirchenrechnungsbüchern und Armenkassarechnungen und samt allen auf dem Hofplatz befindlichen Gebäuden, in Flammen aufgegangen.
Sofort nach diesem Brande wurde nicht nur ein neues Kircheninventar angebahnt, welches, von Pastor Langheim mit Hilfe der Kirchenjuraten Harder Langmaak, Hinrich Lahann, Johann Sommer und Carsten Lahann unter Hinzuziehung der alten Kirchenjuraten zustande gebracht und revidiert von dem p.t. Münsterdorfischen Präpositus Jakob Decker*) als Visitator der Hohen-Aspischen Kirche, vom Markgrafen eigenhändig unterschrieben und durch Verfügung dd. Friedrichsruhe, den 7. Februar 1752, endlich unter Beidrückung des markgräflichen Insiegels bestätigt worden; es ward natürlich auch sogleich zum Aufbau eines neuen Pastorats mit Wirtschaftsgebäude geschritten.
Fertiggestellt von dem Erbauer des Schlosses, dem Hofarchitekten und Maurermeister Christian Böhme aus Kopenhagen, und zwar mit Hülfe des Zimmermeisters Töffer aus Itzehoe, des Tischlers Peter Michael Ring in Hohenaspe, des Kleinschmieds Eggert Dellwater aus Itzehoe, des Glasers Hinrich Meyer daselbst, des Grobschmieds Hans Fürst in Hohenaspe, des Malers Jeremias Schnabel daselbst und anderer innerhalb und außerhalb des Kirchspiels, konnte das einstöckige, mit Ziegeln gedeckte und außer Flur und Keller
*) Geboren in Itzehoe, Sohn des dortigen Archidiakonus Johann Jakob Decker, wurde er 1721 Adjunkt seines Vaters, 1726 Diakonus, 1730 Archidiakonus und am 22. November 1751 Pastor und Propst. Er starb den 18. Februar 1767.
9 geräumige Zimmer, von denen eins im Giebel über dem Portal zu Norden, enthaltende, noch heute vorhandene Gebäude mit der neuen, 1821 durch eine noch größere neueste ersetzten, Pastoratsscheune*) bereits im folgenden Jahre in Gebrauch genommen werden.
Ueberlieferer desselben an den Pastor Langheim waren der Gutsverwalter Gosche Conrad Trapp**) als Vertreter des Markgrafen, und die vier Kirchenjuraten Johann Lohse, Marx Langmaak, Detlef Looft und Christian Maaß. Die Kosten beliefen sich außer den vom Kirchspiel Hohenaspe frei geleisteten Hand- und Spanndiensten für das Pastorat auf 2057 Reichsbankthaler 36 Schillinge, für die Scheune auf 1920 Reichsbankthaler 44 Schillinge 3 Dreilinge, welche nachweislich von der Gutsverwaltung und von der Kirchenkasse mit 1000 Reichsbankthalern zinsbar aufgenommenen Kapitals, 335 Reichsbankthalern 15 Schillingen aus der Brandkasse, 249 Reichsbankthalern 29 Schillingen 3 Dreilingen Kollektengeldern der Münsterdorfer und Pinneberger Konsistorien***) und 336 Reichsbankthalern 16 Schillingen Erlös aus dem Allerhöchst unterm 6. September 1743 genehmigten Verkauf eines Hohenasper Kirchenholzes an das Gut Drage bestritten wurden.
Welche geringe Summe! Wie viel wohl heutzutage dafür herzustellen wäre? Die Kosten für den Pastoratsbau bilden einen passenden Maßstab auch für die, welche der Schloßbau erforderte, dessen Material sicher nicht auf dem Landwege, sondern auf Flößen von Tönning elb-, stör- und au-aufwärts gefördert wurde. Es waren diese ja auch trotzdem sicherlich noch groß genug.
*) Die nächstjüngste Pastoratsscheune steht jetzt als Wirtschaftsgebäude auf dem unter einem früheren Besitzer Huß mehrfach abgebrannten Charlottenburg.
**) Siehe oben.
***) Im Jahre 1738 wurde auch für die baufällig gewordene Kirche eine unterm 25. Juni d. Js. vom König bewilligte Kirchenkollekte abgehalten.
XIII. Die Sprache bei Hofe.
So lange Christian VI. (gest. den 6. August 1746) regierte, ward auf Schloß Friedrichsruhe dänisch nur von den jütischen Soldaten, welche als Ehren- und Leibwache des Markgrafen dienten, gesprochen. Die Königin Sophia Magdalena nämlich haßte geradezu die dänische Sprache, und ihr Gemahl redete und schrieb nachweislich niemals dänisch.*) Wie viel die deutsche Sprache damals bei dem dänischen Hofe galt, erhellt sehr deutlich daraus, daß auch das Heer in deutscher Sprache kommandiert wurde.**) Nur das Französische fand neben dem Deutschen beschränkten Raum, wie daraus zu schließen ist, daß Christian VI. eine kleine Anzahl seiner vielen aufbehaltenen Briefe in dieser Sprache abzufassen beliebte.***)
Anders wurde es, als der „dänische Prinz“, wie Kronprinz Friedrich, welcher seine dänische Muttersprache und die dänischen Sitten liebte, von seiner deutschen Mutter spottweise bezeichnet ward, als König Friedrich V. den dänischen Thron bestiegen hatte. Da mußte seine Mutter (gest. den 27. Mai 1770) schweigen. Zwar wurde das deutsche Kommando im dänischen Heere noch eine Weile beibehalten, das Gegengewicht aber, welches schon zu Christians VI. Lebzeiten die dänischen Schriftsteller Langebeck in seinem „dänischen Magazin“, Hollberg in seinen Dichtungen, und viele andere in die Wagschale gelegt hatten, gelangte, bisher ausgewogen, von Stund an mehr und mehr zur Geltung, und die deutsche Sprache war fortan verpönt. Da wird dann auch auf Schloß Friedrichsruhe nicht selten im höchsten Kreise dänisch gesprochen worden sein. Nur die französische Sprache vermochte neben der dänischen sich zu behaupten, ja sie wußte namentlich bei Hofe und in den höheren Stünden mehr Raum als je zuvor sich zu verschaffen.#) Aus diesem letzteren Umstand erklärt sich, daß auf dem Drager Grund und Boden, zumal ja auch des Königs Friedrichs des Großen Hof das Seine mit dazu
*) Siehe Allen’s Geschichte von Dänemark (Kiel 1842) Seite 401 f.
**) Siehe Allen a.a.O. Seite 430.
***) Siehe Allen a.a.O. Seite 401.
#) Siehe Allen a.a.O. Seite 430.
beitrug, nicht nur ein Teil der Dienerschaft der markgräflichen Herrschaften mit „Monsieur“ tituliert zu werden pflegte, sondern auch seit 1758 alle Amtsbriefe an den Pastor zu Hohenaspe die Adresse trugen: A Monsieur Monsieur J. Chr. Eberwein, Ministre de la parole de Dieu“, d. i. „An Herrn I. Chr. Eberwein, Hochehrwürden, Diener am Worte Gottes.“
XIV. Die Hofloge und die Hofstühle in der Hohenasper Kirche.
Die höchst unschöne Loge mit einer belle etage und zwei getrennten Parterreräumen, welche hoffentlich in Bälde einer besseren weichen wird, war zur Zeit der markgräflichen Herrschaften doch wenigstens mit dem markgräflichen Wappen und der Krone geziert. In hohem Grade abstechend von den nachweislich Ahlefeld-Rantzauschen Hofstühlen, ist sie entschieden späteren Ursprungs, zumal der Aufstieg gänzlich stillos ist, und alles und jedes edle Schnitzwerk fehlt, wenn auch der Umriß einer Krone alles überragt.
Die übrigen Hofstühle, von denen einer unter der Kanzel, ein zweiter zu Osten neben der Hofloge, ein dritter, der sogenannte Inspektoratsstuhl, zu Norden von der Kanzel, ein vierter, der sogenannte Mehlbecker Stuhl, zu Süden vor dem Altar, ein fünfter nahe dem Südeingang der mit zwei getrennten Räumen, ein sechster zur Rechten und ein siebenter zur Linken des kleinen Nordeingangs, vielleicht auch noch ein achter und neunter unter der Orgelempore sich finden, geben, mit eingeschnittenen lateinischen Namen und Jahreszahlen versehen, sehr deutlich sich als dem 16. Jahrhundert, der Zeit der Ahlefeld und Rantzau, angehörig zu erkennen, wie denn auch die Beichtstühle des Pastors, seiner Familie und der Familie des Organisten unzweifelhaft dieser Zeit angehören. Sie tragen ja auch zum Teil (Nr. 1, 2 und 3) das vortrefflich ausgemeißelte Ahlefeldt’sche Wappen*) (der Beichtstuhl des Pastorats hat 3 spätere gemalte gräfliche Wappen) und der
*) Ritterhelm, (silberner) fliegender Fisch im (blauen) Felde. Vergl. von Schröders „Schlösser und Herrenhäuser“ (Titelblatt). Vergl. zu diesem Wappen auch Michelsens Schleswig-Holsteinische Kirchengeschichte II. Seite 319.
Beichtstuhl der Pastoren- und Organisten-Familie mit dem angrenzenden Gestühl trefflich gemeißelte und ausgeschnittene Eingangspfosten eigentümlichen, geschmackvollen, älteren Stils.
Welches Schicksal diese Hofstühle samt der Hofloge später gehabt haben, wird weiter unten zu berichten sein. Hier nur noch ein Wort über Nr. 4.
Der sogenannte Mehlbecker Kirchenstuhl wurde nachweislich unterm 6. Dezember 1759 von „Ihro Hochfürstl. Durchl. dem Markgrafen Friedrich Ernst von Brandenburg-Culmbach dem damals auf dem Gute Mehlbeck wohnenden Konferenzrat von Schombourg „für sich und seine Familie“ gnädigst verliehen, damit dieser Freund des Gotteshauses „desto füglicher solchen nach Gefallen bauen und einrichten könne.““ Er wurde vor kurzem von dem p.t. Besitzer von Mehlbeck renoviert und abgeschlossen. Wann werden wieder Kirchgänger darin sich finden?*)
XV. Die Grenzen der Drager Jurisdiktion.
Zur Drager Jurisdiktion**) gehörte bei weitem nicht die ganze Einwohnerschaft des Kirchspiels Hohenaspe. Ein großer Teil stand vielmehr unter der Jurisdiktion des Klosters zu Itzehoe und des Guts Mehlbeck, und worden in den Kirchenbüchern bis in die 70er Jahre dieses Jahrhunderts „dragische, klösterliche und mehlbeckische“ Hufner, Kätner und Insten unterschieden, welche alle drei ihre eigenen Dingvögte hatten. Klösterlich waren ganz Eversdorf, ein Teil von Hohenaspe sowie ein Teil von Ottenbüttel mit dem Ausbau Stahfast und mit Westermühlen. Mehlbeckisch waren ganz Kaaks und Kaaksburg und ein Teil von Hohenaspe. Im Jahre 1846 begab sich auch der Ottenbüttler Freihof wenigstens unter die Jurisdiktion und Polizeiverwaltung des Gutes Drage.
Bekanntlich wurde neuerdings unter der preußischen Herrschaft in Schleswig-Holstein dem früheren Stand der Dinge ein Ende gemacht und auch der frühere Kanon als solcher abgeschafft.
*) Vor der neuesten Abschließung war der Gensdarm Allers mit Familie häufig darin zu finden. Der jetzige Gensdarm Steinhaus war genötigt, sich einen andern Stand zu suchen.
**) Das Patrimonialgericht war in Hanerau.
XVI. Die Erbbegräbnisrechte des Klostersyndikus und des Mehlbecker Gutsbesitzers in Hohenaspe.
Nachweislich besaß der Klostersyndikus Balthasar Albinus*) ein Erbbegräbnis innerhalb des großen Nordeingangs der Kirche zu Hohenaspe. Er hatte dasselbe unterm 6. Januar 1742 von den derzeitigen Kirchenjuraten Marx Schmalmaak, Johann Lohse, Marx Langmaak und Detlef Loofft für 75 Mark lübisch in einer für 4 große Leichen ausreichenden Breite unter Konsens des Markgrafen käuflich erworben. Es wurden nach dem Totenregister mehrfach Familienglieder desselben hier beigesetzt. Seit dem 28. Februar 1824 hat das Erbbegräbnisrecht aufgehört, und ist dem Totengräber die Erlaubnis erteilt worden, das offene Grab für Grabgerät zu benutzen.
Anders steht es mit dem Erbbegräbnisrecht der Familie von Hanssen vom Gute Mehlbeck. Noch heute ist, von Eisengitter eingerahmt, auf dem Kirchhof zu Hohenaspe das Familienbegräbnis, und wurde der am 5. September 1892 in Gaarden bei Kiel verstorbene berühmte Sohn des Kapitäns und früheren Gutsbesitzers auf Mehlbeck, Carl Friedrich von Hanssen und der Friederike geb. Hirsch seid, der Rittmeister a. D. und ehemalige Schwadronchef der schleswig-holsteinischen Armee, Carl von Hanssen (geb. zu Mehlbeck den 24. November 1818, konfirmiert in Hohenaspe im Jahre 1835, wie auch früher sein Bruder Ludwig), einer der mutigsten und gewaltigsten Kampfgenossen der Jahre 1849/50, am 8. September 1892 hier bestattet, – ein Mann, der wohl verdient, nicht nur durch ein prächtiges Denkmal von Granit, das seine am Sophienblatt bei Kiel eine Villa bewohnende Witwe und sein leider geistesschwacher Sohn Friedrich ihm setzten, geehrt zu sein, sondern auch von dem, der ihn als Kämpfer wohl gekannt, durch dieses zweite Denkmal geehrt zu werden.
Woher dies Erbbegräbnisrecht?
*) Siehe oben.
XVII. Das Verhältnis des Guts Mehlbeck zu Drage.
Schon in der ältesten Zeit hing das adelige Gut Mehlbeck, so genannt nach dem daran vorüberfließenden kleinen Mühlenbach, durch Verwandtschaft der Familie von Krummendiek auf Drage und der nachweislich ersten Besitzer Mehlbecks, welche gleichfalls Herren von Krummendiek waren, mit Drage zusammen.
Im Jahre 1351 war Hasso, 1379 Segebode, 1528, nachdem das Gut inzwischen dem Amt Rendsburg einverleibt gewesen, Enewold von Krummendiek Besitzer.
Von letzterem kam das Gut 1528 an Johannes Rantzau zu Bothkamp und Breitenburg*) Im Jahre 1565, nachdem 1538 bereits das zerstreut gelegene Dorf Mehlbeck und das Dorf Kaaks von König Christian III. dazu gelegt waren und 1543 oder später erst ein Hofgebäude erstanden, erbte es dessen berühmter Sohn Heinrich Rantzau.**) Es folgte als Besitzerin seine Gemahlin Christina von Halle. Dann kam es an Franz und nach ihm Erich Rantzau, worauf 1616 es von Oelegaard von Ahlefeld erworben ward. Im Jahre 1619 folgte der Rat und Amtmann in Flensburg Cay von Ahlefeld zu Saxdorf (gest. 1670), dann der Kammerherr Graf Burchard von Ahlefeld und weiter 1673 Balthasar von Ahlefeld zu Heiligenstedten (nicht zu verwechseln mit Baltzer von Ahlefeld?***) dem Gemahl der Margaretha zu Rantzau), dessen Gemahlin Adelheid Benedicte von Ahlefeld als Witwe nur noch von 1691 – 1692 Besitzerin blieb. Von 1692 an Besitz des Reichshofrats Baron Christian Ernst von Reichenbach zu Bienebeck, von 1714 an des Konferenzrats Detlef von Reventlow, von 1715 an des Dietrich Wittmack gewesen, kam das Gut 1720 an den Etatsrat und Kriegskommissär des Markgrafen Friedrich Ernst, Johann Heinrich von Lohendahl #) und 1747 dann an den Konferenzrat und Präsidenten
*) Siehe oben.
**) Siehe oben.
***) Siehe oben.
#) Siehe oben.
in Altona Bernhard Leopold Volkmar von Schombourg, welchem nicht nur*) der Markgraf 1759 den „Mehlbecker Kirchenstuhl“ verlieh, sondern der auch nachweislich den 9. Juni 1752 ein heimgegangenes Töchterlein in Hohenaspe durfte bestatten lassen, jedoch nicht auf dem Kirchhof, sondern in einem Begräbnis innerhalb der Kirche, das zweifelsohne, obwohl ein Aktenstück darüber nicht aufzufinden ist, ihm, der ja dem Markgrafen sehr nahe stand, gleichfalls aus dessen Händen zu teil geworden war. Daß diesem Herrn von Schombourg auch ein von seinen Besitzvorgängern überkommenes Erbbegräbnisrecht auf dem Kirchhof zu Hohenaspe zugestanden, ist sehr wohl denkbar. Im Jahre 1765 wurde das Gut an den Geheimen Braunschweigischen Legationsrat Freiherrn Heinrich von Meurer verkauft und vererbte sich von diesem, der in erster Ehe vermählt war mit Johanna geb. von Wrede, auf seinen Sohn, den Kammerherrn und Major Carl von Meurer zu Krummendiek, der es 1788 an seine Stiefmutter die Baroneß Maria**) von Meurer geb. von Wrede, verkaufte. Es folgte 1784 der Baron Johann Jakob Boerhave von Mauritius als rechter Sohn der genannten Baroneß und ihres ersten Gemahls, des weiland Barons und holländischen Ministers und Präsidenten in Hamburg von Mauritius. Kinderlos im Alter von reichlich 45 Jahren den 17. Juni 1794 auf dem Gute Mehlbeck gestorben, ist dieser nachweislich der erste Besitzer des Guts, der „auf dem Kirchhof zu Hohenaspe“ bestattet worden. Die Beerdigung fand statt am 23. Juni 1794. Er wurde aber nicht auf dem jetzigen „Mehlbecker Erbbegräbnis“ bestattet, sondern auf einem kleineren nach der alten Kirchhofskarte östlicher belegenen und damals mit Nr. 110 bezeichneten Begräbnisplatz, der jetzt, so weit bekannt, nicht mehr Mehlbecker Gutseigentum ist. Die Frage, wie das „Mehlbecker Erbbegräbnis“ an das Gut gekommen sei, wird dadurch nicht erledigt.
Die Lösung derselben ist vielmehr diese. Im Jahre
*)Siehe oben.
**) Nicht „Johanne“, wie von Schröder in seiner Topographie angegeben hat. Oder ist nachzuweisen, daß die Einträge ins Hohenasper Totenregister Unrichtigkeiten enthalten ?
1798 von der zeitweiligen Wiederbesitzerin, der Baroneß Maria von Meurer, auf Andreas Behrens und bald hernach auf den Baron Andreas von Liliencron übergegangen, wurde das Gut 1802 von dem Landrat Friedrich Ludwig von Thienen, 1806 von dem Kammerherrn Hartwig Barthold von Bernstorff und 1824 von dem Kapitän Carl Friedrich von Hanssen für 36 000 Thaler v. Crt. erworben, dem seitdem als Besitzer 1845 J. P. H. Helms, der 65 000 Thaler v. Crt. zahlte, dessen Sohn Joh. Helms, dessen Enkel Fr. Helms, Asmus, zweiter Mann der Witwe des Fr. Helms, Pils, Schmidt (von Magdeburg), Pütker und Messmer (aus Kiel), Besitzer auch von Riese, folgten.
Inzwischen aber kam*) die „Hofparcele Drage“ in den Besitz des Barons Joachim Carl Friedrich von Meurer zu Krummendiek, und wurde dieser damit zugleich Besitzer der Erbbegräbnisse dieser Hofparcele.**) Sein Nachfolger im Besitz eines derselben,***) des jetzigen „Mehlbecker Erbbegräbnisses,“ war der derzeitige Besitzer auf Mehlbeck, und darauf wurde es 1824 nach dem Kammerherrn Hartwig Barthold von Bernstorff — von Hanssen; der andere Teil verblieb der Hofparcele, und finden sich heute darauf die Grabhügel einer Reihe von Angehörigen gewesener Besitzer der Hofparcele; es ruht auch dort einer der Besitzer selbst.
Dem Baron von Meurer konnte an dem Besitz eines zweiten Erbbegräbnisses neben dem zu Krummendiek ihm zu eigen gehörenden wenig gelegen sein, zumal am letztgenannten Orte seine Eltern, Carl von Meurer und dessen 1798 Hinterbliebene Witwe Dorothea Ida Johanna, ruhten und seine Großmutter, die Baroneß Maria von Meurer geb. von Wrede, gestorben den 26. Januar 1802 zu Itzehoe, am 3. Februar d. J. aus dem Kirchhof zu Hohenaspe „in ihrem Begräbnis“ d. h. zweifelsohne auf dem Begräbnisplatz, darauf ihr Sohn, der Baron von Mauritius, bestattet worden, im Alter von fast 90 Jahren zur Ruhe gebettet war.
*) Siehe unten.
**) Vergl. die alte Kirchhofskarte.
***) Nr. 118 der alten Kirchhofskarte.
Carl Friedrich von Hanssen machte seine Rechte im Jahre 1845 geltend, und wurden ihm diese bestätigt durch ein Schreiben der Oberintendantschaft des Gutes Drage zu Itzehoe vom 21. November 1845. Begeisterung für Schleswig-Holsteins gutes Recht, dem so viele edle Söhne auf dem Kampfplatz Blut und Leben bereitwillig geopfert haben, durchdringt aufs neue die schon gar sehr zusammengeschmolzene Schar der alten Kampfgenossen, so oft sie stehen an seines wackern Sohnes Gruft, mit dem vereint sie einst hinaus ins Feld gezogen, mit dem vereint sie auch blutenden, weherfüllten Herzens einst heim gekehrt von Idstedts und Friedrichstadts blutgetränkten Fluren.
XVIII. Die Kaaksburg und ihre Bedeutung in alter und in neuer Zeit.
Vom mehlbeckischen Dorfe Kaaks (früher Caax, noch früher Caakertze, was „Stätte eines Schandpfahls“ bedeuten soll), das 1378 die dermaligen Besitzer Hartwig und Lüder von Krummendiek um zwei ans Kloster Itzehoe verkaufte Hufen verkleinerten,*) nordöstlich liegt neben dem jetzigen Kaaksburg die alte Kaaksburg.
Daß diese ein Schlupfwinkel des ehemals weit und breit berüchtigten Seeräubers Claus Störtebecker gewesen sei, ist mehr wie unwahrscheinlich, zumal sein Name mit „Stör“ und „Beck“ (vergl. Beckaue, Beckdorf, Beckmünde) durchaus nicht zusammenhängt, vielmehr, hochdeutsch ausgedrückt „Sturzbecher“ lautete und ihn als „Säufer“ kennzeichnete. Ein schlechter Schlupfwinkel wahrlich für einen schlauen Räuber! Welch ein thörichter Wahn, er habe sich in einer Sackgasse verkrochen! Oder war die Kaaksburg etwas Anderes, auch wenn sie von Wasser umflossen war?
Die bedeutenden Spuren runder Befestigungswerke, der ringförmige, bedeutend hohe Burgplatz, der teilweise doppelte Wall und Graben zwischen Kaaks und Eversdorf, die beiden Schanzwälle, dienten möglicherweise einst nur dazu, die alten
*) Siehe Schröder‘- Topographie.
Dithmarsen abzuwehren. Vielleicht aber reichen sie, wie die Bökelnburg in Süderdithmarschen, schon in das neunte Jahrhundert, die Schreckenszeit der Danen und Slaven, zurück.*) Weniger wahrscheinlich ist, das; sie erst stammen aus den Schwedenkriegen des 17. Jahrhunderts?**)
Es befremdet, das; in der Nähe der alten Kaaksburg, auf dem jetzigen Besitz des Landmanns Henning Jürgens, zeitweilig eine Gräfin zu Rantzau gewohnt hat. Hängt das etwa damit zusammen, daß 1362 Johann Dohr eine halbe Hufe von Kaaks an Heinrich zu Rantzau verkaufte?***) Keineswegs. Die Gräfin war vielmehr die verwitwete Frau Rittmeistern; Caroline Ernestine von Kobbe, Dochter des weiland Grafen Hans zu Rantzau-Breitenburg und seiner weiland Gemahlin, einer gebornen Scheel, welche, am 26. Juni 1872 im Alter von 77 1/2 Jahren daselbst gestorben, am 30. Juni 1872 auf dem Kirchhof zu Hohenaspe bestattet worden ist und hier ein wohlerhaltenes Denkmal hat, und die damals eilten Sohn, Addo Kuno Wilhelm zu Kaaksburg, verheiratet mit Elise Charlotte Sophie geb. Elvert, hinterlassen, sowie von ihrer bereits verstorbenen Tochter Julie, der weiland Gemahlin des Försters Otto zu Christianslust, einen Sohn August Sophus Otto. Vorher bewohnten sie und ihr Sohn die Gutsparcele Sahren oder Sauren im Felde bei Kaaks, das freundliche Gevattergeschenk Mehlbecks an Drage.#)
XIX. Die markgräflichen Herrschaften im Pastorat zu Hohenaspe.
Nachweislich zweimal waren beide, der Markgraf und die Markgräfin, bei feierlicher Gelegenheit im Pastorat zu Hohenaspe, das erste Mal bei Pastor Langheim, das zweite Mal bei Pastor Eberwein.
Ein Tag heiliger Freude war für Pastor Langheim und seine jugendliche Gemahlin der 5. Sonntag nach Trinitatis,
*) So Prof. Dr. Detlefsen a.a.O. S. 50.
**) Vergl. das Archiv für Staats- und Kirchengeschichte Bd. IV. Seite 407.
***) Siehe Schröders Topographie,
#) Siehe Schröders Topographie.
der 21. Juli 1737. Es war der Tauftag ihres erstgebornen Kindes. Am 19. Juli d. Js. geboren, erhielt ihr Töchterlein die Christennamen Christina Friederica, und hatten die markgräflichen Herrschaften die Patenschaft übernommen.
Wer von der frohen Taufgesellschaft ahnte auch nur im entferntesten, daß schon am 3. Juni 1738 der liebe Täufling sinken werde in des Friedhofs Schoß, und daß bereits am 25. Juli 1739 ein zweites erst 5 Wochen zählendes Töchterlein Anna Maria, genannt nach Amtsverwalterin Anna Maria von Saldern vom Ottenbüttler Hofe, als der Großmutter, dem Schwesterchen im Tode folgen werde; wer vollends dachte damals, es werde der glückliche Taufvater am 6. Juli 1749 schon ins Totenregister die Worte eintragen müssen: „Den 6. Juli, als am 5. Sonntag nach Trinitatis, habe ich, Andreas Langheim, Pastor allhier, meine herzlich geliebte Ehefrau Anna Catharina Langheim geb. von Saldern, welche 1716, den 6. Dezember, in der Stadt Apenrade geboren und den 1. Juli a. c., nachdem sie vorher den 16. Juni eines jungen Sohnes glücklich genesen, allhie des Abends um sechs Uhr gestorben, nachdem ich ins 14. Jahr mit ihr eine christliche und sehr vergnügte Ehe gepflogen und in währender Zeit, unter göttlichem Segen, 9 Kinder mit ihr gezeuget, als 4 Söhne*) und 5 Töchter,**) wovon aber 1 Sohn und 2 Töchter bereits ihrer seligen Mutter in die Ewigkeit vorangegangen, 3 Söhne und 3 Töchter annoch im Leben sind, welchen der treue Gott nebst mir beständig Gnade und Barmherzigkeit vor seinen Augen finden lassen wolle, um Jesu Christi willen, im 33. Jahre ihres Alters, mit innigst gebeugtem Herzen allhie öffentlich nach dem Willen des Herrn begraben lassen müssen“?***)
Ein nicht minder schöner Fest- und Feiertag war für Pastor Eberwein und seine Gemahlin Meta Maria geb. Ruytern aus Wilstrup bei Hadersleben der 23. August 1759.
*) Benedict Konrad Heinrich, geb. den 29. Juni 1749, wurde 1768 Diakonus in Kiel und starb daselbst als Pastor 1725.
**) Eine Tochter war Gemahlin des Klosterpredigers S. A. G. Schmidt in Preetz.
***) Wo und wann Pastor Langheim selber heimgegangen, wie lange er nach 1749 noch gelebt, siehe oben.
Wieder waren die markgräflichen Herrschaften Paten, und wurde der Täufling, die erste und einzige Tochter der glücklichen Eltern, welche Gott der Herr ihnen am 20. August d. Js. beschert hatte, sowohl nach ihnen als auch nach den beiden anderen Paten, dem Generallieutenant Graf Friedrich von Danneskjold-Samsoe und seiner Gemahlin Dorothea geb. Komtesse von Wedel, Christina Sophia Dorothea Friederica genannt. Wieder jedoch sollte der Herzensfreude bitteres Herzeleid folgen. Denn schon am 17. September 1766 hatten Vater und Tochter nebst Großmutter der herzgeliebten von langwieriger Schwindsucht im Alter von erst 36 Jahren hingerafften Mutter die Augen zuzudrücken, und am 22. September d. Js. standen sie vereint an ihrem Grabe. Doch noch mehr. Am 13. Mai 1767 folgte ihrer Tochter auch die teure Großmutter, die schwergeprüfte Witwe Christine Ruyter, geb. Jessen. Cie hatte 1760 schon ihren Mann verloren, den Schiffer Cornelius Jacob Ruyter in Hadersleben, und 1763 war ihr einziger Sohn, der in holländischen Diensten gestandene Equipagemeister Jacob de Ruyter, plötzlich zu Nagapatnam an der Küste Koromandel in Vorderindien vom Tod dahingerafft worden. Nun sank auch sie ins Grab und folgten Vater und Tochter auch ihrem Sarge hinaus zum Gottesacker mit heißen Thronen. Aber damit noch nicht genug. Am 11. September 1759 hatte der Vater seiner zehnjährigen Tochter eine zweite Mutter, Catharina Elisabeth, geb. Koep aus Hamburg, gegeben. Doch auch sie erlag bereits nach einem Jahre, am 16. November 1770, dein „faulen Fieber“, gleichwie die erste Gemahlin nur noch 36 Jahre alt, und sah am 7. Oktober 1771 der Kreuzträger sich genötigt, noch eiumal sich und seiner herzgeliebten Tochter eine Stütze zu geben, indem er sich vermählte mit Elisabeth, geb. Greve, der Tochter des Archidiakonus Arnold Greve an St. Catharinen in Hamburg, welcher ihn veranlaßte, 1772 ebenfalls in Hamburg,*) als Prediger sich anstellen zu lassen und, am 16. August d. Js. daselbst erwählt, zum Diakonus an St.
*) Hier erschienen auch selbigen Jahres in 2. Ausgabe seine zuerst bei Brüning in Itzehoe gedruckten „Geistlichen Lieder“.
Catharinen, seines Schwiegervaters College zu werden, dem er am 10. Mai 1788 folgte aus der Zeit in die Ewigkeit.
XX. Tod und Begräbnis des Markgrafen Friedrich Ernst.
Genau sechzehn Jahre nach dem am 6. August 1746 erfolgten Tode des Königs Christians VI., ward unter König Friedrich V. (1716 – 1766), der nach dem Heimgang seiner ersten Gemahlin, Louise von Großbritannien (1751), seit 1752 zum zweiten Male mit Juliane Marie, der Tochter des Herzogs Ferdinand Albrecht von Braunschweig-Wolfenbüttel, vermählt war, der Markgraf Friedrich Ernst von Brandenburg-Culmbach, 59 1/2 Jahre alt, im Hochfürstlichen Begräbnis der Kirche zu Hohenaspe am 6. August 1762 feierlich beigesetzt. Er hatte „am 23. Juni d. Js., des Nachmittags zwischen 1 und 2 Uhr auf Schloß Friedrichsruhe das Zeitliche mit dem Ewigen verwechselt.“
Ueber die Leichenfeier ist zwar im übrigen nichts aufbehalten, doch ist mit Sicherheit anzunehmen, daß Pastor Eberwein, wie am Sterbebette, so auch an der Fürstengruft getreulich seines Amts als Seelsorger gewartet, und daß es an hohen wie niederen Leidtragenden nicht gefehlt habe. Ob das steinerne Wappen über dem Eingang zum Hochfürstlichen Begräbnis mit dein Namen des Markgrafen sowohl wie der Markgräfin und mit dem Psalmwort: „Ich liege und schlafe ganz mit Frieden, denn allein Du, Herr, hilfst mir, daß ich sicher wohne“ (Psalm 4, 9) sofort auf Wunsch der trauernden Witwe von J. G. Langmaak angefertigt und angebracht worden, und ob dem Datum des Todes des hohen Gemahls später das des Heimgangs der hohen Gemahlin hinzugefügt ist, entzieht sich der Kunde, doch deuten die Inschriften nicht auf eine spätere Ergänzung, und dürfte die Annahme berechtigt sein, daß jedenfalls diese erst nach dem Tode der Witwe entstanden sind.
Wann die schmählichen Beraubungen des Heimgegangenen stattgefunden? Die letzte Mitte Dezember 1831. Es haben dem Verfasser noch etliche ältere Leute des Kirchdorfs von dieser zu berichten gewußt, bei der die Räuber
einen goldenen Knopf des Fürsten und zwei der Löwenfüße seines Sarges verloren, und nicht wenige berichten, daß sie nach dem letzten frechen Einbruch und vor dem sicheren Verschluß des Sarges und der Gruft noch den Entschlafenen in feinem Kämmerlein gesehen haben.
XXI. Die markgräfliche Witwe allein auf Friedrichsruhe.
Gar manches änderte sich in den Jahren, wo die Markgräfin als Witwe allein auf dem vereinsamten Schlosse Friedrichsruhe residierte. Als markgräflicher Hofkommissär fungierte Georg Hilscher, der Kammerjunker Adolf Friedrich von Warnstedt wurde zum Konferenzrat und Oberpostmeister erhoben; als markgräflicher Kommissionsrat und Postmeister amtierte im benachbarten Looft Achatius Nicolaus Koch, vermählt mit der früheren Ehefrau des Proviantkommissärs Friedrich Christian Ringk in Schleswig; sein Stiefsohn Dr. med. Friedrich Christian Ernst Ringk, der noch eine Weile vor des Markgrafen Heimgang Hofmedicus auf Friedrichsruhe gewesen, starb als solcher den 26. Januar 1769, erst 29 Jahre alt; bei Hofe waren unter anderen eingetreten die Gräfin Caroline Louise von Schlieben, die Konferenzrätin Christine Augusta Friederica von Warnstedt und Eleonora Hedwig von Manstein; Hofgärtner wurde Jakob Hinrich Brammer, Hofpagenmeister Matthies Ahrend Becker, Hofküchenmeister wurden Friedrich Wilhelm Kistenmacher und Otto Rudolf Piessch, als Kammerlakai trat ein Ehler Wrage, als Kammermohr Christian Karl Ludwig,*) als.Kammerdienerin Friederika Caecilia Nicolaysen, als Leibkutscher Marx Alpen. Patronin der Kirche zu Hohenaspe blieb die hohe Witwe bis an ihr Ende, und zeugen eine Reihe von Verfügungen mit ihrer Namensunterschrift von ihrer mütterlichen Fürsorge. Von ihrem Vermächtnis an die Kirche war schon zum Teil die Rede.**) Ihr Testament vom 26. März 1779 enthielt aber neben der Verfügung über die Paramente und Ornamente der Schloß-
*) Siehe oben.
**) Siehe oben.
kapelle auch die ausdrückliche Bestimmung, daß sie der Kirche zu Hohenaspe 1000 Reichsthaler zuweise, deren Zinsen jährlich mit beziehungsweise 24 und 6 Reichsthalern dem Pastor und dem Organisten als den Wächtern über das hochfürstliche Begräbnis zufallen sollen.
XXII. Die markgräfliche Witwe allein im Pastorat Hohenaspe.
Noch eiumal war bei feierlicher Gelegenheit die Markgräfin allein im Pastorat zu Hohenaspe. Es war am 19. Januar 1774, am Tauftage des erstgebornen Sohns des früheren Kabinettspredigers auf Drage und nunmehrigen Pastors in Hohenaspe Ernst Matthias Christian Hennings, welchen seine Gemahlin, die frühere Pröpstin Kelter in Itzehoe und Schwester der ersten Frau Gutsinspektor Johanna Sophia Paulsen, Catharina Magaretha, geb. Jordan, ihm am 17. Januar d. Js. beschert hatte. Trotz der eisigen Winterkälte hatten sie sowohl wie Herzog August Wilhelm zu Brandenburg-Lüneburg-Bevern und Prinz Friedrich Carl Ferdinand, Gouverneur von Kopenhagen, es sich nicht nehmen lassen, den kleinen Christian Wilhelm Carl über die Taufe zu heben.
Schwerlich hegten schon damals die Taufeltern und Taufpaten im frohen Verein die Hoffnung, es werde der Täufling als ältester Bruder der am 25. August 1847 in traurigen Umständen zu Hohenaspe unverehelicht gestorbenen Louise Elisabeth und des späteren Träger Hufners daselbst Johann Christopher Bernhard Hennings, welcher, verheiratet mit seiner Kousine Johanna Sophia, der Tochter des Gutsinspektors J. F. A. Paulsen, am 6. April 1838 gestorben, und dessen Hof hernach Jacob Evers und dann lange Jahre dem jetzigen Rentier William Henry Pohlman*) in Hohen-
*) Vater des Adolf Pohlman, der lange Zeit Großhändler in Pernambuco gewesen, die halbe Welt gesehen, und jetzt, verheiratet mit Emily geb. Busch, bis weiter daheim in Hohenaspe im Vaterhause weilt, des Frederik Pohlman, Premierlieutenants auf der Kriegsakademie in Berlin, welcher verheiratet mit der Schwester seiner Schwägerin, Toni Busch, und der plötzlich in Berlin verstorbenen Therese Pohlman, (gest. den 9. Februar 1884). Seine weil. Gemahlin hieß Julie Johanna Dorothea
aspe zu eigen gehörte, — einst Obergerichtsadvokat und bekannter Schriftsteller in Itzehoe werden. Noch weniger aber kam einem der Taufgesellschaft der Gedanke, er werde der Familie in Hohenaspe viele Seufzer auspressen und als königlicher Justitiarius in Wandsbek schließlich enden.
XXIII. Tod und Begräbnis der markgräflichen Witwe.
Auf Friedrich V. war als König von Dänemark Christian VII. gefolgt, schon war er mehr als zehn Jahre am Ruder, Statthalter von Schleswig und Holstein war Landgraf Carl von Hessen-Cassel geworden, da ging auch, 62 Jahre und 9 Wochen alt, am 26. März 1779 die markgräfliche Witwe heim.
In Schleswig infolge unheilbarer Krankheit verschieden, wurde sie ihrem Wunsche gemäß von ihrem einstigen Leibkutscher Martin Klug als Leiche nach Friedrichsruhe übergeführt und dann am 7. April, nicht balsamiert wie ihr Gemahl, im Hochfürstlichen Begräbnis zu Hohenaspe feierlich an der Seite des ihr Vorangegangenen zur Ruhe gebettet.
Auch über diese Beisetzung fehlt die genauere Kunde. Es ist aber sicher anzunehmen, daß Pastor Hennings als der vormalige Kabinettsprediger auf Friedrichsruhe sowohl der hohen Entschlafenen Ausgang von Drage wie Eingang zur Grabesruh gesegnet und es an Trost aus Gottes Wort nicht habe fehlen lassen, wie auch daß um der hohen Patronin Sarg die Gemeinde Hohenaspe in großer Zahl sich gesammelt, um ihr die letzte Ehre zu erweisen.
XXIV. Die Oelbilder der markgräflichen Herrschaften in der Kirche zu Hohenaspe.
Nachweislich sind die trefflichen Oelbilder der Markgrafen und der Markgräfin*) ursprünglich Eigentum des Pastors
geb. Tesdorpf. (Gest, in Eisenach 24. März 1877.) Geboren den 26. Februar 1819 in Hamburg, mütterlicherseits englischen Stammes, wohnte er längere Zeit in Eisenach, wo seine Söhne das Gymnasium besuchten.
*) Siehe oben.
Hennings gewesen und nicht schon unmittelbar nach dessen am 13. Januar 1818 erfolgten Tode von seiner Witwe, sondern erst nachdem auch diese, welche nach 45jährigem Ehestände ihren Gemahl nur noch bis zum 23. November 1818 überlebte, heimgegangen, von den drei oben genannten Henningschen Kindern zugleich mit dem Oelbild des weiland Propsten Kelter,*) das gegenwärtig über dem Mehlbecker Kirchenstuhl hängt, an die Kirche zu Hohenaspe geschenkt worden.
Nach einem Aktenstück sick. Itzehoe, den 7. Januar 1871, wurden diese Porträts im Aufträge der Königlichen Regierung behufs Restauration an das .Königliche Hofmarschallamt in Berlin eingesandt, von wo sie bald hernach verjüngt zurückkehrten. Einsender und Empfänger war, vereint mit dem Kirchenvorstand, der vor dem Amtsantritt des Pastors Hamann als Adjunkt in Hohenaspe angestellt gewesene jetzige Pastor in Neuenbrook, Fietense, und wurden zu seiner Zeit auch die Reste der alten Eisenstangen im Hochfürstlichen Grabgewölbe im Auftrag der Königlichen Regierung vollständig entfernt.
XXV. Die Parcelierung des Gutes Drage.
Nachdem das Gut Drage mit dem Schloß Friedrichsruhe noch etliche Jahre in den Händen der dänischen Krone verblieben, und während dieser Zeit von dem Sohne des 1788 im Alter von 80 Jahren**) verstorbenen einstigen Schloßverwalters Peter Paulsen aus Kopenhagen, Joachim Friedrich Anton Paulsen (gest. 23. Juli, beerdigt 26. Juli 1797 in Hohenaspe, reichlich 51 Jahre alt), als erstem Gutsinspektor verwaltet worden war, wurde dasselbe schließlich infolge Königlicher Resolution vom 5. September 1787 und nach bereits verfügungsgemäß unterm 2. August 1787 abgehaltener öffentlicher Licitation von Christian Vll., König von Dänemark, in 30 Parcelen höchstbietend verkauft. Nur die Königlichen Forste verblieben dem Reichsfiskus.
*) Christoph Wilhelm Kelter, geboren in Hamburg, würbe 1757 erst Diakonus, dann Archidiakonus in Itzehoe. 1767 vom König zum Propsten und Haupt- und Klosterprediger berufen, starb den 27. Juli 1771an der Schwindsucht.
**) Siehe oben.
Welche Preise für die Einzelparzelen erzielt wurden, erhellt unter andern darauf daß für eine derselben, welche 62 Tonnen 6 Scheffel 19 [] Ruthen 8 [] Fuß groß und mit 36 Thalern jährlichen Kanons belastet war, die Taxationssumme von 221 Thalern bezahlt wurde, und daß für taxierten Holzbestand insgesamt nur 8960 Thaler herauskamen.
Von den 30 Parzelen sind besonders zu nennen:
1. Die 3 Schäferei-Parzelen Nr. 1, 2 und 3, groß damals beziehungsweise 64 T. 1 Sch. 29 []R. 5 []F. 62 T. 6 Sch. 19 []R. 8 []F. und 69 T. 7 Sch. 17 []R 1 []F. alten Maßes.
2. Die Parcele Nr. 4, jetzt Eigentum des Gemeindevorstehers von Drage, Johann Hilbert, groß damals 80 T. 6 Sch. 15 []R. 6 []F., participierend damals mit Nr. 1, 2 und 3 an 594 T. 2 Sch. 35[]R. 9 []F. Heideland auf dem Lohfiert,
3. Die Parcele Nr. 5, die Hofparcele, jetzt Eigentum des Stadtrats a. D. Claus Wiese, groß damals 141 T. 1 Sch. 2 []F., jetzt durch Ankauf der zweiten der Schäferei-Parcelen erheblich vergrößert,
4. Die Parcele Nr. 6, jetzt in Besitz von Heinrich Bruns, groß damals 134 T. l Sch.7 []R. 3 []F., durch Ankauf von Ackerland und Verkauf von Holzgrund jetzt an Größe verändert.
5. Die Parcelen Nr. 7 und 8, jetzt in Besitz von Martin Winckler, groß damals beziehungsweise 48 T. 24 [] R. 5 []F. und 89 T. 3 Sch. 38 []R. 8 []F., jetzt ha 121.
6. Die Parcele Nr. 21, Tiergarten, jetzt Eigentum des Gastwirts Langmaak an der Chaussee, groß damals 74 T. 18 []R.,
7. Die Parcele Nr. 22, Sahren, bis vor kurzem, seit 17. Juni 1886, wo der frühere Besitzer Röhling zu verkaufen genötigt war, Eigentum des Gastwirts Hans Voß in Hohenaspe und bewohnt von dessen Schwestern Wwe. Richter und verwitwete Revierförsterin Metta Mielcke, groß damals 46 T. 6 Sch.8 []R. 6 []F., jetzt verkauft an Johannes Schmidt.
8. Die Parcelen Nr. 24 und 25, Christinenthal, groß damals einschließlich Heide- und Moorland beziehungsweise 344 T. 6 Sch. 20 []R 5[]F. und 270 T. 1 Sch. 18[]R. 7[]F.
XXVI. Der Verbleib der Hofkirchenstühle.
Infolge der Parcelierung des Guts Drage bekamen auch die Hofkirchenstühle, wenigstens zum größten Teil, ihre besonderen Besitzer.
Der große herrschaftliche Kirchenstuhl wurde, wie ausdrücklich in der Parcelen-Beschreibung von 1787 bemerkt ist, „mit seinen 3 besonderen Stühlen und zugleich mit dem Kirchenstuhl Nr. 1 und 2, ebenso wie das dem Gute Drage zugehörige Begräbnis in der Kirche und ein bemerkter Teil der Begräbnisse auf dem Kirchhofe, dem Käufer der Hofparcele beigelegt, wogegen dieser fortan verpflichtet war, jährlich für das Gut Drage an den Prediger zu Hohenaspe am Montag nach dem 2. Advent 1 Tonne 6 Scheffel 15 3/8 Sechszehntel Scheffel Roggen in natura zu liefern.“
Von diesen Stühlen ist der erstgenannte, die Loge, bisher noch in ihrer ganzen Unschönheit vorhanden. Doch steht bei dem warmen Interesse des gegenwärtigen Inhabers für kirchliche Kunst und kirchlichen Schmuck gottlob zu hoffen, daß bald die Unschönheit der Schönheit weicht und der Stuhl in eine Zierde des altehrwürdigen Gotteshauses wird verwandelt werden. Nr. 1 und 2, welcher, am Südeingang der Kirche befindlich, durch eine Zwischenthür in zwei Teile getrennt ist und auf der vorderen Eingangsthür die eingeschnittenen Namen Joh. Behrens 1686 und Joh. Schröder 1690 trägt, dagegen wurde später seitens des Besitzers der Hofparcele an einen andern Besitzer abgetreten. Ob der erste dieser späteren Inhaber der Kätner Detlef Stahl in Hohenaspe gewesen, ist nicht zu konstatieren, doch ist dieser bereits in dem Kircheninventar, welches von Pastor Hennings 1803 auf Königl. Allergnädigsten Befehl mit Zuziehung des p. t. Organisten und Küsters Gernandt und den vier Kirchenjuraten H. Lahann, D. Treede, J. L. Sanftenberg und D. Ohrt verfertigt worden“ als berechtigter Eigentümer angegeben. Der jetzige Eigentümer, der Kirchenälteste Friedrich Lembke in Hohenaspe, wohnt auf dem ehemaligen Hausplatz des Detlef Stahl.
Der Kirchenstuhl Nr. 3 unter der Kanzel mit der denk
würdigen Inschrift*) dagegen fiel dem Besitzer der Parcele Nr. 6 mit der Verpflichtung zu, für das Gut Drage wegen Wischmanns wüster Hufe an den Prediger zu Hohenaspe jährlich um Lichtmeß 1Tonne 5 Scheffel 8 Sechzehntel Scheffel Roggen in natura zu liefern, welche Verpflichtung von dem jetzigen Besitzer Heinrich Bruns abgelöst worden.
Die Kirchenstühle Nr. 4 und 5 zur Rechten und Linken des kleinen Nordeingangs zur Kirche endlich kamen an den Besitzer der beiden Parcelen Nr. 7 und 6 mit der noch jetzt bestehenden Verpflichtung jährlich beziehungsweise dem Organisten zu Hohenaspe am Montag nach dem 2. Advent 5 Scheffel 8 Sechszehntel Scheffel Roggen und der Kirche zu Hohenaspe um Lichtmeß 6 Scheffel Roggen für das Gut Drage in natura zu liefern.
Ueber die anderen Hofkirchenstühle, den des Inspektorats zu Norden an der Kirchenmauer und den unmittelbar neben dem herrschaftlichen Stuhl zu Osten befindlichen, wurde besondere Bestimmung nicht getroffen. Ersterer verblieb in Gebrauch des Gutsinspektors, als welcher später der Oberförster fungierte, letzterer war ursprünglich der Stuhl des Försters. Als das Gutsinspektorat als solches aufhörte oder in seinen Funktionen auf ein Minimum beschränkt wurde, fuhr der Oberförster fort, den ihm zugewiesenen Stuhl zu benutzen, der Försterstuhl aber, auf welchen der die ehemalige Oberförsterei jetzt als Landmann bewohnende Wilhelm Voß einst unberechtigterweise Anspruch erhoben, wurde, weil kein rechtmäßiger Eigentümer vorhanden und die Benutzung von seiten der Försterei aufgehört, hinfort zum Stuhl der Kirchenältesten gemacht, welche ihn regelmäßig benutzen.
Der Mehlbecker und der Ottenbüttler Hofstuhl**) wurden natürlich, wie der Pastorats- und Organistenstuhl, gänzlich unberührt gelassen, und verblieben auch mehrere wahrscheinlich früher von der herrschaftlichen Dienerschaft unter der Orgelempore benutzte Stühle samt den Freistühlen der Gemeinde zur uneingeschränkten Verwendung beim Gottesdienst.
*) Siehe oben. An demselben ist noch die Oeffnung für die ehemalige Ohrenbeichte.
**) Siehe oben.
XXVI. Die bisherigen Besitzer der Hofparcele oder des „Stammhofs Drage“.
Der erste Besitzer der Hofparcele oder des „Stammhofs Drage“, welcher „das Verfügungsrecht hatte über die auf dem Hofplatz nach dem Inventar vorhandenen Sachen, das vorhandene Feuergerät, die zum Hofgarten gehörigen steinernen Statuen, Vasen und anderen dahin gehörigen Inventarienstücke und das vorhandene Fischgerät, sowie über alle Planken, Stakkette und Thore der Gärten und der Fasanerie und alles in denselben enthaltene Holz, ingleichen über alle Einfriedigungs-Stakkette am Tiergarten und die an den Wegen stehenden Bäume (Ipern*) und Linden), während die beiden Flügelgebäude des Schlosses, das Kuhhaus, der Pferdestall und das alte Verwalterhaus zum Abbruch von der Stelle verkauft wurden und zur Abfuhr der Materialien eine Frist bis zum 31. Dezember 1789 Vorbehalten worden, war der Regierungsadvokat Christfried Johann Welms, Sohn des Kirchspielsschreibers Hans Welms in Tellingstedt und der Tabea Catharina Henriette geb. Tappern, Gemahl der Catharina Henriette geb. von Saldern (gest. 11. Juli 1793). Ihm folgten
2. Christoph Friedrich Schultze, vermählt mit Johanna Elisabeth Henriette von Gerber, Tochter des hannoverschen Hauptmanns von Gerber,
3. Baron Joachim Carl Friedrich von Meurer zu Krummendiek,**)
4. Peter Schmalmack, vermählt mit Abel Sophia Christina geb. Brockmann,
5. Fürstenau und Bosse, alliiert mit Koß auf dem Gute Aasbüttel, unter denen das Hofgebäude durch Brandstiftung in Flammen aufging,
6. Gustav Joachim Hoyer, vermählt mit Engel Margaretha geb. Harz (um 1824), von dem eine Tochter Charlotte Elisabeth 1835 in Hohenaspe konfirmiert wurde, als die Eltern schon auf Westerholz wohnten,
*) Aspen.
**) Siehe oben.
7. Johann Heinrich Christian Langermann, Hannöverscher Amtsvogt, vermählt mit Sophia Clara geb. Rüstig (um 1826),
8. Obrist Justinus Georgius Stanislaus von Paschkowsky, kaiserlich russischer Ehrenrat und Ritter, vermählt mit Anna Catharina geb. Hammann, Vater des Rechtsanwalts von Paschkowsky in Tondern und zweier Töchter, von denen die eine, Catharina Margaretha Caroline Dorothea, 1840 den 22. Juli verstorben, nachdem sie, die den 24. Januar 1825 geboren, kurz vorher in Hohenaspe konfirmiert worden, die andere, Maria Magdalena Dorothea Justina, geb. 25. Juli 1829, durch ihre Novellen bekannt geworden ist,
9. Ernst Brettschneider, vermählt mit Antoinette Margaretha geb. Neumann aus Barsbüttel bei Hamburg, mit der er angeblich in trauriger Ehe gelebt, Vater des am 19. Juni 1851 gebornen Christian Christoph Ernst Brettschneider,
10. Baron August Georg Ludwig von Hinüber, Sohn des weiland Postdirektors und Majors Christian Carl von Hinüber und der Amalie Clara Antoinette geb. Wissel aus Göttingen, vermählt mit Matthilde Friederike Charlotte Auguste geb. von Poten, gestorben zu Drage den 26. Juni 1862, angeblich an den Folgen der Unmäßigkeit, Vater der Amalie Louise Friederike Ernestine Davide von Hinüber, welche er als 6jähriges Kind hinterließ,
11. Thomas Carr, Sohn des weiland Thomas Carr in Hamburg und der Maria Dorothea geb. Slomann, Enkel des Begründers der bekannten Dampfschiffgesellschaft, vermählt mit Bertha geb. Winckler, der Tochter des weiland Besitzers der 7. und 8. Parcele Maximilian Winckler und der Schwester des jetzigen Besitzers dieser Parcele, Martin Winckler, noch am Leben, aber leider geisteskrank,
12. Bernhardt, verwandt mit dem „Eisenbahnkönig“ Dr. Strousberg,
13. Carl Köppen aus Bückeburg, früher Lieutenant und Instrukteur der japanesischen Armee,
14. Bernhardt (Nr. 12), genötigt, aufs neue den Hof zu übernehmen.
15. Frau Generalin und Baronin von Rabenau, des vorigen Besitzers Schwester, welche den Hof von ihrem durch Dr. Strousberg ruinierten Bruder übernommen,
16. Die bekannte Brauereifirma Buhmann und Wiese in Itzehoe, durch welche der Hof außerordentlich emporgekommen,
17. Claus Jakob Hinrich Wiese, Stadtrat a.D., geboren 1. August 1837 in Norddeich bei Wesselburen, verheiratet mit Margaretha Therese geb. Hein (geb. 14. Juli 1842 in Blankenmoor, Kirchspiel Neuenkirchen), Vater dreier Kinder, Margaretha, verheiratet mit Dr. Falk in Itzehoe, Martha und Augusta, vor 1865 mehrere Jahre Hofbesitzer bei Wesselburen, seit dem 28. Oktober 1865 alliiert mit Buhmann-Itzehoe, seit 1. Mai 1893 alleiniger Besitzer, gelernter Landmann, der den Hof selber bewohnt und bewirtschaftet.
XXVIII. Die Besitzer der beiden anderen Haupthöfe seit der Parcelierung.
Besitzer der beiden zu Norden und Nordosten von der Hofparcele Drage oder dem „Stammhof“ innerhalb der Grenzen des Kirchspiels Hohenaspe belegenen größeren Höfe waren seit der Parcelierung folgende:
Die Parcele Nr. 6 bewohnten und bewirtschafteten bis in die Gegenwart:
1. Peter Schnack senior, früher bei Schleswig, verheiratet mit Abel geb. Jürgensen,
2. Peter Schnack junior, verheiratet mit Margaretha Elsabe geb. Jessen, Vater von sieben Kindern, Asmus auf Katstelle, Johann in Schleswig, Abel, verheiratete Mein in Winseldorf, Anna, verheiratete Hinze auf Drage*), Greten, verheiratete Lahann in Itzehoe, Peter und Elsabe,
3. Heinrich Eduard Luhn, vereint mit seinem älteren auf Christinenthal wohnhaften, mit Constanze geb. Rittmeier und danach mit Marie geb. Staak verheiratet gewesenen.
*) Mutter des Hufners August Hinze in Hohenaspe und des weil. Johann Friedrich Hinze auf Kaaksburg.
später in Amerika verstorbenen Bruder Friedrich Wilhelm Luhn etwa 29 Jahre nach der Parcelierung Besitzer geworden, älterer Bruder der Eleonore Wilhelmine und der Johanne Elisabeth, der Ehefrau des Carl Georg August Julius Emil Rittmeier auf Drage, verheiratet mit Anna Margaretha Louise geb. Glashoff, Sohn des am 1. September 1841 auf Drage verstorbenen Gottfried Wilhelm Luhn und seiner ebenfalls dort am 17. März 1860 Heimgegangenen Ehefrau Johanna Eleonore Christiane geb. Creutz, 1857 oder 1858 nach Steinburg verzogen, um Mitte 1872 auf Osterholz bei Schloß Breitenburg, schließlich von Mitte September 1872 in Ottensen am Felde Nr. 1 wohnhaft gewesen,*) in unvergeßlichem Andenken durch sein und seiner Ehefrau Vermächtnis,**)
4. Jacob Eberhard Heinrich Bruns aus Lübeck, seit nunmehr 36 Jahren Besitzer, verheiratet gewesen mit der am 2. November 1887 verstorbenen Helene Louise Caecilie geb. Ekmann, ist er der Sohn des verstorbenen Kaufmanns Jacob Eberhard Bruns in Lübeck und der Maria Elisabeth geb. Muuß, der Bruder der am 6. August 1882 auf Drage verstorbenen Maria Anna Bertha, welche unverheiratet geblieben, und der Vater der Eleonore Louise Marie, welche verheiratet mit dem Kaufmann und Fabrikbesitzer August Wilhelm Höper in Hamburg, und des unverheirateten Eduard Paul Heinrich Bruns, welcher, am 6. April 1868 geboren, den väterlichen Hof bis heute noch nicht übernommen.
Die Parcelen Nr. 7 und 8 dagegen besaßen bis dahin:
1. Jasper Lohse, besten Nachfolger Kirchhoff und Claus Fick nur Pächter waren,
2. Johann Heinrich Andreas Bauermeister, verheiratet mit Barbara Maria Carolina geb. Carstens (um 1806),
3. Kriegsrat Müller in Itzehoe (etwa 1819 – 1836), dessen Verwalter der nachfolgende Besitzer war,
4. Claus Heinrich Ladehoff, verheiratet mit Sophia Margaretha geb. Hahlbrock (etwa 1819 – 1855),
*) Das Todesdatum ist nicht anzugeben.
**) Siehe unten.
5. Johann Hinrich Otto Ladehoff, verheiratet mit Clara Louise geb. Lange (um 1856 und später), des vorigen Sohn,
6. Maximilian Winckler, verheiratet mit Caroline Friederike geb. von Schlözer, der Schwester des berühmten, 1894 verstorbenen deutschen Gesandten am Vatikan zu Rom, (von 1868 an), Kaufmann in Lübeck, dessen Sohn Ludwig Winckler nicht Besitzer wurde, sondern nur des Vaters Verwalter war,
7. Martin Winkler, des vorigen Sohn, verheiratet mit Auguste Maria Elisabeth geb. Bachér*) aus Lübeck, 1869 bis 1887 Kaufmann in Amerika, seit 28. Juni 1889.**)
XXIX. Die Pastoren in Hohenaspe von der markgräflichen Zeit bis in die Gegenwart.
Schon erwähnt wurden die Vorgänger des Pastors Hennings, des letzten Pastors der markgräflichen Zeit, der die Parcelierung des Gutes Drage und des Uebergangs der Hofparcele aus den ersten Besitzer derselben noch mit durchlebte.
Nachdem dieser den 13. Januar 1818, im Alter von 76 Jahren 9 Monaten und 25 Tagen und nach fast 45jährigem Ehestände und 47jähriger Amtsführung heimgegangen, folgte
1. Joh. Heinr. Reinhold Wolf aus Weslingburen, gewählt am 15. November 1818, vorher seit 1812 Pastor in Windbergen, vermählt mit Maria Dorothea Elisabeth geb. Ehmke, Vater einer Reihe von Kindern, von denen Christine, Heinrich, Wilhelmine Auguste Johanne Marie, Detlef Friedrich Emilius und Rutger Wilhelm Theodor in Hohenaspe geboren, und Nr. 4 auch hier verstorben. Am 20. März 1836 zum Haupt- und Klosterprediger in Itzehoe erwählt und sofort auch zum Propst für Münsterdorf ernannt, wurde er durch
2. Joh. With, gewählt am 4. September 1836, ersetzt. Seit dem 2. April 1826 Hauptpastor in Hattstedt und Schobüll gewesen, war dieser der Sohn des weiland Pastors
*) Ihr Vater ist von Visby auf Gothland (Schweden).
**) Siehe oben.
Johannes With in Bedstedt. Geboren den 12. Mai 1794 daselbst, verheiratet mit Henriette Catharine geb. Nissen, Tochter des Pastors Erich Nissen in Beidenfleth, starb er kinderlos den 13. Oktober 1870 in Hohenaspe in einem Alter von 76 Jahren. Nachdem dann eine Zeitlang Pastor Fietense, seht in Neuenbrook, als Adjunkt das Pastorat weiter verwaltet hatte, wurde
3. Andreas Christian Hamann am 9. Juli 1871 Zum Pastor in Hohenaspe gewählt.**) Geboren den 30. November 1823 in Stubbendorf, vom 4. Juni 1853 an Pastor adj. minist. in Kiel, dann seit dem 17. November 1864 Hauptpastor in Eckernförde gewesen, starb er nach 20jähriger Amtsführung in Hohenaspe am 26. November 1891, und folgte ihm dann, nachdem Pastor Witt, jetzt in Preetz, eine Zeit lang, erst als Adjunkt, dann als Amtsverweser das Pastorat vermaltet hatte und die letzte Zeit vikariert worden,
4. Heinrich Georg Wilhelm Hansen, gewählt am 13. November 1892,***) am 18. Dezember 1892 eingeführt. Geboren den 16. November 1839 in Kropp, Sohn des dortigen Pastors Johannes Hansen und der Juliane geb. Friederici, verheiratet gewesen in erster Ehe mit Agnes Maria Emma geb. Menthen auf Rendsburg (gest. 8. Juli 1884), jetzt aufs neue verheiratet mit Marie Henriette Juliane geb. Brandts aus Holzminden in Braunschweig, der Tochter des weiland Pastors auf Oland, in Neumünster und in Ahrensböck Hermann Julius Christian Brandts und der Enkelin des Konferenzrats und königlich dänischen Leibarztes Dr. Brandts in Kopenhagen, hat er von sieben Kindern erster Ehe noch vier am Leben, Johannes Carl, Gärtner, geb. 18. Juli 1869, Margaretha Julie Theodora, geb. 8. Juli 1871, Christoph Peter Nicolaus, Landmann. geb. 27. Juli 1876, und Marie Antonie Margareta, geb. 26. Februar 1878, sämtlich in Albersdorf geboren, wo er seit dem 12. Juli 1868 Diakonus gewesen.
*) Ueber die Withschen Gräber siehe unten.
**) Konkurrenten waren P. Rulfs – Todenbüttel und P. Blick – Krummendlek.
***) Konkurrenten waren P. Pallesen – Todenbüttel und P. Decker – Klixbüll.
Seines Amtsvorgängers Witwe, Frau Pastorin Emilie Antonie Caroline Auguste Hamann, Tochter des weiland Pastors Ludwig Karstens in Breitenfelde in Lauenburg und Schwester des jetzigen Pastors daselbst, Ludwig Karstens jun. wohnt jetzt mit ihren beiden Kindern, Elisabeth Antonie Friederike (geb. 18. Juli 1869 in Eckernförde) und Andreas Friedrich Ludwig (geb. 25. Juli 1872 in Hohenaspe), welcher Theologie studiert, in Lübeck. Das noch frische Grab ihres verstorbenen Mannes neben den Withschen Gräbern bedeckt ein großes Marmorkreuz auf Sandsteinsockel. Während diese mit Eisengitter und Koniferen umgeben sind, ist jenes bisher noch uneingefriedigt.
XXX. Die bisherigen Organisten des Kirchspiels Hohenaspe
Der erste nachweisbare Organist des Kirchspiels Hohenaspe war Frantz Gottfried Müller aus Vehrden (Verden in Hannover). Seit 1720 zu Hohenaspe angestellt, war er verheiratet mit Frau Anna Müllerin und wurde den 25. Januar 1740, erst 45 Jahre alt, begraben. Seine Witwe überlebte ihn bis zum 7. April 1749. Von seinen beiden Töchtern sank Anna Margaretha, die älteste, schon am 25. August 1735 ins Grab, die jüngste, Caecilie, dagegen heiratete den Buchbinder Johann Diederich Schelhammer in Verden. Es folgte ihm
2. Hector Gerhard Ebeling, verheiratet mit Frau Catharina Margaretha Ebelings, Bruder des Organisten Heinrich Johann Ebeling, am Kloster Blankenburg bei Oldenburg, bis 1753 im Amt, dann samt Frau und zwei Kindern verzogen.*) An seine Stelle trat
3. Johann Michael Klaiber aus Itzehoe, Sohn des Daniel Klaiber daselbst und seiner Ehefrau Metta, welche 1765, 82 Jahr alt, in Hohenaspe bestattet worden, Bruder des Perrückenmachers Daniel Klaiber in Kopenhagen und der Anna Elsabe, verheirateten Kreß in Glückstadt. Seit 1744 verheiratet mit Metta Cicilia geb. Thomsen aus Krempe,
*) Siehe im Uebrigen oben.
verlor er diese den 15. August 1765, ihres Alters erst 43 Jahre, nachdem sie ihm fünf Kinder, Johann Matthias, Daniel Friedrich, Johann Georg, Christina Friederica Hedwig und Christian Gottlieb geschenkt. Seit 1766 wieder verheiratet mit Gesche Dorothea geb. Dehlwater (gest. 3. Oktober 1798, 71 Jahre alt), mit der er keine Kinder hatte, starb er, nachdem er noch seinen jüngsten Sohn zu Grabe getragen, den 4. Juni 1775. Sein Nachfolger war
4. Carsten Gottschalck, als Organist und Küster bezeichnet, Sohn des Stadtsekretärs und Bürgermeisters Johann Friedrich Gottschalk in Tondern und der Anna geb. Abel, verheiratet mit Elisabeth geb. Kayen aus Itzehoe, welche ihn überlebte. Vater von fünf Kindern, Johann Christian Albrecht, Organist in Beidenfleth, Christine Caroline, Catharine Elisabeth Hedwig, Johann Friedrich Bartram und Anna Margaretha Dorothea, starb er den 26. September 1799. Bei seiner den 5. Juli 1776 gebornen und den 9. Juli d. J. getauften ersten Tochter waren Paten die verwitwete Markgräfin und Prinz Friedrich Carl von Braunschweig-Lüneburg-Bevern, Gouverneur von Kopenhagen. An seine Stelle trat
5. Arendt Heinrich Gernandt als Organist, Küster und Schullehrer, verheiratet mit Anna Sophia geb. Marxen aus Schleswig, welche bei ihrem Tode, den 31. Januar 1836, 65 Jahre alt, ihm drei Kinder, Margaretha Catharina, verheiratete Paris in Kellinghusen, Christian» Johanna Dorothea, verheiratet mit dem Müller Chr. P. Classen in Krummendiek, und Friederike, verheiratet mit Lieutenant Friedrich von Revenfeldt in Kellinghusen, hinterließ, sowie von einer verstorbenen Tochter Anna Sophia Amalia, die verheiratet gewesen mit dem Kätner und Rademacher Joachim Ehlers vier Enkel, Heinrich, Ahrend Peter,*) Anna, Margaretha. Nachdem er bereits über 30 Jahre sein Amt verwaltet hatte, wurde ihm von 1831 ein ständiger Unterlehrer zur Stütze in seiner allmählich von 80 auf mehr als 130 Schüler herangewachsenen Schule zu teil. Im Jahre 1838 trat an die Stelle des Unterlehrers ein seminaristisch gebildeter Sub
*) Den 17. März 1894 als Halbhufner in Hohenaspe verstorben.
stitut, und 1839 trat der „alte Gernandt“ endlich mit 160 Thalern Pension in den Ruhestand. Es folgte ihm sein Substitut
6. Johann Hinrich Andreas Jöhnke aus Gettorf. Verheiratet mit Marie Sophie geb. Borchert aus Hamburg, welche ihm am 9. Oktober 1871 drei Kinder, Marie Sophie, Caroline Catharina und Johannes Marcus Bernhard Heinrich, hinterließ, wurde er 1873 mit jährlich 240 Thalern pensioniert und starb als Emeritus den 10. Oktober 1877 in Kellinghusen, 67 Jahre alt, doch wurde er am 13. Oktober d. I. in Hohenaspe beerdigt. „Eine treffliche Lehrkraft, mit guten Kenntnissen ausgestattet und von seltener Treue und Ausdauer“, hatte er 1840 die Freude, die alte für die Kinderfülle lang nicht ausreichende Schule erweitert und 2 Schulzimmer von beziehungsweise 600 []Fuß und 804 []Fuß Größe hergestellt zu sehen. In ersterem, als dem Oberklassenzimmer, unterrichtete er fortan, in letzterem sein Unterlehrer. Erst 1849 trat an die Stelle des Unterlehrers ein fester, selbständiger 2. Lehrer für die Elementarklasse.*) Zum Nachfolger des Emeritus wurde am 14. November 1873 erwählt
7. Hermann Heinrich Rudolph Petersen aus Hoistorf, Segeberger Seminarist mit sehr rühmlicher Auszeichnung zum 2. Charakter. Weil es diesem aber in Hohenaspe durchaus nicht gefiel, ließ er sich bereits 1875 zum Lehrer in Eilbeck bei Hamburg ernennen. Es trat an seine Stelle alsdann am 29. Juni 1875
8. Reimer Friedrich Schröder, geboren den 14. Oktober 1836, examiniert Michaelis 1860 in Segeberg, bis November 1860 Lehrer am Institut in Eimsbüttel, am 13. Dezember 1860 eingeführt als Distriktsschullehrer in Geschendorf, Kirchspiel Pronstorf, am 4. Januar 1864 als Distriktsschullehrer in Schönwohld, Kirchspiel Flemhude, seit dem 4. Oktober 1664 Oberknabenlehrer und Rektor in Wöhrden, seiner Heimat, der schon mit seinem Vorgänger in Hohenaspe zur Wahl gewesen und nun auf zweiter Wahl an gleichem Ort die Stimmenmehrheit erzielt hatte. Verheiratet gewesen in
*) Siehe unten.
erster Ehe mit Caroline geb. Grambold, die ihm am 29. September 1889 drei Söhne, Gustav, Lehrer in Mehlbeck, Theodor, Lehrer im Nordschleswigschen, Wilhelm und den am 2. Oktober 1889 verstorbenen Johannes, hinterließ, trat er am 23. August 1892 zum zweiten Mal in die Ehe mit Marie geb. Petersen, der Schwester des Pastors A. Th. Petersen in Dahler, welcher früher in Hollingstedt gestanden und eine ausführliche Chronik dieses Kirchspiels verfaßte. Die im Jahre 1877 neu erbaute Lehrerwohnung, durch welche samt den Nebengebäuden die Schulgemeinde eine laut Verfügung der Königlichen Regierung vom 23. Juni 1877 bis 1894 abzutragende Schuldenlast von 14 600 Mark bekam, bewohnt derselbe mit dem zweiten Lehrer. Die stehengebliebene alte Schule reicht für die jetzt 168 Schüler bei weiten nicht aus, und steht sowohl eine Erweiterung der Schulräume, als auch die Anstellung eines dritten Lehrers in Aussicht.
XXXI. Die selbständigen Lehrer der Unterklasse in Hohenaspe.
Als selbständiger Lehrer neben dem die Oberklasse verwaltenden Organisten wirkten seit 1849 an der Unterkasse in Hohenaspe
1. Christian Eifer aus Hohenaspe (1849 bis 1859),
2. J. Maaß (1859 bis 19. Mai 1862),
3. Jürgen Gribbohm aus Drage (1862 bis 1866),
4. Timm Behrens (1866 bis Ende 1867),
5. Rohweder (1866 bis 1870),
6. W. Klahn (April 1870 bis Juli 1870), verzogen nach Hodorf,
7. Claus Rohweder aus Peißen (1870 bis 1872), verzogen ins Kirchspiel Wilster,
6. Claus Rohweder aus Hademarschen (Michaelis 1872 bis Ende 1873), verzogen nach Kremperheide,
9. Heinrich Jochim Löptien, geboren in Tökendorf bei Kiel, früher in Heide, verheiratet mit Catharina geb. Trede aus Kaaks (30. August 1878 gewählt, den 14. Oktober d.J. eingeführt) bis jetzt.
Interimistisch waren angestellt zwischen Nr. 1 und 2 der Präparand Schleuß, zwischen 7 und 8 der Präparand Behrens aus Peißen, zwischen 8 und 9 der Autodidakt Behrens aus Peißen (1874 bis 1875, wo er das Seminar bezog), und 1875 bis Michaelis 1877 der von Breitenberg gekommene Lehrer Grelck, jetzt im Kirchspiel Schenefeld.
Ein festes Gehalt von 1200 Mark bezog erst der letzte der genannten selbständigen Lehrer und zwar von seinem Amtsantritt an.
XXXII. Die Lehrkräfte der Schulen Kaaks, Ottenbüttel und Looft von Anfang bis jetzt.
Unter den Schulen des Kirchspiels Hohenaspe ist das mehlbeckische Kaaks (Caax), dem erst 1819 der derzeitige Erbpächter Joh. Averhof zu Kaaksburg mit seinen Nachbarn kontraktlich sich anschloß, samt dem durch die Aue davon getrennten klösterlichen Eversdorf am frühesten mit einer Lehrkraft versehen gewesen. Anfänglich meist zugleich Handwerker oder dergleichen, amtierten dort nachweisbar
1. Hans Schlüter (gest. 17. Oktober 1736, 53 Jahr alt),
2. Gehrd Börsen aus Itzehoe, verheiratet mit Anna geb. Schröder (gest. 6. Juni 1769),
3. Johann Dallmeier, Sohn des Johann Dallmeier in Kohlenbeck und der Margaretha geb Voß, verheiratet mit Margreth geb. Eggers, Vater von Johann, Engel und Dierk, Großvater des Kätners Dierk Dallmeier in Hohenaspe, Urgroßvater des noch lebenden alten Dierk Dallmeier, Tischlers und Anstreichers daselbst, (gest. 25. November 1797, 50 1/2 Jahre alt),
4. Johann Dallmeier, des vorigen Sohn, verheiratet mit Cathrin Margareth geb. Rühmann (1797 bis 1800) verzogen nach Puls,
5. Marx Alpen, verheiratet mit Trina geb. Holm (1800 bis 1837), mit Mark 100 cour. pensioniert, nachdem er kurze Zeit einen Gehülfen gehabt, — derjenige der Lehrer, welcher die Schülerzahl von 30 bis 60 wachsen sah,
6. Eggert Gribbohm, verheiratet mit Caecilia geb. Eggers, Vater des Mediciners Hartwig Gribbohm und der
Catharina (Mai 1837 bis 1. Juli 1873), ein vortrefflicher Lehrer, gebürtig aus Puls, wegen Schwindsucht pensioniert (gest. 5. Juli 1873, 56 Jahre alt), 1839 durch den Verkauf des alten Schulhauses an Detlef Maaß für 705 Mark und den Bau eines neuen Schulhauses, das Detlef Schütt aus Sude für 2194 Mark aufführte, erfreut,
7. Jacob Sievers, Autodidakt, geb. den 12. Oktober 1846 in Jevenstedt, 3 Jahre Nebenschullehrer in Bondelum, Kirchspiel Viöl, und ebenfalls drei Jahre Distriktsschullehrer in Hamweddel gewesen (21. Oktober 1873 bis 6. Juli 1875), verheiratet mit Maria geb. Hartmann (seit 23. August 1872), seit 1870 mit Seminaristenrechten versehen, verzogen nach Looft,*)
8. Marcus Sierk, früher in Schlotfeld, verheiratet mit Maria geb. Hinrichs (10. August 1875 bis 1878), verzogen ins Kirchspiel Nortorf,
9. Hans Andreas Ferdinand Hansen (18. November 1878 bis 3. Juni 1881), nicht ohne Grund entlassen,
10. M. C. H. Behrens, vorher in Büttel (9. September 1881 bis 1883), vociert am 15. Mai 1883 zum Lehrer in Landscheide, Kirchspiel St. Margarethen,
11. Johann Hinrich Reimers, geb. 5. Oktober 1859 in Nussee, nach seiner Seminarzeit zuerst Mittelklassenlehrer in Jevenstedt (1881 bis 1882), dann Soldat, 1882 bis 1883 Lehrer in Grauel, verheiratet seit 16. Oktober 1883 mit Maria Catharina geb. Warnholz, seit 1. Juli 1891 in der ersten Dienstalterszulagestufe (1. Oktober 1883 bis jetzt).
Unter den andern beiden Schulen des Kirchspiels steht Ottenbüttel an Alter Looft voran. In Ottenbüttel wirkten nämlich nachweislich, anfänglich zugleich als Handwerker oder dergleichen:
1. Johann Gottlieb Büchner, verheiratet mit Anna Cecilia geb. N. N., (schon vor 1741),
2. Moritz Friedrich Eversbach, verheiratet zuerst mit Geesche (gest. 21. Dezember 1746), der Mutter der Hanna Maria, welche im Dienst des Frl. von Drost* **) in Itzehoe
*) Siehe unten.
**) Siehe unten.
gestanden, sodann mit Anna Maria Elsabe geb. Michaelsen (gest. 28. Oktober 1755), gestorben den 25. Mai 1755,
3. Ernst Hinrich Boden, verheiratet mit Christiane Johanna Henrietta geb. N. N., Vater des 1759 gebornen Hans Hinrich und der am 5. Juli 1851 im Alter von 91 Jahren 3 Monaten verstorbenen Witwe Catharina Margaretha Witt, welche verheiratet gewesen mit dem Holzvogt Detlef Witt in der Halloh bei Ottenbüttel,
4. Claus Schlüter, verheiratet mit Dorothea geb. Kock, geboren in Kaaks den 15. April 1768, schon vor 1800 angestellt, 1834 durch Vergrößerung des Schulzimmers bis 288 []Fuß erfreut, 1838 im Herbst mit einem Gehülfen versehen, 1839 pensioniert, gestorben den 20. Januar 1848,
5. Joachim Holm, früher in Edendorf, Sohn des früheren Küsters und Lehrers Eggert Holm in Süderhastedt (gest. 18. November 1845 in Ottenbüttel), verheiratet mit Cicilia geb. Eggers, Michaelis 1839 eingeführt, Ende 1879 wegen Augenleidens pensioniert,
6. Christian August Riekhoff, Uetersener Seminarist, vom Patronat unmittelbar ernannt, verheiratet mit Antje geb. Schröder, den 19. Januar 1880 eingeführt, Michaelis 1884 verzogen nach Schierensee,
7. Claus Heinrich Alpen, Uetersener Seminarist, vom Patronat vociert, verheiratet mit Margaretha Henriette geb. Hagenah, den 2. Januar 1885 eingeführt, nach Kellinghusen verzogen und dort verstorben,
8. Johannes Lohse, vorher in Dänischenhagen, Eckernförder Seminarist, verheiratet mit Caecilia geb. Möller, 1888 vom Patronat ernannt.
In Looft dagegen amtierten nachweislich, anfänglich zugleich als Handwerker oder dergleichen:
1. Jacob Kracht, verheiratet mit Gretje geb. Vollstedt seit 1756, nachdem sie vorher verheiratet gewesen mit Jürgen Christoph Gude aus Lübeck, erst um 1756 oder auch später angestellt, Sohn des 1785 verstorbenen Kätners Hans Kracht in Looft, seit dem 16. März 1766 Witwer mit vier Kindern,
2. Marx Langmack, verheiratet mit Dorthe geb. Ralfs, um ca. 1778 angestellt, Vater zahlreicher Kinder, deren Reihe aber der Tod sehr lichtete, Ende 1819 in den Ruhestand getreten, gestorben, 77 Jahre alt, den 18. Dezember 1832,
3. Johann Paul Spitzbart, verheiratet mit seines Vorgängers einzig übrigen Tochter Anna, gestorben schon am 13. Januar 1824, 29 Jahre alt, gebürtig aus Beringstedt, „ein tüchtiger, braver Lehrer,“
4. Sievert Holling, vorher Unterlehrer in Thielenhemme, vom Gutsinspektor ernannt, den 17. Februar 1824 bestallt, am 4. März 1824 im Hanse des Hufners Claus Gloyer eingeführt, nachdem der emeritierte Marx Langmack eine Zeit lang ausgeholfen, verheiratet mit Sophie Cicilia Elisabeth geb. Jensen, 1830 durch bedeutenden Erweiterungsbau der Schulstube mit Hilfe eines königlichen Gnadengeschenks von 1000 Mark cour. und eines Gratials von 100 Reichsbankthalern aus der Drager Gutskasse erfreut, 1866 den 11. Februar, nachdem er mehrere Jahre einen Gehülfen gehabt, gestorben nach „segensreichem“ Wirken,
5. Sievert Holling, Sohn des vorigen, früher Hauslehrer in Heidmühlen, Michaelis 1856 eingeführt, Seminarist, nach einem Jahr schon verzogen,
6. Joachim Butenschön, verheiratet mit Magdalena Elsabe geb. Brandt, den 17. November 1857 eingeführt, von 1858 durch einen Gehülfen unterstützt, 1862 von den Schülern des zu Oldenborstel gelegten Hofes Christinenthal befreit, im Oktober nach Horst verzogen,
7. R. Sievers aus Hoheneichen, den 5. März 1866 eingeführt, nachdem der Interimslehrer Grill eine Weile die Stelle vermaltet, „leider“ schon vor Ende des Jahres verzogen,
6. H. Heinrich Schott, den 9. Dezember 1866 eingeführt, Ende 1867 mit einem Gehülfen versehen, Michaelis 1868 verzogen,
9. J. Brauer, Ende 1868 eingetreten, 1870 bis 1871 durch Gehilfen unterstützt, den 14. Oktober 1873 nach dem Kirchspiel Hademarschen, angeblich nach Spann, verzogen, Autodidakt,
10. C. Martens aus Mözen, Kirchspiel Segeberg, den 15. Mai 1874 eingeführt, nachdem inzwischen der Interimslehrer Grill mit einem Gehilfen die Stelle verwaltet, verheiratet, Vater von vier Kindern, wegen Mißverhältnis zur Schulgemeinde schon nach einem halben Jahre nach Linden, Kirchspiel Henstedt, verzogen,
11. Jacob Sievers,*) nach Erhöhung des Gehalts von 262 Thalern auf 340 Thaler 24 Groschen von Kaaks nach Looft übergesiedelt, „segensreich“ wirkender Autodidakt, am Charfreitag, den 23. März 1894 als Vater von vier Kindern, Anna Catharina Margaretha, geboren 21. Juni 1873, Claudius, geboren 12. September 1877, Johannes, geboren 16. September 1885, und Ernst Detlef, geboren 3. Juli 1892, an Schwindsucht verstorben und am 2. Ostertage beerdigt, in letzter Zeit unterstützt durch den Präparanden Fritz Meier aus Schafstedt, welcher die Schule weiter verwaltete, bis ein neuer Lehrer gewählt war.
Präsentiert wurden vom Königlichen Schulvisitatorium in Itzehoe die Lehrer Jens Dirks von Wittstedt, Hugo Kretschmer, aus Breslau, von Maasholm bei Kappeln, Joh. H. Reimers von Kaaks und als Reserve Hans Chr. J. Herzog von Nordstrand. Es erschienen zur Wahl am 20. Juli 1894 der zweite und vierte der Wahlkandidaten. Gewählt wurde mit 22 gegen 19 Stimmen
12. Hugo Kretschmer. Möge er der rechte Mann sein, und die Schule unter ihm aufs neue emporkommen! Geboren 20. Oktober 1864, vom 1. Oktober 1864 bis 30. September 1885 Lehrer in Katschkau in Schlesien, dann bis 31. Dezember 1890 Lehrer in Heinzendorf in Schlesien, dann bis 30. September 1894 erster Lehrer in Maasholm, ist er verheiratet seit 24. Dezember 1890 mit Marie Christiane geb. Wilde aus Schlesien. Seit dem 1. Oktober ist er in der ersten Dienstalterszulagestufe.
XXXIII. Die Patrone von Aspe und Hohenaspe.
Verschiedentlich war bei Gelegenheit die Rede von Patronen und von Ausübung des Patronatsrechts in Aspe und
*) Siehe oben unter Kaaks
Hohenaspe, doch wird eine Uebersicht über die Patrone von Anfang an bis in die letzte Zeit nicht ohne Interesse sein, zumal daraus sehr deutlich erhellt, daß nicht nur Herren von Drage, sondern auch Herren von Ottenbüttel und von Aspe, und nicht nur Angehörige der Familie von Krummendiek, sondern auch der von Pogwisch, und später sowohl der Familien von Ahlefeldt und zu Rantzau, als auch der fürstlichen Familie von Brandenburg-Culmbach, Inhaber des „jus patronatus“ gewesen sind.
Obwohl leider die zur Zeit des Pastors Geus von Krummendiek*) in der Kirche zu Hohenaspe noch vorhanden gewesene Tafel verschwunden ist, welche die Wappen und Namen von acht Krummendieken trug, die Patrone der Kirche zu Aspe gewesen, obwohl leider auch das unter der sogen. „Lunhörn“ im südlichen Kreuzarm der Kirche zu Osten der Süderthür befindlich gewesene Begräbnis dieser acht Krummendieken in neuerer Zeit, vor etwa zwanzig Jahren, eingesunken und verschüttet worden ist und nur noch an dem in der Ostmauer befindlichen, jetzt mit Ziegelsteinen vermauerten, quadratförmigen Fenster einen Zeugen seiner einstigen Existenz behalten hat, läßt sich doch mit Hülfe der in den Archiven noch vorhandenen Urkunden**) mit ziemlicher Sicherheit Nachweisen, daß folgende Männer dazu gezählt:
1. Ritter Nicolay de Krummendyke,***) welcher in der mehrerwähnten Mühlenurkunde #) bekennt, daß er „judicium majus et minus a nobili Domino Eomite Gerhardo ad usus plebani et juratorum ecclesiae in Aspen in vero feudo recepisse“, d. h. daß er von seinem edlen Herrn Graf Gerhard die höhere und niedere Gerichtsbarkeit (mithin auch das Patronatrecht) zu nutzen des Pfarrers und der Kirchenjuraten in Aspe überkommen habe, als Besitzer von Drage (1336),E
2. Iven von Krummendiek, des vorigen Sohn, als Besitzer von Drage (1362) und als der, welcher, Besitzer auch
*) Siehe oben.
**) Siehe Dr. Lemmerich im Archiv für Staats- und Kirchengeschichte Band IV. Seite 390 ff.
***) Siehe oben.
#) Siehe oben.
des Edelhofs zu Ottenbüttel geworden, 1376 der Kirche in Aspe Einkünfte aus einer Hufe in Ottenbüttel verlieh,*)
3. Hartwig von Krummendiek, des vorigen Sohn, als Besitzer jedenfalls von Drage (Zeit nicht genau anzugeben. Jedenfalls nach 1400), vielleicht auch von Ottenbüttel,
4. Otto von Krummendiek, des vorigen Sohn, als Besitzer jedenfalls von Beckhoff**) und Weddelsdorp,***) vielleicht, wenn auch nicht nachweisbar, von Drage und Ottenbüttel (vor und um 1498),
5. Michel von Krummendiek, des vorigen Sohn, Bruder Hartwigs, der Beckhoff und Weddelsdorp, und Enewolds, der Mehlbeck erhielt, als Besitzer von Aspe (1531 bis 1546); ob vorher schon als Besitzer von Drage oder Ottenbüttel, ist fraglich,
6. Hartwig von Krummendiek, Bruder des vorigen, Besitzer von Beckhoff und Weddelsdorp, als Erbe seines Bruders (1546) auf Aspe,
7. Schack von Krummendiek, des vorigen Sohn, als Erbe von Beckhoff, Weddelsdorp und Aspe, (gestorben 1580),
8. Henrik von Krummendiek, des vorigen und der Dorothea geb. von Damm (Schwester des Bertram von Damm auf Bahrenfleth), als Besitzer von Weddelsdorp und Aspe (gestorben 1598 ohne Leibeserben).
Nach ihres Bruders Tode erbten dessen Schwestern Metta, Gemahlin des Henning von Pogwisch zu Petersdorf und Mutter des Henning von Pogwisch junior, Besitzuachfolgers des Henneke Sehestede auf dem Edelhofe zu Ottenbüttel #) und Margaretha, Gemahlin des Schacko von Ahlefeldt, neben dem anderweitigen Besitz auch Weddelsdorp und Aspe, und ging aus die erstere, also auf
9. Metta von Pogwisch, das Kirchenpatronatsrecht über. Indessen verkaufte ##) diese ###) dasselbe schon 1602 „mit
*) Siehe oben.
**) Siehe Dr. Lemmerich a.a.O.
***) A.a.O.
#) Siehe oben.
##) Vergl. die Kopie des Kaufbriefs dd. Kyl, 15. Juli 1602 im Archiv zu Hohenaspe. Das Original ist im Archiv des Guts Drage.
###) Sie nennt sich übrigens nicht Pogwisch, sondern „Powiske“.
der Wedeme, Kosterei, dem alten Pastorenhaus am Kerkhove, Johane Tidtken seinem Guet zu Aspen und Hinrich Martens seinem Haus und Guet zu Ottenbüttel, nebenst dem Hove und Gute auf der Rullo, so Hans Holling im Besitze, sampt der Ruheloer Mholen,*) mit allen und itzlichen ihren Zubehörigen u.s.w., besonders alleine der Krummendiker selige Begrebnisse, wie die itzo in der Kirchen gemacht sind,**) für dreizehnhundert Reichsthaler, den Thaler zu 33 Schilling lübisch gerechnet“ an ihren „freundlichen lieben Oheimb“, „den edlen und ehrenvesten Baltzer von Ahlefeldt, Kön. Maj. Rath und Ambtmann auf Flensburg, zum Heiligenstedten und Drage Erbgesessen“ wie denn auch 1606 Margaretha von Ahlefeldt ihren Anteil au Aspe demselben für 2120 Thaler überließ. Es folgte somit
10. als Kirchenpatron Baltzer wan Alleweldt. Wie diesen, so haben wir auch dessen Nachfolger bereits genugsam kennen gelernt. Es waren
11. Detlef zu Rantzau,
12. Dorothea geb. von Ahlefeldt, Detlef zu Rantzaus Witwe.
13. Christian zu Rantzau,
14. Detlef zu Rantzau,
15. Christian Detlef zu Rantzau,
16. Wilhelm Adolf zu Rantzau,
17. Friedrich Ernst, Markgraf von Brandenburg-Culmbach,
18. Christine Sophie, Markgraf Friedrich Ernsts Witwe.
Es war diese die letzte, welche das Kirchenpatronatsrecht besaß und ausübte. Nach ihrem Tode ging dasselbe zunächst auf das Gutsinspektorat, dann 1825 auf die Oberintendantschaft in Itzehoe (Kammerherrn van Levetzow, Kardorf usw.) über, bis es endlich erlosch nach der Dänenherrschaft.
Was noch das Schulpatronatsrecht betrifft, so wird es genügen, hier nur zu erwähnen, daß dasselbe früher in den
*) Stehe oben.
**) Siehe oben.
Händen des Guts Drage, des Guts Mehlbeck und des Klosters in Itzehoe gelegen, späterhin und bis in die Neuzeit hinein jedoch, weil Drage parceliert morden, nur vom Gute Mehlbeck an der Schule zu Kaaks und vom Kloster in Itzehoe an der Schule zu Ottenbüttel ausgeübt worden ist.
XXXIV. Die Burg bei Lovethe und das alte Looft.
Wie Ottenbüttel und Aspe, so hatte auch Looft, vormals Lovethe, in alten Zeiten einen Adelssitz, auf den noch heute die Namen der Grundstücke Burg und Rolfsberg unverkennbar Hinweisen. Im Jahre 1247 werden als Herren der Gemarkung, in welcher die Beckau sich in zwei Arme teilt, von denen der westliche den Namen Nonnenbach führt, die Gebrüder Arnolt, Gerbrant und Hartwig vom Hofe Rolfs erwähnt. Ob dieser Hof auf Rolfsberg im Westen des Dorfes Looft gelegen, ob früher oder gleichzeitig auch eine Burg auf dem Grundstück Burg gestanden, das im Norden des Dorfes sich findet, wir können darauf keine Antwort geben. Jedenfalls aber haben die genannten Herren an der einen oder andern Stätte damals residiert. Daß sie verwandt gewesen mit der Familie von Ottenbüttel, kann deshalb nicht wohl sein, weil diese im Jahre 1281 das bis dahin zum Kirchspiel Schenefeld gehörig gewesene Dorf Looft gegen Ländereien in Ohrsee und Beckhof eintauschte und seitdem dasselbe als einen Teil des Kirchspiels Aspe besaß, wenn auch dieser Eintausch offenbar ein warmes Interesse für die Bewohner Loofts an den Tag legt, welche auf ihrem bisherigen Kirchwege nach Schenefeld beständig Feindseligkeiten von den Dithmarsen zu erleiden gehabt. Im Jahre 1465 und später 1474 ebenfalls sind nachweislich bereits die Herren von Krummendiek Besitzer wenigstens der Hälfte der Loofter Dorfschaft. Im Jahre 1592 verkauft ein Heinrich von Krummendiek die ihm in Looft gehörenden Landstellen mindestens zum Teil an Baltzer von Ahlefeldt auf Drage. Wie es später Looft ergangen unter Graf Christian Detlef zu Rantzau, dem gewaltsam an sich raffenden Herrn von Drage, ist bereits erwähnt worden.
XXXV. Der Erbgesessene zu Ridders.
Erwähnenswert ist als größtenteils Drager Gutsareal und Ort, wohin die Drager Parzelenbesitzer und sonstigen Drager Anbauer mühlenpflichtig waren, bis der Mühlenzwang aufgehoben wurde, besonders die Dorfschaft Ridders an der Ridderser oder Peißener Aue, obwohl sie gegenwärtig dem Kirchspiel Kellinghusen angehört. Der Sage nach soll einst das jetzt nichts weniger als arme Dorf so arm gewesen sein, daß das Kirchspiel Hohenaspe es nicht habe aufnehmen wollen. Ob dem so ist, wir wissen es nicht. Wohl aber steht fest, daß 1590 ein Emeke Pogwisch *) als „Erbgeseten tho Ridders“ bezeichnet wird. Ist die Sage begründet, dann sind wahrscheinlich die Dorfsbewohner von ihm oder seiner Familie, wenn nicht von anderen Erbgesessenen, gemißbraucht und ausgesogen worden. Daß die jetzigen Bewohner des Dorfes wohlhabend sind, ist keineswegs von Ungefähr gekommen. Sehr wahrscheinlich ist, daß sie in nächster Zeit ohne neue Widerrede Hohenaspes von der höchsten kirchlichen Behörde dem Kirchspiel zugelegt werden, welchem sie, die weit entfernt von Kellinghusen wohnen, längst hätten angehören sollen.
XXXVI. Die Legate der Kirche zu Hohenaspe zum Besten der Armen und zu kirchlichen Zwecken
Infolge Testaments vom 22. Juni 1811 und gemäß den schon unterm 12. Juni 1805 und 22. Januar 1808 von dem Testator gemachten Bestimmungen erhielt die Kirche zu Hohenaspe von dem am 28. April 1742 zu Drage getauften Hans Looft, Sohn des Hans Looft (genauer Lofft) und seiner Ehefrau Anna, ein Legat von 1500 Reichsbankthalern oder 3375 Reichsmark.
Der Testator, welcher als Verwalter und Gevollmachtigter des königlichen Möbelmagazins in Kopenhagen verstorben und Bruder von Hermann und Johann Looft, Halbbruder des Frederik (Looft?), Onkel des Sekretärs Conrad Looft, dessen
Vater als Kapitän verstorben, und Pflegevater der Anna Elisabeth Dam, Tochter des Schneidermeisters Johann Dam und der Christine geb. Roman, in Kopenhagen war, hatte als Besitzer eines Geweses in der Laxenstraße in Kopenhagen ursprünglich die Kirche in Hohenaspe zu seinem Universalerben eingesetzt.
Weil aber bei der Regulierung der Masse nur ein Kapital von 1500 Reichsbankthalern realisiert werden konnte, erhielt die Kirche zu Hohenaspe zunächst über diese Summe nur eine Obligation.
Es erwies sich nun alsbald, daß das Kapital in einem unsicheren Gewese untergebracht sei und wurde deshalb dem Grossierer Joh. Rink in Kopenhagen die Obligation eingehändigt, weil dieser sich bereit erklärt hatte, soweit wie möglich die Zinsen einzutreiben. An Loskündigung des Kapitals war bei dem Mißstand der Dinge nicht zu denken.
Plötzlich jedoch gestaltete sich die Sachlage unerwartet günstig durch den Umstand, daß der Käufer des Geweses, namens Hoppe, sich verpflichtete, alle Jahre 300 Reichsbankthaler samt den Zinsen bis zum völligen Abtrag der Schuld an die Kirche in Hohenaspe auszuzahlen.
Die erste Zahlung erfolgte richtig im Jahre 1834 unter Vermittelung des Grossierers Rink in Kopenhagen und des Justizrats Jürgens in Hanerau, die letzte statt im Jahre 1839 erst im Jahre 1841. (?)
Die Verteilung der Zinsen, welche die Kirche für die Armen des Kirchspiels zu verwenden hatte, besorgte anfänglich der Kammerherr von Staffeldt auf Drage als Gutsinspektor.
Gegenwärtig ist das Kapital von 3375 Mark teils bei dem Landmann Wilhelm Michaelsen in Hohenaspe, teils bei dem Landmann Hahn in Looft zinsbar belegt, und erfolgt die Verteilung der Zinsen an die Armen seitens des Kirchenvorstandes gleichzeitig mit der Verteilung des Klingelbeutelgeldes.
Ein zweites Legat erhielt die Kirche zu Hohenaspe mittelst Testaments der Eheleute Heinrich Eduard Luhn und Anna Margaretha Louise geb. Glashoff *) vom 2. Juni 1858 gleichfalls zu Armen- und kirchlichen Zwecken.
Im Betrage von 4562,50 Mark wurde dasselbe, nachdem durch Allerhöchsten Erlaß vom 11. April 1892 dem Kirchenvorstand in Hohenaspe die landesherrliche Genehmigung zur Annahme erteilt worden, gerichtlicherseits ausgezahlt.
Das Testament der genannten Eheleute, von denen der Ehemann väterlicherseits Enkel des weiland Johann Friedrich Luhn in Magdeburg und der weiland Marie Eleonore geb. Möhringen, mütterlicherseits des weiland Johann Adam Creutz und der weiland Johanna geb. Rühl war, wurde nach ihrem Hinscheiden von dem Uhrmacher Wilhelm Knoop in Hamburg (Eilbecker Weg 33) vollstreckt und in Altona den 8. Januar 1877, in Hamburg den 19. März 1891 publiziert. Es enthält nachstehende Bestimmungen:
Ein Kapital von 6000 Mark des nachgelassenen Vermögens der Eheleute Luhn soll so lange wie möglich im Erbe des Carl Wilhelm Timm an der Flottbecker Straße in Ottensen in Priorität zu 6 pCt. Zinsen stehen bleiben und von dem Testamentsexekutor besonders verwaltet werden. Von den 300 Mark Zinsen sollen halbjährig ausgezahlt werden:
I. an die Witwe des Stiefbruders der Ehefrau Luhn, Johanna Christiane Regine geb. Quitzow, verheiratet gewesen mit dem Maler Johann Jürgen Glashoff in Hamburg, 45 Mark, 2. an die Witwe Louise Schoon geb. Kaßler aus Itzehoe, wohnhaft in Lübeck bei Herrn Deggau (Dorotheenstraße Nr. 19) 30 Mark, 3. an Trina Glashoff, Vaterbruderstochter der Eheleute Luhn, im St. Barbara-Rantzau-Stift in Itzehoe, 24 Mark, 4. an den früheren Dienstknecht Marx Gadde auf Drage und dessen Ehefrau Margaretha geb. Steinert aus Itzehoe zusammen oder alleine 37 1/2 Mark, 5. an den Tagelöhner und Katenbesitzer Carsten Diek in Kaisborstel bei Itzehoe und dessen Ehefrau Catharina geb. Ditmer aus Hohenaspe zusammen oder alleine 13 1/2 Mark. Wenn 2 von den Legatarinnen verstorben sind, soll der Testamentsexekutor die 6000 Mark zur Auszahlung nach einem halben Jahr loskündigen und dann die Summe von 4600 Mark an den Kirchenvorstand der Kirchengemeinde Hohenaspe als ein Vermächtnis auszahlen, welches derselbe als Lühnsches Legat gesondert vom übrigen Kirchenvermögen zu verwalten.
pupillarisch sicher zu belegen und in der Weise zu verwenden hat, daß
1) mit den Zinsen das Grab der Eltern des Testators auf dem Kirchhof zu Hohenaspe in Ordnung gehalten, das eiserne Gitter um dasselbe in gutem Stande erhalten und nicht von seinem gegenwärtigen Platze verrückt wird, und dafür gesorgt wird, daß innerhalb des Gitters keine andere Leiche beigesetzt werde, daß
2) solange die dritte der Legatarinnen und die Eheleute Godde und Diek leben, die ihnen zugewiesenen Raten halbjährig vom Kirchenvorstand fortbezahlt werden, und zwar den Eheleuten Diek auf 30 Mark erhöht, daß
3) nach Wegfall der erwähnten Legate die freigewordenen Zinsbeträge vom Kirchenvorstand nach dessen bestem Ermessen an Hilfsbedürftige und der Hilfe würdige Arbeiter- und Handwerker-Familien im Kirchspiel Hohenaspe verteilt werden.“
Das auf 4562,50 Mark reduzierte Kapital, welches der Kirchenvorstand seit Ende 1892 in Verwaltung hat, ist zinsbar belegt in der Sparkasse zu Itzehoe zu 31/2 pCt. Es empfängt von den im Testament Genannten nur noch die Witwe Godde jährlich 75 Mark. Außerdem wird aus den Zinsen die Grabunterhaltung bestritten.
Ein drittes Legat erhielt die Kirche zu Hohenaspe infolge letztwilliger Verfügung des Fräuleins Anna Widderich, geboren den 31. Dezember 1828 zu Hohenaspe als Tochter des weiland Arbeiters Carsten Widderich und der Wiebke geb. Fischer, gestorben als ledige Rentiere im Julienstift in Itzehoe den 8. Mai 1892, beerdigt den 10. Mai d. Js. in Hohenaspe auf Nr. 24, dem Begräbnis der Parcele Saaren. Es war ein Kapital von 1000 Mark.
Das Testament dd. Itzehoe, den 11. Juni 1892, bestimmte nämlich zunächst, daß Fräulein Widderich in Hohenaspe begraben werden und ihr Grab mit einem eisernen Gitter umschlossen und mit einem Denkmal aus Stein geziert haben wolle, und dann daß sowohl ihr Grab als auch die Gräber von Herrn Pastor und Frau Pastorin With in Hohenaspe mit Hilfe der Zinsen eines bei der Itzehoer Sparkasse zu belegenden Kapitals von 1000 Mark, welche alljährlich von dem jeweiligen Pastor in Hohenaspe zu diesem Zweck zu heben
seien, unterhalten werden sollten, auch war noch hinzugefügt, nach erfolgter Einziehung der Gräber solle das Kapital von 1000 Mark der Kirche in Hohenaspe als Vermächtnis zufallen. Die vom Königlichen Amtsgericht in Itzehoe dem Kirchenvorstand Ende 1892 zugesandte Summe von 1000 Mark wurde, weil in Itzehoe nur 3 1/2 pCt. gezahlt werden, einstweilen in der Hohenasper Sparkasse mit 4 pCt. Zinsen belegt.
Der t. Pastor verwaltet das Kapital und verwendet die Zinsen bestimmungsgemäß.
Gleichzeitig mit der Kirche erhielten durch dies Testament auch besondere Legate:
1. Witwe Mielcke geb. Voß auf Saaren,*) nämlich 500 Mark,
2. Der Gastwirt Hans Voß in Hohenaspe, Besitzer von Saaren,**) nämlich 200 Mark als Vergütung für seine Bemühungen bei der Beerdigung,
3. Die Söhne des Kreisphysikus Dr. Jessen in Itzehoe, nämlich Karl Jessen 200 Mark, Felix Jessen 100 Mark, Werner Jessen einen Sekretär,
4. Die Töchter des genannten Kreisphysikus, nämlich Adda Jessen einen Nähtisch, Elisabeth Jessen eine Stehuhr, Gertrud Jessen einen seidenen Rock,
5. Bertha Lembke (die verstorbene Ehefrau des Gastwirts Friedrich Lembke in Hohenaspe) eine Taschenuhr mit silberner Kette, und die Kinder Hans Lembke und dessen beide Geschwister beziehungsweise eine silberne Taschenuhr, zwei Ohrringe und einen Eßlöffel.
XXXVII. Die Gutsinspektoren seit der Parcelierung des Guts Drage.
Seit der Parzelierung des Guts Drage im Jahre 1787 verwalteten das mit derselben ins Leben getretene Gutsinspektorat folgende Männer:
l. Joachim Friedrich Anton Paulsen, getauft den 22. Februar 1746 gestorben den 23. Juli 1797 (wie?).
*) Siehe oben.
**) Siehe oben.
Sohn des markgräflichen Schloßverwalters Peter Paulsen,*) Bruder des am 5. Mai 1812 unverheiratet verstorbenen Friedrich Christian Paulsen, Gemahl der Witwe Johanna Sophia Muhl geb. Jordan, der Schwester der Frau Pastorin Hennings,
2. Jacob Gorr, Sohn des weiland dänischen Feldpredigers und den 17. Juli 1713 in Kotzenbüll gewählten Pastors Johann Otto Gorr aus Darmstadt (gestorben 30. September 1749 als senior ministerii) und der Catharina Margaretha geb. Clasen, unverheiratet am 4. März 1805 in einem Alter von ca. 65 Jahren heimgegangen,
3. Wilhelm Kirchhoff, der vielleicht schon vom Tode Gorrs an, jedenfalls aber in den Jahren 1807 bis 1809 amtierte, derzeit unverheiratet war, vielleicht noch länger sein Amt verwaltete, einen Bruder in Kellinghusen hatte und angeblich wegen Unredlichkeit verschwand,
4. Kammerjunker Friedrich von Revenfeldt, um 1812 und später im Amt,**) Vater des Lieutenants Friedrich Christian Adolf von Revenfeldt,***) des Schwiegersohns vom Organisten Gernandt und Großvater der am 8. Mai 1832 gebornen Tochter des letzteren, der noch lebenden Witwe Christine Sophie Louise geb. von Revenfeldt welche, verheiratet gewesen mit dem weiland Müller Steffen Hinrich Lembke in Krummendiek, Mutter des Gastwirts und Bäckers, wie auch p.t. Kirchenältesten, Friedrich Christian Adolf Lembke in Hohenaspe ist, und deren Schwester Friederika Amalia von Revenfeldt am 19. Juni 1834 geboren wurde,
5. Friedrich Neiling, Sohn des weiland Chirurgen in Tondern, Peter Neiling und der weiland Anna Catharina geb. Weidemann, verheiratet mit Dorothea Sophia geb. Deichmann, Vater des am 28. Dezember 1826 gebornen Friedrich Neiling, am 16. April 1827 in einem Alter von 47 Jahren auf Drage verstorben.
*) Siehe oben.
**) Er war zeitweilig Pensionär des am 14. Oktober 1827 zum Pastor in Krummendiek erwählten und Ende 1830 nach Kropp übergesiedelten Vaters des Verfassers.
***) Siehe oben.
6. Kammerjunker Christian Wilhelm von Staffeldt,*) Sohn des Kammerherrn und Amtmanns Otto von Staffeldt zu Travendal und der Angelique geb. von Hollen, Gemahl der Charlotte Caroline Marie geb. von Römer, welche ihm 3 Kinder, Ottilie, Angelique Friederica Caroline (geboren 11. Mai 1830) und Nina Charlotta (geboren 1834), schenkte, am 20. November 1844, erst 39 Jahre alt, wohl infolge von Unmäßigkeit, auf Drage verstorben,
7. Graf Hans Wilhelm Frederik Alexander Sigismund von Schulin,**) Gemahl der Ida Auguste geb. Gräfin von Holck und Vater von 4 Kindern, von denen Caroline Amalie den 21. Mai 1846, Christian Julius William den 26. Oktober 1853 und Carl Friedrich Sigismund Louis den 10. Oktober 1855 auf Drage geboren wurden, zunächst nur bis 1848, wo er weichen mußte,
8. Baron Ferdinand Heinrich August von Liliencron, Gemahl der Frau Baronin Henriette Wolfilde geb. von Brockdorf und Vater des am 6. April 1851 im Alter von 8 Monaten verstorbenen Adam Ludwig Lucian Sophus, sowie zweier Söhne, von denen Clamor Wolf Heinrich Sophus Conrad den 11. Juli 1852 auf Drage geboren, und einer Tochter, welche, in erster Ehe vermählt mit dem Major und Hofchef von Plänkner auf Louisenlund, jetzt Gemahlin des Freiherrn von Seckendorf am Hofe des Prinzen Heinrich in Kiel ist,
9. Graf von Schulin (Nr. 7), nach 1851 aufs neue eingetreten und im Amt bis Ende der fünfziger Jahre, wo er in Hamburg angeblich den Folgen der Trunksucht zum Opfer fiel,
10. Christian von Stemann, früher dänischer Kammerherr und Amtmann in Apenrade, das er, weil er Dänemark gegenüber sich mißliebig gemacht hatte, verlassen mußte, Gemahl einer Schwester des Amtmanns von Kosselt in Rendsburg und Vater der in Itzehoe wohnhaften Zwillingstöchter Auguste
*) Siehe oben.
**) Enkel (?) des J. S. von Schulin, der unter Christian VI. aus Deutschland als Hofmeister nach Dänemark kam und, bald des Königs und der Königin erklärter Günstling, schließlich erster Minister wurde. Siehe Allen, Seite 402.
Matthilde Andrea und Cornelie Sophie Christiane (geboren den 6. Februar 1844 in Tondern, konfirmiert 1860 in Hohenaspe), welcher 1869, verabschiedet, nach Itzehoe verzog und, völlig gelähmt, dort starb,
11. Carl Ludwig Dittmann, bisher Hegereuter zu Drage, Gemahl der Dorothea Sophia Leonore Henriette geb. Müller und Vater der den 1. Dezember 1866 gebornen Hedwig Sophie Elisabeth Dittmann, bis 1871 oder 1872, welcher noch die frühere Oberförsterei, jetzt im Besitz des Parzelisten Wilhelm Voß, am Tiergarten bewohnte,
12. Johannes Heinrich Schwerdtfeger, Gemahl der Claudine Antoinette Victorine geb. Lohmeier (gestorben 25. Dezember 1882, 55 Jahre alt), Vater von 6 Kindern, Elisabeth Charlotte Johanna, Wilhelmine Caroline Dorothea, Ernst Gustav Heinrich, Wilhelmine Caroline Henriette, Thomas Wilhelm Wulf und Carl Theodor Daniel (gestorben 1881, 19 1/2 Jahre alt), zugleich Oberförster des fiskalischen Gutsbezirks Drage vom 1. Juli 1872 bis 1891, dann*) nur Oberförster und später Forstmeister allein, 1893 emeritiert und nach Hanerau verzogen.**)
XXXVIII. Die Förster, beziehungsweise Holzvögte, Hegereuter und Oberförster auf Drage seit der Parzelierung.
Nach der Parzelierung und nach dem Tode des am 2. September 1785 im Alter von 72 Jahren ***) verstorbenen
*) Nach Ernennung eines Amtsvorstehers, des noch amtierenden Friedrich W. Behrens in Looft:
**) Unterm 13. Februar 1883 erließ derselbe eine Verfügung gegen die Unsitte des sogenannten „Branntweinlaufens“ und wurde der derzeitige Gendarm Allers angewiesen, nach jeder stattgehabten Tanzlustbarkeit zu vigilieren und alle Uebertretungen, behufs Bestrafung der Schuldigen, beim Gutsinspektorat zur Anzeige zu bringen. Ob jetzt die Unsitte nicht mehr besteht und niemand mehr im Kirchspiel Hohenaspe durch Alkohol an Leib und Seele sich ruiniert, ob seitdem keine Familie im Kirchspiel mehr dadurch zu Grunde gegangen ist, ob überall jetzt Mäßigkeit und Nüchternheit herrscht, und jedermann die Fleischeswerke flieht?
***) Siehe oben.
markgräflichen Oberförsters Georg Jacobi waren Förster, beziehungsweise „Holzvögte“, „Hegereuter“ und „Oberförster“
1. Marx Jacobs, Sohn des Hans Jacobs in Pöschendorf, Kirchspiel Schenefeld, verheiratet mit Ida Malene geb. Wurtzinger und Vater von fünf Kindern, schon unter dem Markgrafen Parforcejäger, gestorben, 75 Jahre alt, den 10. Dezember 1801, und im Totenregister ausdrücklich als Witwer und „Holzvogt“, bezeichnet,
2. Claus Hinrich Christopher Hansen, Sohn der Albertine Wilmsen und des weiland Bedienten zu Röst Christopher Hansen, ebenfalls „Holzvogt“, verheiratet mit Catharina Marie geb. Drechsler auf Trittau (gestorben auf Saaren 4. Februar 1842), kinderlos gestorben 20. Februar 1839, 65 Jahre alt.
3. Hermann Wiedemann, verheiratet mit Elise geb. Asmus, der im Jahre 1846 den jetzt von den Kirchenältesten eingenommenen Kirchenstuhl*) mit Erfolg als Förster für sich beanspruchte, mehrfach Kirchensteuer verweigerte, im Jahre 1852 energisch mit seinem Rekurs zurückgewiesen wurde, oftmals Stunden lang mit Jagdgeschichten und Anekdoten aufwartete und zeitweilig durch völlig irrationelle Schweinezucht**) sich berühmt machte, „Hegereuter“***)
4. Carl Ludwig Dittmann, „Hegereuter“, später „Gutsinspektor“,
*) Siehe oben.
**) Möge es der kürzlich unter Nr. 6 herausgekommenen 2. verbesserten Auflage besser ergehn.
Innerhalb des Gehäges bereitet waren der Kosen
Zwölf, in denen die Schweine sich lagerten, aber in jedem
Ruheten fünfzig versperrt der erdaufwühlenden Schweine.
Laut erscholl das Getöne der eingepfercheten Säue.
Kauernd sah in der Hütte der Sauhirt, welcher am treusten
Haushielt unter den Knechten des göttergleichen Odysseus.
Homer’s Odyssee.
***) Daß die nicht auf Drage, sondern in Ottenbüttel wohnhaft gewesenen „Holzvögte“ Hinrich Witt (gest. 1782) und Sohn Detlef Witt, verheiratet zuerst mit Abel geb. Rubahn in Westermühlen, dann mit Abel geb. Haß und endlich mit Cathrin Margreth geb. Bode, und Pater von Matthias Witt, Großvater von Cai Witt, Urgroßvater von Matthias Witt, Ururgroßvater von Kai Hinrich Witt, jetzigem Besitzer einer halben Hufe in Ottenbüttel, mehr als nur Aufseher in der Halloh gewesen, ist nicht annehmbar.
5. Johannes Heinrich Schwerdtfeger, Oberförster und Gutsinspektor, später nur Oberförster, beziehungsweise Forstmeister, als „Oberförster“ assistiert durch den „Förster“ Carl Peter Friedrich Ehmsen, welcher, verheiratet mit Catharina Margaretha geb. Schmüser, unmittelbar am Tiergarten zu Osten in dem Hause des früheren Gerichtsdieners wohnt, während die neue Oberförsterei weiter östlich an demselben Wege belegen ist,
6. Ferdinand Storp, Dr. chem. seit Mitte 1893 im Amt, aus Münster in Westphalen, katholisch, Oberförster und Förderer der Moorkultur in der Nähe und in der Ferne, dem nicht nur der Förster Ehmsen, sondern auch ein Forstsekretär, und auf dem Gebiet der Moorkultur neuerdings der Forstassessor Friedrich Ludwig August Förtsch aus Saarbrücken, sowie für die Gehege im Kirchspiel Schenefeld der dortige Förster zur Seite stehen.
XXXIX. Die Neujahrsfeier 1800.
Wenn auch über Feierlichkeiten beim Eintritt in ein neues Jahrhundert bis 1800 uns nichts aufgehalten ist, liegt wenigstens doch aus dem Jahre 1800 ein Aktenstück uns vor, das, wo nach wenig Jahren wieder ein Jahrhundert zu Ende geht, wohl der Beachtung und Betrachtung wert erscheint.
Unterm 1. Dezember 1800 schreibt von Itzehoe aus nämlich der derzeitige Propst P. Burdorff an die ihm unterstellten Pastores, Archidiaconi und Diaconi: „Se. Königl. Majestät (König Christian VII. von Dänemark) haben vermöge eines an mich ergangenen Allerhöchsten Rescripts vom 21. November d. Js. zur Beförderung der Feierlichkeit des öffentlichen Gottesdienstes am bevorstehenden Neujahrstage in Ansehung des abgewichenen Jahrhunderts folgendes zu verfügen geruhet und mir zugleich Allergnädigst anbefohlen, solches Ihnen zu Ihrer Nachricht bekannt zu machen. Damit Sr. Königl. Majestät geliebte und getreue Unterthanen destomehr aufgemuntert werden mögen, sich der im abgewichenen Jahrhundert genossenen Wohlthaten Gottes und seines Allerhöchst Dero Reichen und Landen, während eines so langen
Zeitraums, verliehenen besonderen gnädigen Schutzes und mannigfaltigen Segens mit dankbaren und vertrauensvollen Herzen zu erinnern, ist es Sr. Königl. Majestät Allerhöchster Wille, daß hierauf bei dein am bevorstehenden Neujahrstage zu haltenden öffentlichen Gottesdienste die Aufmerksamkeit vorzüglich gerichtet und in der Absicht von jedem Prediger ein zweckmäßiger biblischer Text zur Predigt gewählet und solcher der Gemeinde nebst den Gesängen am vorhergehenden Sonntage von der Kanzel angezeiget, auch ein eigenes dem wichtigen Gegenstände angemessenes rührendes Gebet von jedem Prediger abgefaßt und gebraucht werde.“
Möge dies alte Dokument als Sporn uns dienen, daß wir, wenn uns der Neujahrsmorgen 1901 beschert worden, nicht minder ernst und stille und andachtsvoll an heiliger Stätte auf das dahingeschwundene bedeutsame 19. Jahrhundert zurückblicken! Möge es aber nicht nur uns drängen zu „rührendem“ Gebet im Heiligtum — das Wort „rührend“ hat einen fatalen Beigeschmack —, sondern zu rechtem, echtem, demutsvollen Dank-, Buß- und Bittgebet zu dem Dreieinigen von ganzem Herzen und mit gebeugten Knieen, und jedenfalls zu mehr und Besserem noch, als was die in dem Dokument noch weiter hinzugefügten pröpstlichen Worte, die sehr an die einstigen „Lehren der Weisheit und Tugend“ erinnern, besagen:
„Da ich wohl keine Gelegenheit mehr erhalten werde, in diesem Jahre ferner an Sie zu schreiben, so macht es meine ungeheuchelte Liebe und meine aufrichtige Teilnahme an Ihrem Wohl mir zur Pflicht, meine gegenwärtige Zuschrift bei dem herannahenden Neujahrstage mit dem heißesten Segenswünsche für Sie und Ihre werten Angehörigen zu schließen. Gott segne Sie, meine geliebtesten Brüder, auch in dem künftigen neuen Jahre mit vielem Guten und schenke Ihnen Gesundheit und Kräfte, daß Sie die Geschäfte Ihres würdigen Berufes mit Heiterkeit und zum Heil der Ihnen anvertrauten Gemeinen verrichten mögen. Er zeichne jedes Jahr, welches seine Vorsehung Sie in dem bevorstehenden Jahrhundert annoch erleben läßt, mit den reichsten Segnungen seiner wohlthuenden Güte aus und lasse Sie vorzüglich in ihrem ganzen Werte die schönen Freuden empfinden, die mit
dem Bewußtsein einer treuen Amtsführung verbunden sind, und die uns am Ziel unsrer Laufbahn mit dem herrlichsten Wonnegenusse lohnen.“
XXXX. Die Kleinode des Jahres 1817.
Nach den deutlichen Zeichen der Zeit der Aufklärung, welchen nicht nur das vorstehend erwähnte pröpstliche Schreiben, sondern auch namentlich das 1780*) an die Stelle des trefflichen 1000-Lieder-Gesangbuchs vom 1. Januar 1753 getretene Gesangbuch Cramerscher Fabrik, der Cramersche Allerhöchst privilegierte Landeskatechismus mit seinem Anfangssprüchlein „Wir Menschen wünschen alle vergnügt und froh zu sein“ und die Adlersche Kirchenagende vom Jahre 1798 angehören, von denen das erstere leider noch heute in Gebrauch ist, während Nr. 2 und Nr. 3 glücklicherweise beseitigt worden sind, finden aber auch im Kirchenarchiv zu Hohenaspe sich die klaren Spuren der Zeit des Morgenrots.
Wenn auch die „Chronik der Reformationsjubelfeier“ in den dänischen Staaten am 31. Oktober, 1. und 2. November 1817, welche C. P. Petersen, Pastor zu Lensahn in Holstein, 1819 in Kiel erscheinen ließ, und welche in unfern Zeiten sehr lesenswert ist, über einen, wie ringsumher, so auch in Hohenaspe ordnungsmäßig stattgehabten Jubelfest- Gottesdienst keinen Bericht erstattet, weil der derzeitige Pastor Hennings, dessen letzter persönlicher Eintrag ins Kirchenregister vom 4. Dezember 1817 datiert, zu Anfang des Jahres 1818 heimgegangen; wenn auch nichts darüber vorliegt, daß die Königliche Anordnung eines im Jahr 1817 zum Andenken der durch Dr. Martin Luther gestifteten Reformation zu haltenden Jubelfestes für die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg, dd. Kopenhagen, den 8. Mai 1817, auch in Hohenaspe befolgt worden sei, und man am 30. Oktober, nachmittags 5 bis 6 Uhr, mit beiden Glocken das Fest eingeläutet habe, am 31. Oktober sowohl wie am Sonntag, den 2. November, unter Glockenklang ins Gotteshaus gezogen sei, am 31. Oktober über Joh. 8, 12, bezw. Ephes. 2, 8 – 10
*) Siehe Kochs Geschichte des Kirchenlieds Band VI. Seite 334 ff.
und am 2. November über 1. Kor. 3, 11 gepredigt habe, an keinem der drei Festtage, noch am Abend vorher öffentliche Lustbarkeit sich erlaubt habe, vielmehr während der Sabbate stille gewesen sei nach dem Gesetz und sich erinnert habe voll und ganz des Großen, das Gott der Herr durch Dr. Martin Luther an der Christenheit gethan: — es ist doch nicht nur im Kirchenarchiv ein Exemplar der ungeänderten Augsburgischen Konfession vorhanden, in welches voran hineingeschrieben ist: „Für das Pastorat an der Kirche zu Hohenaspe“,*) sondern neben den bez. Verfügungen auch ein lateinisches Exemplar des „Hirtenbriefs an die Geistlichkeit**) in bezug auf das dritte Reformationsjubiläum“,***) und ist sicherlich die Festfeier nicht unterblieben.
Mögen die kostbaren Kleinode aus dem Jahre 1817, in welchem bekanntlich Claus Harms, Archidiakonus an St. Nicolai in Kiel, die 95 Thesen Luthers von neuem drucken ließ und mit 95 eigenen Thesen, einer bitteren Arznei für die Glaubensschwächen der Zeit, begleitete #) die Kirchengemeinde Hohenaspe und ihren jedesmaligen Pastor zu allen Zeiten daran erinnern, daß sie fest zu stehen haben auf dem Grunde des ungeänderten Augsburgischen Bekenntnisses, ja
*) Der vollständige Titel lautet: „Confessio Augustana invariata, inter tertia solennia secularia emendatorum sacrorum, .jubente augusttissimo rege Friderico IVto, in usum Danicorum ad fidem editionis Melanchthonianae principis impressa. Havniae Typis expressit Director Joh. Frid. Schulz, aulae regiae et universitatis typographus. MDCCCXVII.“
Der vollständige Titel lautet: „Antistitum ecclesiae Danicae, Slesvico-Holsaticae et Lauenburgensis epistola ad clerum de tertio reformationis jubilaeo diebus XXXI. Octobris, I. et II. novembris MDCCCXVII pie celebrando. Havniae etc.“ Eine deutsche Uebersetzung desselben von Dr. August Wilhelm Neuber ist 1818 bei Hammerich in Altona erschienen und ebenfalls in der „Chronik von Petersen“ zum Abdruck gekommen.
***) Das erste Säkularfest unter Christian IV. und Herzog Friedrich III. ist wahrscheinlich in den Herzogtümern ungefeiert geblieben. Vergl. die Chronik von Petersen in der Vorrede. Das zweite Jubelfest 1717 unter Friedrich IV. und Herzog Carl Friedrich beschreibt Professor Dr. Francke in den Schlesw.-Holst. Provinz-Berichten 1817. Heft 1. Seite 1 bis 31.
#) Vergl. Michelsens Schlesw.-Holst. Kirchengeschichte. Teil IV. Seite 299.
in ihren Herzen verklären müssen Hebräer 10, 23: „Lasset uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißen hat.“
XXXXI. Die Arbeiten der Gesundheitskommission zur Abwehr der Cholera 1831 und 1832.
Der Verordnung zur Verhütung der Pest und anderer gefährlichen Kontagien für die Herzogtümer Schleswig und Holstein, die Herrschaft Pinneberg, Grafschaft Rantzau und Stadt Altona, dd. Kopenhagen, den 30. Dezember 1801, war am 19. Juni 1831 die Verordnung, enthaltend die auf Veranlassung der in verschiedenen Ländern herrschenden Cholera-Krankheit zu treffenden Veranstaltungen für die Herzogtümer Schleswig und Holstein gefolgt.
Auf Grund dieser Verordnung und besonderer Bekanntmachungen und Verfügungen des Sanitätskollegiums wurde unterm 22. Juli 1831 vom Oberintendanten des Guts Drage, Kammerherrn von Levetzow, Ritter, ein Schreiben von Itzehoe aus erlassen, betreffend die Allerhöchst anbefohlenen Gesundheitskommissionen zur Abwehr der Cholera, und unterm 1. August 1831 eine Gesundheitskommission auch für das Kirchspiel Hohenaspe organisiert, welcher Kriegsrat Menke aus Itzehoe, Kammerjunker von Staffeld als Gutsinspektor und Polizeioffizial zu Drage, Parzellist Luhn zu Drage, der klösterliche Hufner Paul Junge in Ottenbüttel und Pastor Wolf in Hohenaspe als Mitglieder angehörten, am 10. August 1831 auch der mehlbeckische Hufner Claus Eggers bei trat und nach des Kriegsrats Aufbruch mit seinem Regiment nach der Grenze, wo auf Allerhöchsten Befehl ein Kordon zur Abwehr der Cholera sich zu bilden hatte, IIr. Eickhoff aus Itzehoe zeitweilig sich anschloß. Allwöchentlich wurde hinfort am Mittwoch uni 5 Uhr nachmittags Kommissionssitzuug gehalten und ein ausführliches Verhandlungsprotokoll ausgenommen. Bereits 15 Sitzungen waren am 23. Januar 1832 abgehalten worden, infolge Schreibens der Oberintendantschaft waren bereits für alle Dörfer des Kirchspiels im Anschluß an die Kommission Gevollmächtigte, 10 an der Zahl, gewählt worden, als plötzlich die Versammlung auseinanderging, um nicht
wieder zusammenzutreten. Nachdem ein gut Teil Panik entstanden, alle möglichen Vorkehrungen und Vorsichtsmaßregeln getroffen für Krankheits- und Todesfall, für Rekonvalescenz und Begräbnis, die Armen zeitweilig aus dem Armenhaus ausquartiert und das Armenhaus als eventuelles Lazarett mit Wärtern und Betten und Hausapotheke und desgleichen eingerichtet worden und eine Ausgabe von 154 Mark und 8 1/2 Schilling entstanden, war mit einem Mal die Nachricht eingelaufen, es habe sich die Cholera als nicht so bösartig erwiesen, und sei dieselbe als erloschen zu betrachten. Die Annen kehrten wieder ins Armenhaus zurück, die Lumpensammler durften wieder handeln, die Brauereien und Brennereien wurden nicht ferner beeinträchtigt, die Krugwirte durften wieder unbehelligt schenken, der Kostenanschlag für ein eventuelles Hospital, der sich auf 2400 Mark belief, wurde zu den Akten gelegt, Charlottenburg unweit Hohenaspe nicht ferner als Lazarett in Aussicht genommen, Rekonvalescentenhäuser wurden nicht mehr angeboten, die Präservativmittel wurden beiseite geworfen, die Auslegung eines eignen Kirchhofs für solche, die an Cholera gestorben, war hinfällig, an regelmäßige Reinigung und Lüftung wurde nicht mehr gedacht, und alles atmete auf und schlief beruhigt ein.
Plan hat in der Folgezeit, soweit bekannt, Gesundheitskommissionssitzungen im Kirchspiel Hohenaspe nicht wieder organisiert. Sporadisch im Kirchspiel ausgetretene schwarze Pocken, welche eingeschleppt worden. Nervenfieber und andere Seuchen wichen stets allmählich vor der Kunst erfahrener Aerzte und dank der gesunden Gegend, wie auch unter Beihülfe polizeilicher Maßnahmen, bösartige andere Epidemien, welche Opfer aus Opfer gefordert, sind nicht nachzuweisen. Die neuerdings in Hamburg namentlich furchtbar aufgetretene Cholera blieb, ohne daß besondere Vorsichtsmaßregeln beobachtet wurden, den Kirchspielsgrenzen, Gottlob, sehr fern, auch trat die allbekannte Influenza meist, selbst bei älteren Leuten, nicht totbringend auf.
XXXXII. Entsetzliche Thaten im Jahre 1843.
Kein einziges Jahr freilich ist vergangen, ohne daß im Kirchspiel Hohenaspe entsetzliche Uebertretungen des heiligen
göttlichen Gesetzes in dieser oder jener Weise vorgekommen, kein einziges zwar, in welchem nicht insbesondere Vergehen so oder anders wider das Gebot: „Du sollst nicht töten“ öffentlich oder im Geheimen stattgefunden.
Und doch muß ein Jahr besonders heraus gehoben und entsetzlicher Thaten eines Jahres vor allen Erwähnung geschehen.
Unterm 10. und 14. Dezember 1843 ist ins Toten- und Beerdigungsregister eingetragen: „Elsabe und Catharina Egge, eheliche Töchter des Drager Häuerinsten Peter Friedrich Egge in Hohenaspe, und der Elsabe geb. Claus Struck, jene 3 1/2, diese 1 3/4 Jahre alt, in einem wahrscheinlichen Anfalle von Wahnsinn von ihrem eigenen Vater, der seit dieser schrecklichen That nicht gesehen worden, in einen Koffer eingeschlossen, worin sie erstickten.“ Und unterm 10. Dezember 1843 und 3. April 1844: „Peter Friedrich Egge, Drager Häuerinste in Hohenaspe, ein ehelicher Sohn des weiland Peter Egge, Häuerinsten in Münsterdorf und der Anna Christine geb. Pietsch. Er hinterläßt als Witwe Elsabe geb. Claus Struck mit einem Kinde, namens Anna Christine. Sein Alter 38 Jahre. Nachdem er seine beiden Kinder ums Leben gebracht hatte, ertränkte er sich selber in einer Mergelgrube. Erlaubnis zur Beerdigung dd. Hohenaspe, April 2. 1844. Jürgens.“
Wie es gekommen, daß nicht auch das dritte Kind, Anna Christine (geb. den 2. September 1837, bei dem Tode ihrer Mutter, den 30. Juli 1866, noch ledig, verheiratet gewesen mit Thede am Egstedter Damm, jetzt wohnhaft in Kaaks), dem Wahnsinn des Vaters zum Opfer gefallen? Obwohl auch, wie ihre Geschwister, in den Koffer eingeschlossen, konnte sie doch durchs Schlüsselloch ein wenig Lebensluft einatmen, so daß sie, als die That entdeckt wurde, noch nicht völlig erstickt war und nach ihrer Mutter rufen konnte.
Nach dem Kopulationsregister ist die Witwe Elsabe Egge, welche Hebamme war, unterm 22. Dezember 1845 aufs neue in die Ehe getreten mit dem Drager Kätner und Zimmermann Hans Rehder in Hohenaspe, welcher am 13. Dezember 1860 gestorben, nachdem aus seiner Ehe 6 Kinder hervorgegangen, Hans, geb. 22. Oktober 1846, Elsabe, geb. 21.
Mai 1847, Claus, geb. 31. Mai 1849, Johann, geb. 6. Oktober 1852, und die Zwillinge Marcus und Catharina Louise, geb. 2. November 1854, davon nur Elsabe noch jetzt als Ehefrau des Michael Harders (cop. 7. Mai 1871) im Kirchspiel, und zwar in Ottenbüttel, wohnt.
XXXXIII. Die Hohenasper Kirchenglocke und das Jahr 1848.
Das Jahr 1846, welches hin und her im Lande neben gesundem Patriotismus auch manche nach Patriotismus aussehende ungesunde Ideen zutage forderte, erzeugte auch im Kirchspiel Hohenaspe, namentlich im Kirchdorf, aus Drage und in Looft, einen gar eigenartigen Plan.
Von den beiden Kirchenglocken, deren eine noch die Jahreszahl 1744 und die Namen J. H. Armowitz, Husum, mit Münzen tragt, war die zweite schon vor 1829*) gesprungen.
„Wie, wenn wir nun die alte Glocke nach Rendsburg senden, damit aus ihr eine Kanone gegossen werde? Man hat ja schon in den Blättern um Glockenmetall zu diesem Zweck gebeten“, so hieß es plötzlich in Hohenaspe Anfang April genannten Jahres 1848.
Man wandte unterm 3. April d. Js. sich aus Kirchenkollegium. Dies meinte den Plan erst dem hohen Patronat und Kirchenvisitatorium vortragen zu müssen. Das Patronat, an das man infolgedessen sich zunächst gewandt, belobte Hohenaspe zwar wegen seines Patriotismus, gab aber zu bedenken, daß die Genehmigung weder ihm noch dem Kirchenvisitatorium zustehe, vielmehr von der Regierung erteilt werden müsse, und daß zudem sehr zweifelhaft sei, ob die Glocke überhaupt zum Kanonenguß verwendbar sei.
Was nun? Mit einer Vorfrage sich an die Regierung wenden?
Nach längerer erregter Debatte in der Dorfsversammlung entscheidet die Majorität sich nicht für Sendung eines
*) Angeblich beim Läuten für den verstorbenen Pastor Hennings schon.
Expreßboten nach Rendsburg mit brieflicher Vorfrage, vielmehr für das vorläufige Verbleiben der Glocken an Ort und Stelle.
Die Sache aber ist dadurch keineswegs abgethan. Die Minorität tritt mit ber Dorfsgemeinde Looft ins Mittel, und mit Majorität wird die Vorfrage beschlossen. Auf alle Fälle muß auch schon die Glocke herunter und verladen werden.
Inzwischen aber ist auch eine bezügliche Vorfrage von anderer Seite ans Kirchenvisitatorium gerichtet worden. Der Kammerherr von Kardorf spricht in dem sofort erteilten Antwortschreiben sich zweifelnd aus, daß es noch früh genug sei, die Glocke umzuschmelzen, sowie daß aus der Glocke eine Kanone gegossen werden könne, Propst Wolf, früher Pastor in Hohenaspe, erklärt unumwunden, es sei die Genehmigung völlig ausgeschlossen, weil der ganze Plan verordnungswidrig sei. Könne man sich damit nicht zufrieden geben, dann möge man sich an die provisorische Regierung wenden.
Das Wort des alten Pastors wirkt endlich wie ein kaltes Bad. Mit 36 Stimmen wird der Verbleib der Glocke an Ort und Stelle beschlossen, und die Minorität, nachdem sie ihren Rausch einstweilen ausgeschlafen, besinnt ernüchtert ebenfalls sich eines Besseren.
XXXXIV. Der Glockenumguß und die Kirchenuhr.
Noch mehr als 30 Jahre vergingen nach der Verurteilung der gesprungenen Kirchenglocke zum Kanonenguß, bis statt dessen zum Umguß der alten Glocke in eine neue geschritten wurde.
Vorerst nämlich spielte noch eine lange Rolle die Anlage einer Kirchenuhr.
Schon vor dem Ausbruch des Krieges im Jahre 1846 hatte der Kirchenvorstand über die Anbringung einer solchen am alten turmlosen und nur mit einem Glockenhaus versehenen Gotteshaus verhandelt. Bereits unterm 10. März d. Js. war beschlossen worden, dein Uhrmacher Oppermann in Wilster die Anfertigung unter folgenden Bedingungen zu überlassen: „Derselbe liefert eine hellklingende Glocke zu 100
Pfund Schwere mit dem Uhrwerk, das messingne Räder haben muß und 30 Stunden geht, auch volle und halbe Stunde anzeigt, zu den: Preis von 650 Mark cour. Auf ein nicht wohl anzubringendes Zifferblatt wird verzichtet. Vor Beginn der Arbeit hat Lieferant eine Beschreibung der anzufertigenden Uhr und Glocke mit Kostenanschlag auszufertigen, bannt dem Patronat die bezügliche Vorlage zur Genehmigung eingereicht werden kann. Lieferant übernimmt womöglich für den nämlichen Preis, die Uhr mit einem Kasten und Gehäuse zu versehen, und die Glocke oben auf der Kirche unter einem kleinen hölzernen Dache zu befestigen, damit der Schall sich möglichst weit fortpflanze. Auch hat er das Ganze von einem Sachverständigen auf- und annehmen zu lassen.“
Die Kriegsjahre aber sistierten diesen Plan. Erst 1852 wurde aufs neue vorgegangen, indem das Kirchenkollegium unterm 31. August beschloß, eine bei dem Kalkbrenner Mohr in Itzehoe für 170 Mark cour. zu kaufende Glocke für die anzuschaffende Kirchenuhr zu erwerben, falls sie von zwei der Kirchenjuraten für gut befanden werde, und die Anfertigung der Kirchenuhr öffentlich zu verlicitieren, falls der Magistrat in Wüster nicht feine Turmuhr auf dem alten Rathaus zu verkaufen bereit sei, beziehungsweise diese Turmuhr nicht von einem Sachverständigen für gut erklärt werde, wie auch dem Uhrmacher Dammann in Münsterdorf aufzugeben, Riß und Anschlag zu einer einfachen, die Zeit richtig anzeigenden Kirchenuhr anzufertigen, und von einem Zimmermann untersuchen zu lassen, ob ein Häuschen für Glocke und Zifferblatt leichter oben auf dem Dach oder auf der Seite des Dachs der Kirche anzubringen sei.
Auch jetzt indes stieß man auf Hindernisse.
Ein halbes Jahr fast war vergangen, da beschloß das Kirchenkollegium unterm 29. Januar 1853 den Uhrmacher Eggers in Itzehoe nach Wilster zu senden, um über die Uhr am dortigen alten Rathaus sein Urteil abzugeben. Die Folge war, daß, da diesem die erwähnte Uhr als nicht passend erscheinen konnte, er sich erbot, der Kirche zu Hohenaspe eine neue Uhr für 600 Mark cour. zu liefern.
So beschloß denn endlich das Kirchenkollegium am 12. März 1853, beim Patronat zu beantragen, daß dasselbe die
Anschaffung einer neuen, vom Uhrmacher Eggers in Itzehoe außer Gehäuse und Dach für die Glocke auf 600 Mark cour. veranschlagten Kirchenuhr genehmigen möge, und gleichzeitig zur Deckung der Kosten pro 1853 an Kirchengeld 6 Mark cour. á Hufe zu sammeln.
Nur die Ziffernblattsfrage machte noch einige Schwierigkeit, bis schließlich nach Fertigstellung der Uhr durch den Uhrmacher Eggers und Anfertigung des Uhrgehäuses durch Hans Rheder in Hohenaspe des Gutsinspektors Grafen Schulin Ansicht sich Geltung verschaffte, es müsse bei einem Zifferblatt nach Norden bleiben, wenn nicht auch eins nach Süden angebracht werden könne, nach Westen eins anzubringen, sei nicht angänglich, da dasselbe kleiner werden müsse und dies der Symmetrie zuwider sei, und im Sommer 1854 gelangte die Kirchenuhr zur Aufstellung.*)
Doch mit der geplanten Uhrglocke kam man nicht zum Ziel.
Im folgenden Jahre 1855 wurde, weil man davon abgesehen und eine Leitung vom Uhrwerk nach dem Glockenhaus in Aussicht genommen, darum endlich der Umguß der gesprungenen Kirchenglocke beschlossen.
Aufs neue mußte indes, weil eine gründliche Reparatur des sehr schadhaft gewordenen Kirchendachs, welches den Regen so sehr durchließ, daß das Gewölbe und der Kirchenboden erheblich gelitten, noch dringender notwendig erschien, einstweilen die Ausführung verschoben werden.
Erst im Jahre 1879 wurde schließlich unterm 17. Mai der definitive Beschluß gefaßt, den Umguß der mehr als 50 Jahre klanglos gewesenen alten Dienerin am Gotteshaus dem Glockengießer Ulrich aus Laucha, der sich persönlich eingefunden hatte, zu übergeben.
Die unter Mitverwendung der erworbenen Uhrglocke umgegossene, nunmehr mit der Jahreszahl 1879 und dem
*) Laut Kontrakt dd. Hohenaspe, den 10. Dezember 1857, und Itzehoe, den 14. Dezember 1857 ist der Uhrmacher Eggers in Itzehoe verpflichtet, sofort, wenn ihm Anzeige gemacht wird, daß die Kirchenuhr nicht in gehörigem Stande ist, nach Hohenaspe zu kommen und den Schaden zu bessern, dagegen die Hohenasper Kirchenkasse ihm für die Instandhaltung jährlich 3 Thaler 19 Schilling R. M. zu zahlen.
Namen des erwähnten Glockengießers versehene Glocke durfte freilich samt ihrer älteren Schwester fortan nur einer sehr beschränkten Redefreiheit sich erfreuen. Denn beide vortrefflichen bronzenen Glocken, von denen die östliche jetzt als Uhrglocke dient, beliebte man sofort ans traurige Böternsche Läutsystem zu fesseln, das einen Zweiklang abgiebt, der für musikalische Ohren kaum zu ertragen ist.
Wann werden die Fesseln brechen und die beiden erznen Schwestern im Einklang mit einer dritten frei ihre Stimmen weithin erschallen lassen zu des Allerhöchsten Ehre? — Die gefahrbringende Aufhängung der Löte des Uhrwerks, über welche man lange hinweggesehen, ist vor kurzem vollständig durch eine einfache Aenderung und Anbringung eines starken Drahtseils vom Uhrmacher Eggers junior in Itzehoe beseitigt worden.
XXXXV. Die Herzogliche Zeit 1863 bis 1864.
Daß in der dem Tode Königs Friedrich VII. folgenden herzoglichen Zeit auch Hohenaspe an den Huldigungen, welche dem Herzog Friedrich weit und breit dargebracht wurden, den wärmsten Anteil nahm, versteht sich von selbst. Nicht nur, daß man in Itzehoe nicht fehlte, man reiste auch in Masse zu den großen Versammlungen in Elmshorn und auf dem Paradeplatz in Rendsburg und hörte mit Begeisterung die Reden alle, die dort gehalten wurden. Und mehr.
Als Herzog Friedrich die Grenze Hohenaspes passierte, war man massenweise, beritten, in Kaaksburg bereit, ihn zu empfangen, und wurde vom Organisten Jöhnke*) hier eine begeisterte Ansprache gehalten.
XXXXVI. Die Gedenktafeln in der Kirche zu Hohenaspe und ein Inhaber des eisernen Kreuzes.
Im Jahre 1865 sowohl wie anno 1872 wurden den wackeren Söhnen des Kirchspiels, welche Blut und Leben
*) Der mit Dänemark sympathisierende Nordschleswiger Pastor With beteiligte sich nicht.
fürs Vaterland geopfert, schlichte, aber sehr würdige Gedenktafeln im Hohenasper Gotteshaus gesetzt und beziehungsweise von den Pastoren With und Hamann vor versammelter Gemeinde feierlich geweiht.
Angeblich beide vom Marmorfabrikanten und Steinmetz Kolbe in Itzehoe in gleichem Stil geschmackvoll ausgeführt, zieren dieselben die Südwand der Kirche. Verzeichnet steht in Goldschrift
auf der ersten: „Gedenktafel, denjenigen zum Gedächtnis gesetzt, die in den Kriegsjahren von 1848—50 ein Opfer fürs Vaterland geworden, T. Behrens aus Looft, gef. bei Kolding den 26. April 1849, J. Eicke aus Hohenaspe, gef. bei Friedrichstadt den 6. Oct. 1850, J. Lohse aus Kaaks, gest. in Schleswig den 5. Aug. 1650, Cl. Meincke aus Hohenaspe, gest. in Kiel den 9. Nov. 1850, Cl. Wohlers aus Hohenaspe, gest. in Flensburg den 22. Juni 1848, M. Kröger aus Hohenaspe, gest. in Rendsburg den 25. Sept. 1850, J. Schröder aus Kaaksburg, gest. in Glückstadt den 20. Juni 1849. Die Gemeinde Hohenaspe den 25. Juli 1865,“
auf der zweiten: „Gedenktafel, denjenigen zum Gedächtnis gesetzt, die im heiligen Kampfe gegen Frankreich in den Jahren 1870 und 71 aus dieser Gemeinde ein Opfer fürs theure deutsche Vaterland geworden, Fr. Wilh. Kock aus Looft, gef. bei Mars la tour, den 16. Aug. 1870, Claus Rohse aus Hohenaspe, verw. bei Gravelotte, gest. in Bouconrt den
8. Sept. 1870, J. Friedr. Ohle aus Hohenaspe, gef. bei Gravelotte den 16. Aug. 1870, Joh. Hinrich Kracht aus Looft, verw. in Le Mans, gest. in Champagne den 15. Jan. 1871, Hinr. Struck aus Drage, verw. bei Sedan, seitdem vermißt. Den Lebenden zur Erinnerung, den Gefallenen zur Ehre. Geweiht den 18. Aug. 1872.“
Am Leben noch heute, trotzdem auch er, wie seine gefallenen Kampfgenossen, alles eingesetzt fürs teure Vaterland, ist der Landmann Hinrich Horst in Hohenaspe, der sich das eiserne Kreuz errungen.
XXXXVII. Das Kaisermanöver 1M1.
Am 8. Mai 1882 wurde auf Anregung des Barons von Meurer zu Krummendiek eine Anhöhe südlich von Olden-
dorf, Kirchspiel Heiligenstedten, aus welcher vor Jahren 12 Grabhügel, „die zwölf Berge“. der vorragten, und die, seitdem Seine Majestät Kaiser Wilhelm I. hier während des Manövers seinen Standpunkt gehabt, mit Allerhöchster Genehmigung den Namen „Kaiserberg“ führt, mit einem Denkmal aus Granit versehn, das die Anschrift trägt: „Zur Erinnerung an die Anwesenheit Sr. Majestät, unseres Kaisers und Königs Wilhelm I. bei dem Manöver des IX. Armeekorps im Herbste 1881.“ Nicht weit davon liegt Edendorf in südöstlicher Richtung. ebenfalls zu Heiligenstedten gehörig, wo bei (Gelegenheit des erwähnten Manövers unser jetziger Kaiser, Seine Majestät Wilhelm II. als Prinz von seinem Großvater öffentlich zum Major ernannt wurde?)
Auch, für das Kirchspiel Hohenaspe war das „Kaisermanöver im Herbste 1881″ von hoher Bedeutung. Denn nicht nur daß Truppenzüge das Kirchdorf passierten und westlich von der das Kirchspiel durchziehenden Chaussee von Itzehoe nach Hanerau das Manöver zum Teil sich entfaltete, es hatten die Dörfer Eversdorf und Kaaks auch die unvergeßliche Ehre, Seine Majestät Kaiser Wilhelm I. sowohl, wie den derzeitigen Kronprinzen, späteren Kaiser Friedrich nebst Gemahlin, und den derzeitigen Prinzen, jetzigen Kaiser Wilhelm II., in ihrer Mitte begrüßen und aufs herzlichste willkommen heißen zu dürfen. Mögen es die Eltern den Kindern erzählen wieder und wieder, möge es gehen von Mund zu Mund und von Herzen zu Herzen: „Hier war’s, hier sahen wir sie, den Großvater, den Sohn, den Enkel, hier jauchzten wir ihnen entgegen, nicht ahnend, daß schon so bald der Sohn dem Greise werde folgen in die Gruft, daß schon sobald der Enkel den erhabenen Thron seiner Väter besteigen werde als „unser Allergnädigster Kaiser“; hier fiel auch unser Blick auf den greisen Feldmarschall Grafen von Moltke, und wie viele Generäle und hohe Militärs erblickten wir noch mehr!“
XXXXVIII. Ber Bau der neuen Orgel und die Renovierung des Orgelchors.
Daß 1884 die Kirche zu Hohenaspe an Stelle der
*) Siehe H. H. von Ostens Beschreibung der Kreise Steinburg und Pinneberg. Seite 4.
allen eine neue Orgel erhalten, wurde früher schon*) erwähnt.
Die Disposition und der Kostenanschlag zu derselben wurden von der Firma Marcussen und Sohn in Apenrade bereits unterm 8. August 1861 geliefert. Empfohlen wurde eine Orgel von 11 Stimmen mit 2 Manualen**) und obligatem Pedal, und waren die Kosten des Baus derselben, einschließlich der Ausstellung des Werks in der Kirche, der Intonation und Stimmung, des Logis und der Diäten, auf 6783 Mark berechnet.
Unterm 19. Mai 1882 wurde zu Hohenaspe, unterm 24. Mai d. Js. zu Apenrade, der bezügl. Kontrakt mit den Namen der Mitglieder des derzeitigen Kirchenvorstands A. Hamann, H. Voß, C. Gloyer, E. Ehlers, R. Offe und der Firma Marcussen und Sohn unterzeichnet. Als spätester Termin für die Vollendung des Werks war darin der erste Advent 1883 bestimmt, und wurden durch den Kontrakt dem Erbauer 5783 Mark zugesichert, wovon er beim Beginn der Aufstellung 3783 Mark, nach der Abnahme durch einen kommittierten Sachkundigen aber den Rest mit 2000 Mark erhalten sollte. Auf fünf Jahre war von der Firma für die Güte des Materials und der Arbeit die Garantie übernommen.
Die zur Aufstellung des kontraktgemäß ausgeführten Orgelwerks erforderliche Renovierung des Orgelchors beschaffte der Zimmermeister J. H. Brandt aus Looft und erhielt derselbe die Anschlagssumme, 241,50 Mark.
Natürlich konnte die Abnahme der vortrefflich gelieferten Orgel und die Weihe derselben, da die Aufstellung, Intonation und Stimmung längere Zeit erforderte, erst im Jahre 1864 geschehen.
*) Siehe oben
**) Orgelkenner mögen das Genauere an Ort und Stelle selber einsehen; es wird ihnen auch die betr. „Disposition“, wie sie im Archiv vorliegt, sehr gerne unterbreitet.
XXXXIX. Die Erweiterung des Kirchhofs und die Kirchhofsregulierung und die neuen Kirchhofsregister.
Nachdem bereits in den Jahren 1869 und 1870 unter der Amtswirksamkeit des Pastors adj. Fietense zu einer Erweiterung des nach dem Regulativ vom 3. September 1840 nur 225 [] Ruthen großen und entschieden den Verhältnissen nicht entsprechenden Kirchhofs um ca. 80 [] Ruthen im Süden und Osten angrenzenden Kommünenlandes die erforderlichen Schritte gethan worden und besonders im letzten Jahrzehnt der zwanzigjährigen Amtsführung des Pastors Hamann und so lange der jetzige Totengräber Peter Otte in Thätigkeit ist, die würdige Ausstattung des Kirchhofs mit Denkmälern, Eisengittern, Sträuchern:, Blumen und frischen Kränzen, wie auch die Instandhaltung der Kirchhofssteige, sehr wesentlichen Aufschwung genommen, ist 1893 und 1894 die Feststellung der Besitzverhältnisse aus dem alten und neuen Kirchhof, welche lange Jahre ungeordnet gelegen, mit möglichster Genauigkeit erfolgt, und in Gemäßheit der im „Kirchl. Gesetz- und Verordnungs-Blatt 1887″ Stück 11 erlassenen Konsistorialverfügungen sowohl ein neues chronologisches Beerdigungsregister als auch ein neues topographisches Grabregister mit orientierender Kirchhofskarte angelegt worden, und wird hinfort alljährliche Regulierung in Gemäßheit des Kirchhofsregulativs von 1840, beziehungsweise Ab- und Zuschreibung und Ordnung der mit Namen und Nummer zu versehenden Begräbnisse, stattfinden.
L. Die Ablösung der Reallasten.
In den Jahren 1875 bis 1883 kam der weitaus größte Teil der Reallasten betr. die Kirche, das Pastorat und das Küsterat in Hohenaspe zur Ablösung. Es bestehen gegenwärtig nur noch für die Kirche eine Roggenliefernng von Winckler-Drage (6 Scheffel*), eine do. von Hohenwestedt
*) Siehe oben.
(2 Ton. 2 Sch.) und eine längst schon vereinbarte Abfindungssumme für eine frühere Haferlieferung ans der Wilstermarsch, für das Pastorat eine Roggenlieferung vom Stammhof-Drage (1 Ton. 6 Sch. 15 5/8 Sechsz. Sch.*), eine do. von Hohenwestedt (5 Ton. 3 Himpten), eine do. von Krummendiek (5 Ton. 3 Himpten), zwei do. von Hohenaspe (1 14/16 Ton. und 5 Himpten), und für das Küsterat eine Roggenlieferung von Winkler-Drage (5 Scheffel 8 Sechz. Sch.**) und außerdem für das Pastorat und die Kirche geringfügige Grundhäuer und für ersteres noch kaum 20 Mark sog. Lanzen- (Lansten-) Gelder. Alles übrige steht auf Rentenbriefen, wenn nicht bereits nach Auslosung auf Zinsen bei Sparkassen. Die Rentengelder werden dem Pastor und Organisten 1. April und 1. Oktober ausgezahlt.
LI. Der 12. Februar und der weitere Verlauf des Jahres
Am 12. Februar. 1894 raste über Norddeutschland, über Schleswig-Holstein und auch das Kirchspiel Hohenaspe ein furchtbarer Orkan dahin, wie ein solcher seit Menschengedenken nicht durchlebt worden.***) In den Gehegen des Fiskus (Lohfiert, Tannenkoppel, Tiergarten, Halloh pp.), wie in den Privathölzungen war der durch denselben angerichtete Schaden enorm. Besonders wurden die Tannenbestände geschädigt. Einen traurigen Anblick gewährten die massenhaft übereinander gestürzten Bäume, zum Teil mit haushoher Erdrinde emporgehoben. In dem benachbarten Itzehoe war Feuersbrunst durch Blitzschlag veranlaßt. In großer Anzahl wurden die Häuser abgedeckt, gleichviel ob sie mit Ziegeln oder Stroh gedeckt waren. Das Rauschen der Bäume ringsumher, das Heulen des Sturmes war grausig. Auch das Kirchendach wurde erheblich geschädigt, und das Pastorat war in der größten Gefahr, durch eine im Nordwesten unmittelbar
*) Siehe oben.
**) Siehe oben.
***) Im Jahre 1648 den 17. Februar neigte bei ähnlichem Unwetter der mehrere Schritte von der Kirche entfernte Holzturm sich gegen die Kirchenmauer. Siehe Joh. Rists „Holstein, vergiß es nicht“.
angrenzende gewaltige Linde, welche dem enormen Anprall nicht zu widerstehen vermochte, vielmehr jeden Augenblick zu stürzen drohte, wenigstens an der Frontseite völlig zerschlagen zu werden. Als die Gefahr am größten, war, Gott sei Lob und Dank, die Hülfe Gottes am nächsten; als schon der ganze Boden um den Baum, wie bei einem Erdbeben, sich emporhob, legte plötzlich sich der rasende Sturm, und konnte allmählich, freilich nur von den kopffestesten und mutigsten Holzfällern, der riesige Baum gekappt werden, um nach einigen Tagen vollständig zu verschwinden.*) In der Nähe der Oberförsterei hatten eben noch des Weges kommende Fußgänger eine Weile unter einer mächtigen Aspe Atem zu holen versucht, als mit furchtbarem Krachen sie brach und niedersank. Gott sei Dank, auch da war die wundersame Hilfe des Allmächtigen gar deutlich ersichtlich.
Welch ein gesegnetes Frühjahr, das sofort dem entsetzlichen Aufruhr der Natur folgte, sobald der Herr das Ungestüm bedroht und das kurze Wort gesprochen: Bis hierher und nicht weiter! In Garten, Flur und Wald welche Ueppigkeit, welche Pracht im wonnigen Mai! Zwar forderte Frost und Ungestüm seinen Zehnten reichlich von dem unverdienten reichen Segen, doch durften wir jauchzen trotzdem am Erntefeste: „Der Herr hat Alles wohlgemacht; ihm sei Lob, Preis und Ehre!“
LII. Chausseebau und Eisenbahnprojekte.
Nachdem seit langer Zeit schon als durchaus notwendig angesehen worden, daß die zu Zeiten fast unpassierbare Post
*) Er stammte, wie noch ein gut Teil der Bäume um den Hofraum und Garten und wie die prächtige, fast den ganzen Garten umsäumende Allee, von zum Teil fußdicken Hainbuchen, aus der Zeit des Pastors Langheim, der in das Kircheninventar von 1752 (Siehe oben) die Bestimmung aufnehmen ließ: „Die beiden Gärten (Blumen- und Küchen- oder Kohlgarten) sind auf eigene Kosten des p.t. Pastoris Langheim angelegt, und werden dem alten Herkommen nach die darin befindlichen Sachen, an Gebäuden, Bäumen, Blumen, Hecken und dergleichen von dem Succesore wieder an ihn oder seine Erben bezahlt, oder es stehet ihm auch frei, alles wegzubrechen und wegzunehmen, mithin alles seiner besten Gelegenheit nach zu Gelde zu machen u.s.w.
straße über Burendal an die Itzehoe-Hanerauer Chaussee chauffiert werde, ist endlich vor kurzem der Chausseebau kräftig in Angriff genommen worden. Die Gemeinde Hohenaspe ist Bauunternehmerin, und werden die Kosten zum großen Teil aus der Kreiskasse bestritten. Voraussichtlich wird der Bau vor dem Beginn des Frühjahrs 1895 vollendet sein. Wird dann auch eine Chaussee nach Drage und Looft folgen?
Mit der Ausführung verschiedentlich aufgetauchter Eisenbahnprojekte, welche sämtlich Itzehoe und Rendsburg durch eine Bahnlinie über Hohenaspe, Drage und Schenefeld mit einander verbinden wollen, ist es bis dahin nichts gewesen, und wird sicherlich noch Jahr und Tag vergehen, bis eine Eisenbahn mit Hilfe des Staats zustande kommt. Edendorf wird bis weiter Hohenaspes nächste Bahnstation bleiben, und die Königliche Forstkasse wird bis weiter jährlich über zu niedrige Holzpreise zu klagen haben.
LIII. Kirchliche Zahlen.
In den Jahren 1892, l893 und 1894 bis Advent ergaben sich in dem 1613*) Seelen zählenden Kirchspiel folgende kirchliche Zahlen:
Getauft 1892: 52, 26 männlich, 26 weiblich, darunter 1 Zwillingstochter; 1893: 53, 27 männlich, 26 weiblich, darunter 1 Zwillingssohn und 3 Zwillingstöchter; 1894: 44, 22 männlich, 22 weiblich, darunter 2 Zwillingstöchter;
Getauft 1892: 1 unehelich; 1893: 6 unehelich (!!!); 1894: 3 unehelich.
Beerdigt 1892: 37, 17 männlich, 20 weiblich, 3 männlich und 1 weiblich zwischen 80 und 90, 2 männlich und 2 weiblich zwischen 70 und 80, 2 männlich und 4 weiblich zwischen 60 und 70, 2 weiblich zwischen 50 und 60, 3 weiblich zwischen 40 und 50, 1 weiblich zwischen 30 und 40, 1 männlich und 2 weiblich
*1 Der Erwähnung wert ist, daß sich unter den viel und weit gereisten Leuten des Kirchspiels auch ein schlichter Böttcher findet, Joh. Dölling in Hohenaspe, der Grönland sah, und ein früherer Seemann, Johann Hilbert aus Drage
zwischen 20 und 30, 2 männlich und 2 weiblich zwischen 10 und 20, 3 männlich zwischen 1 und 5 Jahren, 1 weiblich zwischen 1/2 und 1 Jahr, 2 männlich und 1 weiblich zwischen 1 und 2 Monat, 1 männlich unter 1/2 Monat, 1 männlich und 1 weiblich totgeboren.
Beerdigt 1893: 27, 16 männlich, 11 weiblich, 2 männlich und zwei weiblich zwischen 80 und 90, 2 männlich und 2 weiblich zwischen 70 und 80, 4 männlich zwischen 60 und 70, 1 männlich zwischen 50 und 60, 1 weiblich zwischen 20 und 30, 1 männlich zwischen 11 und 20, 1 männlich zwischen 10 und 11, 1 männlich und 2 weiblich zwischen 5 und 10, 1 männlich und 1 weiblich zwischen 1 und 5 Jahren, 2 weiblich zwischen 6 und 6 Monaten, 1 weiblich zwischen 4 und 5 Monaten, 1 männlich mit 2 Monaten, 1 männlich totgeboren.
Beerdigt 1894: 22, 11 männlich, 11 weiblich, darunter 1 weiblich zwischen 80 und 90, 6 männlich und 1 weiblich zwischen 70 und 80, 1 männlich und 1 weiblich zwischen 60 und 70, 1 männlich und 1 weiblich zwischen 50 und 60, 1 männlich und 1 weiblich zwischen 40 und 50, 1 weiblich zwischen 10 und 15, I weiblich zwischen 1 und 5, 1 männlich und 2 weiblich zwischen 1 und 3 Monaten, 1 weiblich zwischen 1 und 5 Tagen, 1 männlich und 1 weiblich zwischen 4 Stunden und 1 Tage.
Getraut 1892: 11, 1893: 18, 1894: 19.
Mischehen 1892: keine, 1893: keine, 1894: keine.
Konfirmiert 1892: 37, 16 männlich und 21 weiblich, 1893: 35, 23 männlich und 12 weiblich, 1894: 34, 15 männlich und 19 weiblich.
Abendmahlsgäste 1892:*) 360 öffentlich, 24 privat, 1893: 658 öffentlich, 14 privat, 1894: 644 öffentlich, 20 privat.
*) 1892 war zur Hälfte Adjunktur-, zur anderen Hälfte Vikariatsjahr.
Abendmahlsgäste 1893: 347 männlich, 325 weiblich, 1894: 333 männlich, 331 weiblich.
LIV. Das Kirchensiegel.
Das amtliche Kirchensiegel des Pastors zu Hohenaspe, welches in duplo vorhanden ist, hat unter der Umschrift. „Hohenasper Kirchensiegel“ das Kreuz, den ans der Bibel stehenden Kelch und den Anker. Ans welcher Zeit es stammt, ist dem Verfasser zu ermitteln nicht möglich gewesen.
Möge in der Gemeinde Hohenaspe das Wort vom Kreuz nie irgend einer Seele eine Thorheit sein, nie irgend ein Sünder trotzdem verloren gehen, vielmehr dasselbe je mehr und mehr als eine Gotteskraft sich erweisen, die da selig macht alle, die daran glauben (1. Kor. 1, 18)!
Möge nie ein Glied der Gemeinde vergessen, daß man nicht kann zugleich trinken des Herrn Kelch und der Teufel Kelch, daß man nicht kann zugleich teilhaftig sein des Herrn Tisches und des Teufels Tisches (1. Kor. 10, 2l), und möge ein jedes wiederlieben den von ganzem Herzen, der uns zuerst geliebet hat (1. Joh. 4, 19), und von dem es heißt: Gott ist die Liebe (l. Joh. 4, 8)!
Möge die Gemeinde in allen ihren Gliedern zunehmen stetig in der lebendigen Hoffnung, zu der uns der Vater unseres Herrn Jesu Christi nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu der Hoffnung auf das unvergängliche und unbefleckte und unverwelkliche Erbe, das behalten wird im Himmel denen, die ans Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werden zur Seligkeit (l. Petri 3—5)!
Und möge die ganze Gemeinde nicht auswendig nur, sondern inwendig wissen und bedenken allezeit:
Wo keine Bibel ist im Haus,
Da steht es öd‘ und traurig aus;
Da mag der liebe Gott nicht sein‘,
Der böse Feind zieht da gern ein. —
Bei deiner Bibel sitze gern;
Sie ist der Weisheit Kern und Ster»‘,
Die schlage aus, die schlage du Erst mit des Sarges Deckel zu!
Den Geistlichen der Gemeinde aber mahne jedes Kirchensiegel, das er amtlich auszudrücken hat, an das köstliche Schlußwort von 1. Kor. 13: „Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei; aber die Liebe ist die Größeste unter ihnen!“
Das walte Gott in Gnaden!
LV. Die Kirchenvisitationen in den Jahren 1893 und 1894.
Am 13. August 1893 visitierte zum ersten Mal die Kirchengemeinde Hohenaspe der Nachfolger des plötzlich und unerwartet heimgegangenen Kirchenpropsten Hasselmann, der Kirchenpropst Buchholz in Itzehoe, früher in Elmshorn, am 6. Juli 1894 ebenfalls zum ersten Mal — denn 189l war wegen des letzten Leidens des am 26. November 1891 abgerufenen Pastors Hamann eine öffentliche Visitation unmöglich — der Nachfolger des in den Ruhestand getretenen Generalsuperintendenten Dr. Jensen, der Generalsuperintendent Dr. Justus Ruperti. Was fanden sie? Jesum allein?
LVI. Der neueste Kirchenschmuck.
Am Pfingstfest 1894 erhielt die Kirche zu Hohenaspe anstatt der gänzlich unbrauchbar gewordenen meisten Altardecke und anstatt der zerrissenen Kanzelbekleidung neuen würdigen Schmuck. Von rechtswegen hätte derselbe längst schon angeschafft werden sollen. Warum dem jetzigen Pastor erst, nachdem er mit dem Kirchenvorstand zuvor noch notwendigere und noch weniger aufschiebbare Renovierungen vorgenommen, das Loos der Anschaffung zugefallen, ist unverständlich. Beide, die Altardecke, wie die Kanzelbekleidung, entstammen dem Paramentenverein der Diakonissenanstalt in Flensburg. Die Spitzen um den vorzüglichen weißen Stoff sowohl, wie das von den Flensburger Schwestern eigenhändig gestickte Kreuz auf dem rottuchnen Antependium, sind vorzüglich. Herzlichen Dank den lieben Diakonissen für ihre mühevolle treffliche Arbeit. Möge sie mithelfen, daß in dem Gotteshaus auf Aspes Höhe Heller und immer Heller hervortöne der Lobgesang im höheren Chor aus tausend Herzen: „Ehre sei Gott
in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen ein Wohlgefallen!“
Wann wohl dem neusten Kirchenschmuck das „neue Gesangbuch“ und die „neue Gottesdienstordnung“ sich anreihen werden? Das „alte Gesangbuch“ ist wahrlich so unwürdig, wie die alte Kanzelbekleidung es war. Und die bisherige Liturgie, wie ist sie so dürftig! Wann wohl die Gemeinde auch im kalten Winter nicht vom Besuch des Gotteshauses sich wird zurückhalten lassen in dem Bewußtsein, daß der Eiseskälte in den hohen Räumen abgeholfen worden und man im Bethaus sitze gerade so warm wie im Stübchen daheim?
LVII. Die gegenwärtige Kirchenvertretung der Kirchengemeinde Hohenaspe.
Die Chronik darf nicht schließen, ohne die Namen der gegenwärtigen Vertretung der Kirchengemeinde Hohenaspe genannt zu haben.
Aelteste sind zur Zeit: Claus Ehlers-Ottenbüttel, auch Mitglied der Propsteisynode, Claus Gloyer-Looft, Friedrich Lembke-Hohenaspe und Hans Lahann-Kaaks,
Gemeindevertreter: Johann Voß-Looft, Claus Harders und Jürgen Ahmling-Ottenbüttel, Peter Harders-Kaaks; Christian Lipp und Hinrich Eggers-Hohenaspe, Hartwig Eggers- Kaaks, Reimer Nanz-Looft; Claus Stahl und Ernst Rohse-Hohenaspe, Johann Lohse jun.-Eversdorf und Johannes Ehlers-Drage.
Es verdient auch noch erwähnt zu werden, daß die Nettesten das Tragen des Klingelbeutels sowohl zum Besten der verschämten Armen als bei Kirchenkollekten als Ehrenamt betrachten.
Ergänzungen, Berichtigungen und Anhänge
1. Zu Kapitel I. Drage.
Nicht nur Drage an der Treene, sondern auch „Drageresthorp“, welches nach Schröders Topographie im Jahre 1136
vom Erzbischof dem Neumünsterschen Kloster geschenkt wurde, und aus dem der sogenannte kleine Flecken Neumünster oder das spätere Gut Neumünster oder Brammer bei Neumünster entstanden, ist vom dänischen „drage“, d. i. schleppen, ziehen, abzuleiten. „Dragere“ sind Schlepper, auch Löscher bei Schiffen, „Drageres“ ist der zweite Fall in der Mehrzahl. „Dargeresthorp“ heißt somit „ein Dorf, in welchem Löscher oder Schlepper wohnen“, bezw. „ein Löschort für Treckschuiten,“ und wird der Klein-Flecken dadurch als ursprünglicher Löschort für Treckschuiten auf der Schmale bezeichnet.
2. Zu Kapitel V: Der Edelhof in Ottenbüttel.
Die Söhne oder jedenfalls Erben des Ritters (miles) Ethelerus (Elerus, Etheler) de Ottenebotle, der noch in Urkunden von 1253 und 1257 namentlich sich findet, die „Fratres“ (Brüder) Hartwicus, Hasso und Nicolaus de Ottenebotle, von denen der erste bereits 1267 und noch 1287 genannt wird, waren schon gemeinsame Besitzer der Güter Krummendiek und Beckdorf, denn sie konnten nach einer Urkunde vom 3. September 1281*) gemeinsam die Kirche in „in Sconevelde“ (Schenefeld) mansum unum in Villa Ordessem et juger cum dimido apud Bike in parochia Crummendike (d. i. eine Hufe in Ohrsee und 1 1/2 Juchert Landes in Beckdorf im Kirchspiel Krummendiek) als Ersatz für das zum Kirchspiel Aspe „propter multas necessitates et pericula, quae ipsis thitmarci, cum priorem ecclesiam frequentarent, indesinenter intulerant (d. i. wegen der mancherlei Widerwärtigkeiten und Gefahren, welche ihnen die Dithmarsen, wenn sie die frühere Kirche besuchten, unaufhörlich bereitet hatten)“ gelegte Dorf Lovethe (Looft) hingeben.**) Sie nannten sich aber noch „de Ottensbotle“ (die Schreibweisen dieses Namens wechseln zwischen Ottenebotle, Ottenebutle, Ottenebotele, Ottelenbutle, Ottenbotele, Ottenbutle, Otenbutle, Otenebutle, Otenebotle, Ottenebutle, Otenebotele, Otnebutle, Otlebutle) und führten noch nicht den Namen „de Crummendyke“.
*) Herrn Pastor Schröder in Itzehoe dafür meinen besten Dank.
**) Siehe oben.
3. Zu Kapitel VI: von Cöln.
Unterm 14. März 1760 wurde vom Pröpsten J. Decker zu Itzehoe in den „Schleswig-Holsteinischen Anzeigen“ (Stück 12 Seite 189) ein das sogenannte Cöllnische Begräbnis, welches einzustürzen drohte, betreffendes Proklam erlassen. Ein darauf dem genannten Pröpsten von einem Christ. Fried. von Cölln in Sengewarden im Jeverschen übersandtes Schreiben vom 25. März 1760 besagt, daß dessen Vater, welcher Pastor in Hohenwestedt gewesen, der lebte sei, der in dem Erbbegräbnis beigesetzt worden,*) und den Sohn sehr befremde, daß die Kirchenjuraten zu Hohenaspe das ihm erb- und eigentümlich zugehörende Begräbnis, zu dessen Erhaltung seine sel. Großmutter der Kirche zu Hohenaspe die Zinsen eines Vermächtnisses von 100 Reichsthalern erforderlichenfalls überwiesen, haben verfallen lassen, auch wird darin die Forderung ausgesprochen, daß sofort „die Reparation bewerkstelligt und das Begräbnis fortan in bessere Aufsicht genommen werde.“ Ueber den weiteren Verlauf der Sache liegt nichts vor. Erwähnt sei nur noch, daß das Schreiben die Adresse trägt: „A Monsieur Monsieur Decker Prevot et Conseiller du Consistoire de Münsterdorp a Itzehoe.“
Zu Kapitel VII: Der Grafenmord.
Nach Otto Koch in den zu Hamburg 1852 erschienenen „Sagen aus Schleswig, Holstein, Lauenburg, Hamburg und Lübeck“ (Bd. I. Seite 218 ff.) ist der Gemahl der Charlotte Louise, gebornen Gräfin von Sayn-Witgenstein, Graf Wilhelm Adolf zu Rantzau, ein Mann mit buschigen schwarzen Brauen und scharfen, blitzenden, grauen Augen, ja mit lauerndem, tückischem, unheimlichem, — dämonischem Blick, von unversöhnlichem Haß gegen seinen Bruder Christian Detlef zu Rantzau
*) Zwar reicht das Hohenwestedter Totenregister nicht in die Zeit dieses Pastors zurück, doch ist ein kleines von einem Hohenwestedter Organisten ausgestelltes Verzeichnis vorhanden, welches die Notiz enthält: Friedrich von Cöln ward hier Pastor 1704, starb den 9. November l716, seines Pastoratamtes im 13. Jahre, seines Alters im 40. Jahre, und ward in seinem Erbbegräbnis zu Hohenaspe begraben.
erfüllt, der als hochmütiger harter Charakter, Despot seiner armen Bauern, grausamer Herr ohne Herz für Rot, bitteren Mangel, Sorgen und Jammer, ja als ein Mann, der seinen besten Freund mit seinen Hunden Hetzen zu lassen vermocht, geschildert wird. Ein Hauptmann Praetorius, von jenem gedungen für 25000 Thaler und 500 Thaler jährlich, vollbringt mit Hilfe eines rätselhaften Grünrocks 172l bei Barmstedt den grausigen Mord. Graf Christian Detlef verscheidet in den Armen der alten Lauscherin und Wahrsagerin Lise, seiner einstigen Amme, welche nach dem Schuß herbeigeeilt. Seine letzten Worte sind: „Ich hoffe ans Gottes Gnade; ich war ein großer Sünder, aber Gottes Gnade ist größer. Mein Bruder ist …. Ich sterbe, ich sterbe!“ Erst 1723 entdeckt Major Köhler, ein wegen schlechter Streiche aus dänischen Diensten entlassener und nach Oesterreich entwichener Offizier, den Mörder beim Würfelspiel in angetrunkenem Zustande, denunziert ihn in Kopenhagen, und auf dänische Requisition hin wird er in Krossen verhaftet. Ein Jahr lang in Kopenhagen eingekerkert gewesen, während dessen er die Verse verfaßt:
Thränen, Thränen, fließt, bis ich zerflossen bin!
Aber ach, was Helsen Thränen, wo die ganze Hölle brennt?
Nur umsonst ist alles Sehnen, da mein Fuß zum Abgrund rennt.
Tausend, abertausend Zähren und ein ganzes Thränenmeer.
Wenn sie auch von Blute wären, bringen den Verlust nicht her.
Ein Palast hat mich betrogen und ein schwaches Werkzeug macht,
Daß ich Gift in mich gesogen und den Lebensbaum veracht’t“,
wird der Mörder 1724 in Rendsburg vor der Gerichtskommission mit Graf Wilhelm Adolph konfrontiert, er gesteht alles und am 29. Juni 1725 stirbt er aus dem Neuwerker Marktplatz unterm Richtbeil wie eine Memme, während der rätselhafte Grünrock wie von der Erde hinweggeblasen ist. Graf Wilhelm Adolph dagegen, der sich sofort in Besitz der Lande und Güter seines Bruders gesetzt, in allen Kirchen Gebete für die Seele des Verstorbenen angeordnet, in tiefster Trauer unverzüglich sich nach Barmstedt begeben, um das feierlichste Leichenbegängnis zu besorgen, ja sogar in den öffentlichen Blättern einen ansehnlichen Preis für den Entdecker des Mörders ausgesetzt, wird bereits am 30. Mai 1722
von Heinrich von Ahlefeld (vielleicht aus der Haselauer Linie und ein Brudersohn der d. z. Herzogin von Glücksburg) der ein Freund des Ermordeten ist, trotz all seiner Vorsicht, List und Verschlagenheit während eines ihn fesselnden, höchst interessanten Gesprächs unvermerkt von seiner freien Reichsgrafschaft auf das angrenzende dänische Gebiet hinübergebracht; im Pinnebergischen umzingelt plötzlich ein bereit gehaltenes Kommando dänischer Dragoner seine Kutsche; gefangen wird er nach Rendsburg gebracht, der vom König von Dänemark konstituierten Gerichtskommission vorgestellt, und, nachdem er hier sofort seinen Würden entsagt und seinen Elephantenorden an Dänemark zurückgegeben, von dieser zu lebenslänglicher Hast und einer Geldstrafe von 20 000 Reichsthalern „wegen Verachtung des Elephantenordens“ verurteilt. Nach 8jähriger Gefangenschaft zu Aggershus in Norwegen beschließt er seine Tage im März 1734.
Was von dieser absichtlich erst hier in gedrängter Kürze wiedergegebenen Darstellung zu halten ist? Otto Koch und der Verleger J. F. Richter bezeichnen beide ihr Buch nur als „Sagen“, sie beanspruchen also nicht die Ehre, das über dem Morde bei Alt-Voßloch ausgebreitete Dunkel gelichtet zu haben. Aus mehr als einem Grunde vermöchten wir auch nicht dem Erzähler historische Treue zuzumessen, und schwerlich wird die Familie Rantzau ihm Dank zollen.
5. Zu Kapitel X: Pastor Eberwein.
Welch ein biederer Charakter Pastor Eberwein gewesen, beweisen mir vorliegende ausführlich nicht mittelbare Aktenstücke, in denen er seinen „sel. Vorweser Pastor Langheim“, der „im August 1757 gestorben“ gegen die „im September d. Js.“ wider ihn beim „Durchlaucht Herrn Markgrafen“ vorgebrachten weitläufigen Verleumdungen, wonach er „mit den Kirchenjuraten das nach dem Brande des Pastorats neuabgefaßte Kirchenmissal absichtlich gefälscht und auch im klebrigen Unredlichkeiten begangen,“ als gegen „unausstehliche Frechheit“ und „gährende Meuterei“ sofort nach seiner im Januar 1758 erfolgten Wahl und Einführung vor dem Münsterdorfer Konsistorium und seinem Kirchenpatron aufs
energischste mit bestem Erfolg verteidigt. De mortuis nil nisi vere, man belüge nicht die Toten noch im Grabe.
6. Die Kornlieferungen von Krummendiek, Stördorf und aus der Wilstermarsch.
Die unabgelöste Roggenlieferung des Guts Krummendiek an den Pastor zu Hohenaspe im Betrage von 4 Ton. 3 Sch. 15 3/8 Sechsz. Sch. seeländ. Maß hat darin seinen Grund, daß das adelige Marschgut „Lütken Rahde“, auf dem diese Abgabe ruht, bis 1613 der Metta von Pogwisch,*) Schwester der Margaretha von Ahlefeld und als Gemahlin Hennings von Pogwisch zu Petersdorf, Mutter Hennings von Pogwisch junior vom Edelhofe zu Ottenbüttel, gehörte, diese aber 1598 auch mit ihrer Schwester das Gut Aspe geerbt hatte. Früher schon beim Gut Krummendiek gewesen, in der Sehestede’schen Erbteilung 1596 mit diesem dem Emeke Sehestede zugefallen, von Heinrich zu Rantzau für das Gut Mehlbeck angekauft, 1613 von den Kreditoren der Metta Pogwisch an Abel Wensin verkauft, später ein Meierhof des Guts Mehlbeck, 1725 in den Besitz der Anna Catharina Poppen übergegangen und vor 1728 vom Oberstlieutenant von Hammerstein auf Krummendiek angekauft, ist Lütken Rahde**) bis heute beim Gut Krummendiek geblieben.
lieber die abgelöste Haferlieferung Stördorfs im Kirchspiel Heiligenstedten an den Pastor zu Hohenaspe im Betrage von 10 Ton. Itzehoer Maß ist nichts weiter bekannt, als daß sie auf dem Hofe Claus Dibberns am Stördeich ruhte und am Montag nach dem zweiten Advent erfolgen mußte,***) sowie daß angeblich #) „die einstige Besitzerin des Hofes totkrank gewesen, als zufällig der Hohenasper Pfarrer vorbeigekommen“ und daß angeblich „dieser ihr geistlichen Zuspruch gewährt und sie nach ihrer Wiedergesundung ihm eine Abgabe von ihrem Hose zugesichert habe.“
*) Siehe oben.
**) Vergleiche das Kircheninventar.
***) Vergleiche das Kircheninventer.
#) Vergleiche Professor Dr. Dethlefsens Geschichte der holsteinischen Elbmarschen Band I. Seite 55.
Mit der ehemaligen Haferlieferung aus der Wilstermarsch endlich hat es folgende Bewandtnis. Bestehend in 46 Ton. 3 Himpten, welche jährlich auf Maitag an die Asper Kirche zu liefern waren, bis zum Jahre 1726 von den Marschbewohnern Johann J. H. Dose, Siem Hebe, Claus Rüge, Claus Egge, Carsten Reymers, Claus Mohr, von Ahlefeldt (wegen des Herrn Obristen von Hammerstein Hof in Kuskopper Moor), Peter Meyführt, Claus Poppe, Ties Dohren, Peter Södje und Jochim Frauen (für sich und namens der nachgelassenen Kinder des Marten Poppe als Vormünder) geleistet, wurde sie in diesem Jahre „mit gnädigstem Consens und Approbation Sr. Hochfürstl. Durchl. des Herrn Markgrafen von Brandenburg-Culmbach als des hohen Kirchenpatrons“ von den d. z. Kirchenjuraten Berendt Sanftenberg, Johann Lohse, Jürgen Rademann, und Jasper Stahl gegen „eine gewisse verakkordierte Geldsumme von 24 Schilling lübisch für jede Tonne“, d. i. gegen eine Summe von 70 Mark 2 Schilling oder 84 Mark 15 Pfennig, welche „Philippi-Jacobi-Tag zwischen 10 und 6 Uhr nachmittags in der Stadt Wilster in Jacob Frauen’s Hause in der Ziegelstraße an die p. t,. Kirchenjuraten der Asper Kirche alljährlich und zwar zu ewigen Zeiten, von Nachkommen zu Nachkommen, zu bezahlen war,“ abgelöst, im Jahre 1736 von Claus Mohr mit 16 Mark 5 Schilling 8 Dreiling, Carsten Reymers mit 5 Mark l Schilling, Marx Bremer mit 5 Mark l Schilling, Peter Schmalmack mit 8 Mark 13 Schilling, Claus Poppe mit 2 Mark 7 Schilling, Timm Schippmann mit 2 Mark 9 Schilling 3 Dreiling, Peter Meyführt mit 8 Mark
4 Schilling, Carsten Kruse mit 4 Mark 14 Schilling, Claus Egge mit 8 Mark 4 Schilling, Peter Södge mit 12 Schilling, Johann Rickers mit 3 Mark 15 Schilling und Siem Nebbe mit 3 Mark 12 Schilling, zusammen mit 70 Mark 2 Schilling, bezahlt*) und im Jahre 1893 gleicherweise am 1. Mai (muß spätere nicht nachweisbare Uebereinkunft sein) geleistet von: Heinrich Mohr-Howe, Jasper Hein-Howe, Hinrich Suhl- Kuskoppermoor, Hinrich Boll-Kuskoppermoor, Johann Thumann-Rumfleth, Nicolaus Karstens-Hakeboe, Hinrich Egge-
*) Vergleiche das Kircheninventar.
Hakeboe, Hinrich Göttsche-Hakeboe, Johann Gribb-Hakeboe, Peter Brandt-Hakeboe, Johann Egge-Hakeboe.
Der Ursprung dieses Taxthafers, von dem Professor Dr. Dethlefsen*) etwas, aber nicht viel weiß, nämlich nur, was er von dein Hofbesitzer Schröder in Rumfleth erfahren, wird nicht viel dadurch anfgehellt, daß**) „Peter, Gerwards Sohn, im 13. Jahrhundert den Zehnten von 3 Hufen in Kukeskope, dem jetzigen Kuskoppermoor, an das Hamburger Domkapitel verkaufte,“ einigermaßen wenigstens aber durch die „Erbteilungsurkunde zwischen den Sehesteden wegen der Güter Ottenbüttel, Crummenteich, Beckdorff und Beckmünde“ dd. Glückstadt, den 6. Mai 1596.***) Hiernach erhielt nämlich von den 3 Söhnen des Besitzers des Hofes Ottenbüttel Jürgen Sehestede, Henneke, Emeke und Osmaldt, der erstere außer dem Hofe zu Ottenbüttel u.s.w. auch „de twe und twintig Morgen Landes, so Cornelius Johan Petersen itziger Tidt in de Huern hefft, alse desülvigen begrönet und begrasen liggen, dick- und dammfry, solange he und sine Lives Erven dat Landt bewahnen und in ehrer Hebbende beholden werden“ und zwar mit dem Hinzufügen: „Wat averst dat Ungelt van wegen des halwen Howen anlangedt, damit de Acker mochte beschweret werden, dat schall de Besitter des Landes uthgeven und afholden, und woferne he dat Landt verhüten oder verkopen worde, so schall Dick und Damm wedder darum gemaket werden, alse von Oldenshero darup gewesen is,“ und weiter mit dem Bemerken: „Ock schall Henneke Sestede, woferne he sulven up dem bemeldten Lande wahnen morde, edder sine Erven, desgliken sin Hurmann, sovele Torfes up ehre Unkostinge in dem More graven laten, als se tho ehrer Notdurft werden nödig hebben, doch schölen se mit dem Gravende viff Roden von der Geest blifen ok allewege tollenfry fahren, wat se vorm Krummendiek edder im Bekedorpe werden föhren laten.“ Der zweite, Emeke, aber erhielt außer dem Gut Krummendiek und dem Patronatrecht über die Kirche „thom Krummendicke“ und „Lütken Rahde“ usw. auch „den Teyent-
*) Siehe Geschichte der holsteinischen Elbmarschen Band I. Seile 84.
**) Siehe Schröders Topographie.
***) Sie ist kopiert für das Archiv in Hohenaspe.
haveren (Zehnthafer), so jahrlickes von Helwicks Home in Honnigflete gegeven werbt“ „und ock wat jahrlickes von Peter Poppen Howe des Klostermans na Ludt des Registers gegeven werbt.“ Es ist nach diesem unzweifelhaft, daß Jürgen Sehestede vom Hofe Ottenbüttel und seine Vorfahren schon Marschländereien, und zwar in der angrenzenden Wilstermarsch, besaßen und auf denselben Pächter und Häuersleute wohnen hatten, und um dieser Ländereien und Wohnstätten willen besondere Abgaben, welche zum Teil wenigstens im Zehnthafer bestanden, der Kirche in Hohenaspe, als der Kirche des Hofes Ottenbüttel, zufließen mußten. Vergleichen wir aber auch die in der Erbteilungsurkunde sich findenden Namen mit den Zehnthaberpflichtigen der Wilstermarsch im Jahre 1726, so ist jedenfalls sehr bemerkenswert, daß dort wie hier der Familienname Poppe erwähnt wird, wir haben mithin sicherlich die Sehestedeschen Marschländereien, für welche die Kirche in Hohenaspe Zehnten bezog, da zu suchen, wo 1726 die Poppes und ihre Genossen wohnten, d. h. in Howe, Kuskoppermoor, Rumfleth und Hakeboe. Daß der erste nachweisbare Besitzer des Hofes in Ottenbüttel, der Vogt (advocatus) Heinrich (1149), bereits die späteren Sehestedeschen Marschländereien innegehabt, ist ja freilich nicht zu konstatieren; wohl aber werden in einer Urkunde vom 13. September 1149 Ethlerus de Drage und Hasso, Sohn des Advokaten Heinrich de Ottenedbotele „testes et fautores et cooperatores“, d. i. Zeugen, Begünstiger und Bewerkstellige der Verleihung von Ländereien an der Wilster und an der Stör genannt, und ist es sonach nicht unwahrscheinlich, daß die Zehnthaferlieferung schon in die erste Zeit der wohl schon vor 1164, dem Jahr der Gründung oder des bereits Vorhandenseins der Kirche zu Wilster, existierenden Hohenasper Kirche zurückreicht?
7. Die Roggenlieferung von Ottenbüttel an Heiligenstedten.
Ganz ähnlich verhält sich’s auch mit den 2 Tonnen Roggen, welche eine Landstelle in Ottenbüttel alljährlich um Lichtmeß an das Pastorat in Heiligenstedten zu entrichten hat, und über welche das Archiv für Staats- und Kirchen-
geschichte*) nur zu sagen weiß, es scheine daraus hervorzugehen, daß der Pflichtige früher dem Kirchspiel Heiligenstedten angehört habe. Auch hier giebt die Erbteiluugsurkunde vom 6. Mai 1596**) genügenden Aufschluß. Von den 3 Söhnen des Jürgen Sehestede zu Krummendiek und Ottenbüttel (1569), des Nachfolgers Emeke Sehestedes (1555), des Sohns Henneke Sehestedes (1531, 1533) auf Krummendiek und der Margaretha geb. von Damm, welcher vermählt war mit Olegart, geb. von der Wisch, erhielt nämlich der 3. Oswaldt die Güter Beckdorff und Beckmünde im Kirchspiel Heiligenstedten und unter andern auch „dat grote Ottenbütteler Holt“. Selbstredend waren der Erbe und seine Nachfolger für diesen seinen auswärtigen Besitz an Heiligenstedten steuerpflichtig, vollends wenn er auf demselben einen Holzvogt als Aussichtsmann wohnen ließ; doch konnte ja dieser auch verpflichtet werden, die Kirchensteuer selber zu tragen. Es ist zwar nicht der erste, vielleicht auch nicht der zweite der Holzvögte in der „Halloh“, dem großen Ottenbüttler Holz, bekannt, wohl aber sind’s die folgenden. Ihre Namen wurden oben auch schon genannt. Der erste unter ihnen, der Holzvogt Detlef Kock, von dem bereits erwähnt wurde, daß er, nachdem er schon den letzten Grafen Rantzau gedient, im Dienst des Markgrafen am 17. Januar 1757 in einem Alter von 81 Jahren gestorben sei, hinterließ eine Tochter Antje. Diese heiratete Hinrich Witt und schenkte ihm 3 Kinder, Detlef, Hinrich und Margreth. Nach ihrem Tode verheiratete sich ihr Witwer als hochfürstl. markgräfl. Holzvogt und Nachfolger seines Schwiegervaters am 24. März 1759 mit Engel geb. Bock, und nachdem auch diese gestorben, trat er zum dritten Mal in die Ehe mit der Witwe Cielke Martens. Seine beiden letzten Ehefrauen schenkten ihm keine Kinder. Er starb den 1. Dezember 1782.
Sein Nachfolger als Holzvogt war sein ältester Sohn Detlef, verheiratet zuerst mit Abel Rubahn von Westermühlen, Mutter von Matthies und Hinrich, dann mit Abel Haß, Mutter von Detlef und Clas, endlich mit Cathrin Margreth
*) Band IV. Seite 140.
**) Siehe oben.
Boden, Mutter von Anna Abel, Ernst Hinrich, Paul, Cathrin Margreth, Christian, Hans und Cilia. Gestorben den 27. November 1808, wird er als Halbhufner bezeichnet, während sein Vater zuletzt Verlehntstätner war. In welchem verwandtschaftlichen Verhältnis zu diesen beiden Holzvögten der jetzige Halbhufner Cay, Detlef Witt in Ottenbüttel steht, haben wir bereits oben, wo von den Förstern, Holzvögten u.s.w. die Rede war, gesehen. Hier nur dies noch: Der letztgenannte Halbhufner Witt hat zuletzt die 2 Tonnen Roggen an Heiligenstedten zu liefern gehabt.*)
8. Die Hollgrube.
Aus Baltzer von Ahlefelds Zeit datiert nach dem Kircheninventar das ehemalige Recht des Pastors und des Organisten in Hohenaspe auf je einen Morgen Moorland in der Hollgrube im Gut Mehlbeck. Der Pastor und der Organist konnten dies Land entweder selbst grasen oder auch verhäuern, die darauf haftenden Unkosten und Beschwerden hielt der Besitzer des adeligen Guts Mehlbeck oder auch dessen Häuersmann beständig ab, hatte aber dafür auch den Genuß des Vor- und Nachgrases. Wegen der weiten Entfernung des Grundstücks von Hohenaspe war die Selbstbenutzung so gut wie ausgeschlossen. Zur Zeit des Pastors Hennings wurde von einem Erbpächter beiden á 11 Thlr. cour. dafür bezahlt. Die Ablösung war sehr angebracht.
*) Vergleiche auch die bisher unaufgeklärt gewesene, noch viel seltsamere Lieferung von 7 Tonnen 2 1/4 Himpten Roggen auf Martini aus dem weit entlegenen Dorf Hagen im Kirchspiel Bramstedt an das Pastorat zu Heiligenstedten, die unschwer daraus erhellt, daß Hagen unweit, oder wohl gar innerhalb der Grenzen des uralten adeligen Guts Stilnowe (Stellau) liegt, von wo aus Hartwig Busche (von Krummendiek, Ritter von Ottenbüttel) 1230 mit vier Bewohnern des Dorfes Stellau die Kirche zu Stilnowe (Kirch Stellau auf einer Anhöhe in der sonst flachen Gegend südlich der Stör und am Südufer der Bramau) gründete und das bis hinein ins 18. Jahrhundert Besitz der Familie Krummendiek war und von Burchard Krummendiek (1501) auf seine Tochter, die Gemahlin Christophs von Ahlefeldt, weiter auf deren Sohn Jürgen und endlich auf dessen Neffen, den Sohn Burchard von Ahlefeldts, Baltzer wan Alleweldt, überging (1580). welcher letztere, bekanntlich Besitzer von Heiligenstedten, 1586 das Gut für 16000 Thlr. Species an seinen Schwiegervater Heinrich zu Rantzau auf Breitenburg verkaufte.
9. Zu den Briefadressen des Pastors Eberwein.
Außer der oben erwähnten französischen Adresse findet sich doch ein paar Mal auch „Pasteur de Eeglise à Hohenaspe“ d. i. Pastor der Kirche zu Hohenaspe, und ebenfalls ein paar Mal die sehr bezeichnende Aufschrift in deutscher Sprache: „Dem Würdigen und Wohlgelehrten, Unserm Lieben, Andächtigen und Getreuen, Herrn Joh. Chr. Eberwein, Pastori der (oder bey der) Kirche zu Hohenaspe.“
10. Die freien Fuhren.
Nach dem Kircheninventar hatten 3 sogenannte Lansten in Hohenaspe, ehemals Bartel Trede und Johann Sommer daselbst, die Pflicht, sämtliche „zum Consistorio und Verwaltung des Gnadenjahres destinierte Fuhren zu verrichten, wogegen ihnen vom Pastore täglich 4 Schilling gewährt wurden.“ Seit der Ablösung dieser Pflicht*) hat der Pastor diese Fuhren selbst zu leisten.
11. Alte Lieferungs- und Zahltermine.
Als Lieferungs- und Zahltermine bestehen noch heute aus alter Zeit Catharinentag (oder der 25. November), Lichtmeß (oder der 2. Februar), Montag nach dem 2. Advent und die auch anderswo gebräuchlichen: Michaelis, Martini, Neujahr, Ostern, Pfingsten, Umschlag, Maitag.
12. Alte Kornmaße.
Eine vormalige Tonne Itzehoer Maß hatte 5 Geesthimpten. Weil eine Itzehoer Tonne = 7 Scheffel 7 7/8 Sechzehntel Scheffel seeländisch Maß, reduzierte man in der Folgezeit unter Abrechnung eines ganz „inconsiderablen Bruchs“ ein Geesthimpten auf 1 Scheffel 8 Sechzehntel Scheffel. Später rechnete man 1 Tonne = 8 Scheffel = 139,121 Liter und brachte, was über 1/32 Liter ergab, mit 1/16 Liter in Anrechnung. Sonach waren die 3 Tonnen Roggen, welche das Gut Drage für die Hofloge an den-
*) Siehe oben die Reallastenablösung
Pastor zu liefern hatte, 1 Tonne 6 Scheffel 15 5/8 Sechzehntel Scheffel seeländ. Maß und = 2 Hektoliter 607/16 in Liter neustes Maß u.s.w.
13. Brautkronen und Kirchspielzeug.
Die noch zur Zeit des Pastors Hennings und später vom Pastor in Hohenaspe dargebotenen Brautkronen sind ebenso wie die von ihm gelieferten Taufkleider (das sogen. Kirchspielzeug) längst außer Gebrauch gekommen, so daß die jüngere Generation schon von beiden; nichts mehr weiß und, wenn davon die Rede ist, sich beides von den älteren Leuten muß erklären lassen. Alte Bräuche und Sitten sind abgekommen, neue sind an ihre Stelle getreten; ob allemal bessere? Wie viele Bräute tragen jetzt ihren Brautkranz mit Ehren, und wie viele junge Männer treten jetzt, ohne die Unschuld geschädigt zu haben, au den Traualtar?
11. Das Oberinspektorat des Guts Friedrichsruhe.
Zur Zeit der markgräflichen Witwe bestanden nicht nur Justitiariate für die Gutsbezirke Drage und Mehlbeck und das adelige Kloster in Itzehoe, wir begegnen nicht nur dem Königlichen Inspektor und Justitiar zu Drage, Joach. Friedr. Anton Paulsen, dem Regierungsadvokat und Justitiar für Krummendiek und Mehlbeck neben dem Geheimen Legationsrat Baron von Meurer, dem Erbherrn dieser Güter, und dem dänischen Geheimrat und Landrat Cai zu Rantzau, Kammerherrn auf Gaartz, Erbherrn, Ritter und Verbitter der Klöster zu Preetz und zu Itzehoe, sondern auch dem Kanzleirat und Breitenburgischen Oberinspektor und Justitiar des Guts Friedrichsruhe Levin Friedrich Zimmermann auf Osterhof, östlich von Itzehoe.
15. Der Kaisborsteler Teich und die darauf erbaute Kate.
Am 22. November 1836 hatten das Kirchen- und das Armenkollegium zu Hohenaspe sich dahin erklärt, daß, weil „das Besitzthum Borsteler Teich auf dem Grund und Boden des zum Kirchspiel Schenefeld eingepfarrten Dorfes Püschen
dorf liege und auch zum Schulddistrikt dieses Dorfes gehöre“, dasselbe am besten auch in Kirchen- uud Armensachen nach Schenefeld mit hingezogen werde.
Nachdem die Königl. Oberintendantschaft des Guts Drage zu Itzehoe unterm 10. März demgegenüber geäußert, es erscheine ihr doch „zweifelhaft, ob das Besitzthnm Borsteler Teich wirklich auf dem Grunde des Dorfes Pöschendorf liege,“ entschied am 5. Oktober 1837 die unterm 8. August d. JS. von Pastor With mit Bericht versehene Königliche Regierung zu Gottorf dahin, daß „der Borsteler Teich mit der daraus befindlichen Kate in Kirchen- und Armensachen als zur Gemeinde Hohenaspe gehörig angesehen werden solle,“ und mußte Propst Wolf in Itzehoe dem Kirchen- und Armenkollegium die Anzeige machen, daß für die Zukunft hiernach zu verfahren sei.
Ob diese Entscheidung auf sicherem Grunde ruhte? Die Antwort giebt eine undatierte, jedoch von Pastor Wolf mit „in fidem“ und „Namensunterschrift“ versehene, nach Schrift und Stil unverkennbar noch aus dem 18. Jahrhundert stammende „Nachricht wegen des Kaisborsteler Teiches und der Kate alda“, wonach „die Frau Markgräfin diesen ehemahls herrschaftlichen Teich an einen ihrer Laquaien Nahmens Wilhelm Schall, wohnhaft zu Pöschendorf, gegen Zahlung einer jährlichen Recognition von 2 Reichsthalern geschenkt,“ der Beschenkte aber „zum Konkurs gegangen,“ und, nachdem ein gewisser Piper zu Christinenthal, welcher sofort wieder an einen in Pöschendorf verkauft, ihn ans dem Konkurs gelöst, der qu. Teich von dem alten Marx Langmaack am Tiergarten käuflich erstanden und mit der Kate bebaut worden.
Der neuerdings meist „Ketelsfoor“ (hochdeutsch Ketelsfurth) genannte Besitz, der, höchstens eine halbe Stunde Wegs von Schenefeld entfernt, zu Süden wie zu Westen Schenefelder Nachbarschaft hat, ist, nachdem er öfters seinen Besitzer gewechselt, gegenwärtig Eigentum des H. J. Holtorf, der auch auf dem Hohenasper Kirchhof sein Erbbegräbnis hat.
16. Zu den Besitzern der 7. und 8. Parcele.
Unter den ersten Besitzern der 7. und 8. Parzele hat leider Nebelung keinen Raum gefunden. Er war Besitzer
der beiden Parzelen, als J. Schnack und Baron von Meurer die beiden anderen größeren Höfe innehatten; denn nicht nur daß sein Name sich in den alten Heberollen neben den Genannten findet und er als 1 1/2 Hufner besteuert worden, das ihm aus der alten Kirchhofskarte von 1815 zugemessene Erbbegräbnis Nr. 119 ist auch dasselbe, wie Nr. 5 auf der neusten Kirchhofskarte, der Grabteil des gegenwärtigen Besitzers der 7. und 8. Parcele. Im übrigen fehlen über ihn alle und jede andere Nachrichten. Nebelhaft wie sein Name ist er gekommen und gegangen.
17. Die Lutherfeier 1883, die Missionsfeste 1893 und 1894 und die Gustav-Adolf-Feier 1894.
Kurz erwähnt sei auch noch, daß über die zweifelsohne stattgehabte Gedächtnisfeier des 400. Geburtstages unsers Dr. M. Luther am 10. November 1883 auch nicht das Geringste aufbehalten ist, sowie daß sowohl am 13. Oktober 1893, als auch am 7. September 1894 besondere Missionsfeste in aller Stille gefeiert worden und am 9. Dezember 1894 des 300. Geburtstages des Schwedenkönigs Gustav Adolf, des am 6. November 1632 bei Lützen, 38 Jahre alt, den Heldentod gestorbenen Retters des evangelischen Deutschlands, in gebührender Weise gedacht worden. Bei Gelegenheit der beiden Missionsfeste berichtete der Missionar Timmcke über die Mission in Indien. Das erste Mal wurde nicht nur am Vormittage im Gotteshaus, sondern auch am Nachmittage im Pastorat gefeiert. Die letztere Feier im Pastorat bestand in freier Konversation der zahlreich erschienenen Gemeindeglieder mit den: Missionar über den Stand der Dinge draußen unter den armen Heiden. Möge dadurch bei vielen auf Dauer ein reges Interesse für die Heidenmission und namentlich für die heimische Mission, deren Arbeitsgebiet das Telugu- und Odija-Land Ostindiens ist, erweckt sein!
18. Schlußbemerkung:
„Daß Drage = Drache, bestätigt der Name „Otto Draco“ in einer Urkunde von 1249. (Vergl. Hasses Regesten. Bd. I. S. 321.)“
So nimm denn nun dies Büchlein hin,
Mein Heim; dir sei’s geweiht.
Daß ich schon ganz der deine bin,
Zeig es dir allezeit.
Hab ich mich hie und da versehn,
Verzeih es freundlich mir.
Absichtlich ist es nicht geschehn,
Das sag ich offen dir.
Den Spuren, so wie ich sie fand,
Ging ich getreulich nach,
Und hat gestaltet meine Hand,
So gut sie es vermag.
Den kleinen Denkstein, heb‘ ihn auf,
Daß auch die Nachwelt seh‘
Nach fahren noch verzeichnet drauf-.
So stand’s um Aspes Höh‘.